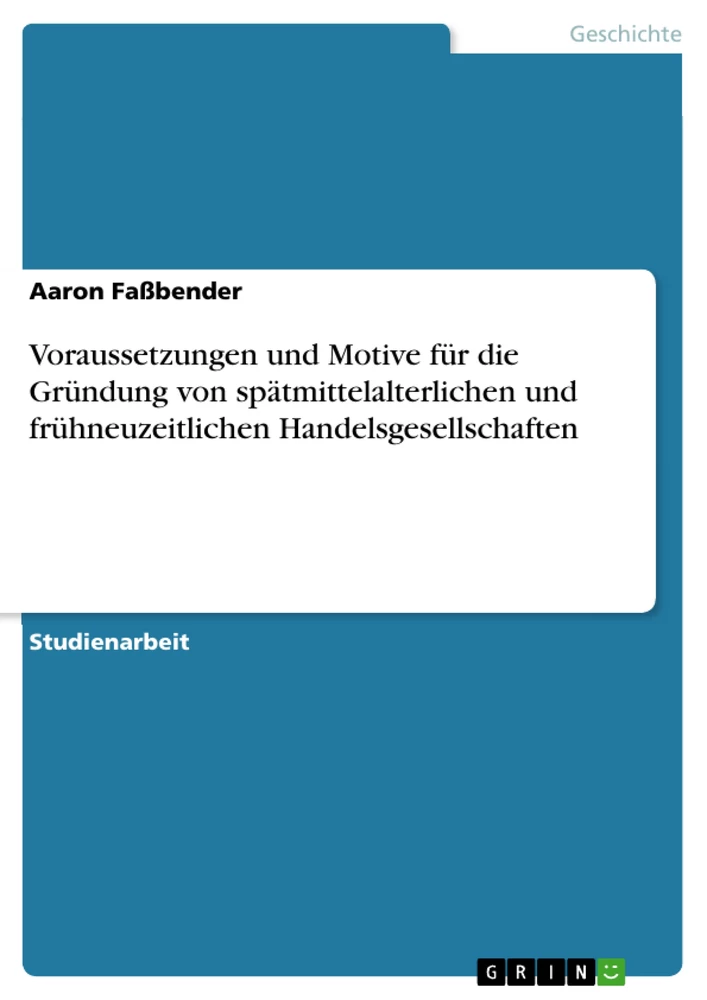Spätmittelalterliche und neuzeitliche Handelsgesellschaften (wedderlegginge), sind oftmals Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen – insbesondere dann, wenn sie im Zusammenhang mit der Hanse stehen. Zumeist konzentrieren sich die Abhandlungen auf die wirtschaftliche Entwicklung oder den politischen Einfluss dieser Vereinigungen. Die vorliegende Arbeit hingegen setzt sich mit den Motiven auseinander, die zur Gründung von Handelsgesellschaften geführt haben. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich die Handelsgesellschaften in ihrer weiteren Entwicklung von diesen Gründungsideen entfernt haben.
Der zu beobachtende Zeitraum beschränkt sich auf das ausgehende 14. Jahrhundert, in dem sich ein Wandel der kommerziellen Strukturen vollzog, bis hinein ins frühe 17. Jahrhundert, dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges, der – durch das Wegbrechen vieler Märkte - auch ökonomische Umwälzungen mit sich zog. Der geographische Schwerpunkt wird im deutschsprachigen Raum liegen, unter besonderer Berücksichtigung des norddeutschen Raumes.
Während sich an Italiens Mittelmeerküste bereits seit dem 10. Jahrhundert erste Gesellschaften (commenda, societas maris) ausbreiteten und seit dem 13. Jahrhundert im italienischen Binnenland, v.a. in Piacenza, Siena, Lucca und Florenz, Handelskompanien entstanden, wurden auf deutschem Boden erst im 14. und 15. Jahrhundert vergleichbare Gesellschaften gegründet. Da die Handelsgesellschaften in den verschiedenen Gebieten Deutschlands in ihrer Ausprägung variierten, sollen an dieser Stelle, anhand einiger ausgewählter Beispiele, die Motive für den Zusammenschluss der Kaufmannschaften dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Fragestellung und thematische Eingrenzung
- Vorgehensweise, Quellenlage und Forschungsstand
- Definition des Fernhandels
- Das Warensortiment der Fernhandels
- Die Funktionsweise hansischer Handelsgesellschaften auf Basis der Widerlegung
- Die erste Widerlegung und die Aufnahme in eine kaufmännische Gilde
- Die Handelsgesellschaft als wirtschaftliches Übereinkommen auf Basis der Widerlegung
- Die Entwicklung komplexer Handelsgesellschaften
- Der Handel mit Sendegut
- Das rechtliche Verhältnis zwischen den Gesellschaftern
- Die Lüneburger Kagelbrüderschaft als Beispiel für eine weitreichende Handelsgesellschaft
- Gesellschaftlicher Einfluss und politische Ziele der Kagelbrüder
- Die Statuten von 1468
- Schlussbetrachtungen
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Motiven, die zur Gründung von Handelsgesellschaften im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit führten. Sie untersucht, inwiefern sich diese Gesellschaften in ihrer Entwicklung von ihren ursprünglichen Gründungsideen entfernt haben. Der Fokus liegt dabei auf dem deutschsprachigen Raum, insbesondere dem norddeutschen Raum, und betrachtet den Zeitraum vom ausgehenden 14. Jahrhundert bis ins frühe 17. Jahrhundert.
- Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung von Handelsgesellschaften
- Die Rolle der Widerlegung im hansischen Handelsgesellschaftssystem
- Die Entwicklung und Funktionsweise von Handelsgesellschaften
- Der gesellschaftliche Einfluss und die politischen Ziele von Handelsgesellschaften
- Die Bedeutung des Zusammenschlusses von Kaufleuten für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Fragestellung und die thematische Eingrenzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet den Wandel der kommerziellen Strukturen im ausgehenden 14. Jahrhundert bis ins frühe 17. Jahrhundert und die Bedeutung von Handelsgesellschaften in diesem Kontext. Das erste Kapitel befasst sich mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung von Handelsgesellschaften, insbesondere dem Fernhandel und der Widerlegung. Es analysiert die Funktionsweise der Widerlegung als kleinste wirtschaftliche Gesellschaft und ihre Bedeutung für den hansischen Handel. Das zweite Kapitel widmet sich den weiteren Betätigungsfeldern von Handelsgesellschaften und untersucht die Entwicklung komplexer Handelsgesellschaften, den Handel mit Sendegut und das rechtliche Verhältnis zwischen den Gesellschaftern. Das dritte Kapitel analysiert die Lüneburger Kagelbrüderschaft als Beispiel für eine weitreichende Handelsgesellschaft und untersucht ihren gesellschaftlichen Einfluss, ihre politischen Ziele und ihre Statuten von 1468. Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchten die Bedeutung des Zusammenschlusses von Kaufleuten für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Handelsgesellschaften, Fernhandel, Widerlegung, Hansa, Kaufmannsgilden, Lüneburger Kagelbrüderschaft, Spätmittelalter, Frühe Neuzeit, wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftlicher Einfluss, politische Ziele, Gründungsideen, Statuten, wirtschaftliche Voraussetzungen, rechtliche Verhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Motive für die Gründung mittelalterlicher Handelsgesellschaften?
Motive waren wirtschaftlicher Erfolg im Fernhandel, politischer Einfluss und der gesellschaftliche Aufstieg der Kaufmannschaft.
Was bedeutet der Begriff „Widerlegung“ (wedderlegginge)?
Es war die kleinste Form einer wirtschaftlichen Gesellschaft im hansischen Raum, die als Basis für kaufmännische Übereinkommen diente.
Was war die Lüneburger Kagelbrüderschaft?
Ein Beispiel für eine weitreichende Handelsgesellschaft mit großem gesellschaftlichem Einfluss und spezifischen politischen Zielen.
In welchem Zeitraum entstanden diese Gesellschaften in Deutschland?
Während sie in Italien schon ab dem 10. Jahrhundert bestanden, wurden vergleichbare Gesellschaften auf deutschem Boden erst im 14. und 15. Jahrhundert gegründet.
Wie endete diese Ära der Handelsgesellschaften?
Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges im frühen 17. Jahrhundert führte durch das Wegbrechen von Märkten zu massiven ökonomischen Umwälzungen.
- Quote paper
- M. A. Aaron Faßbender (Author), 2004, Voraussetzungen und Motive für die Gründung von spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handelsgesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182586