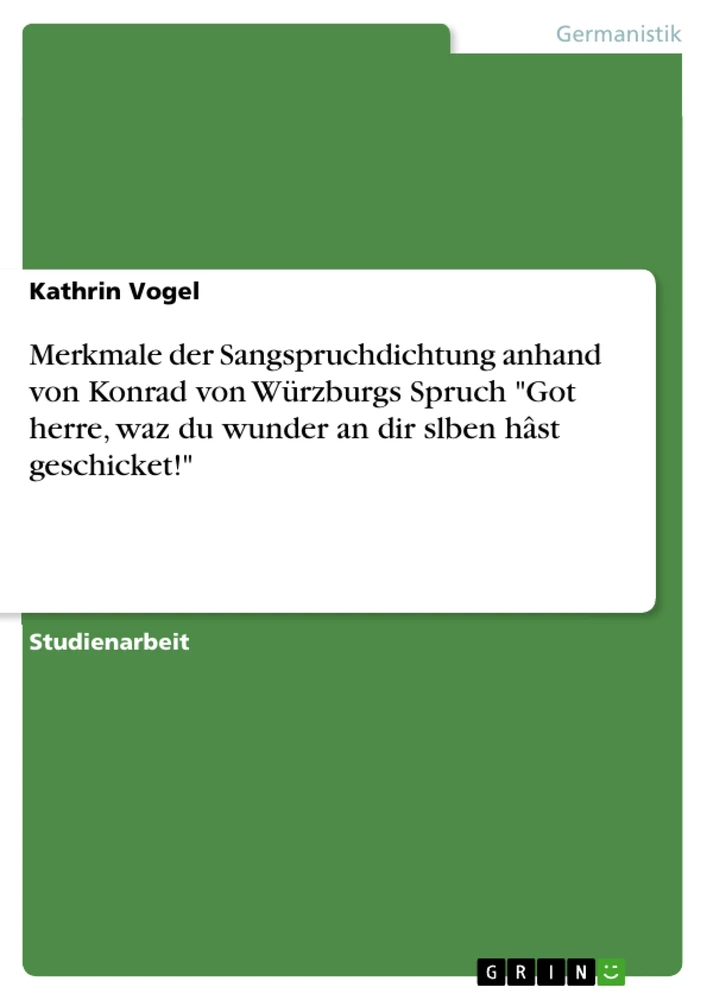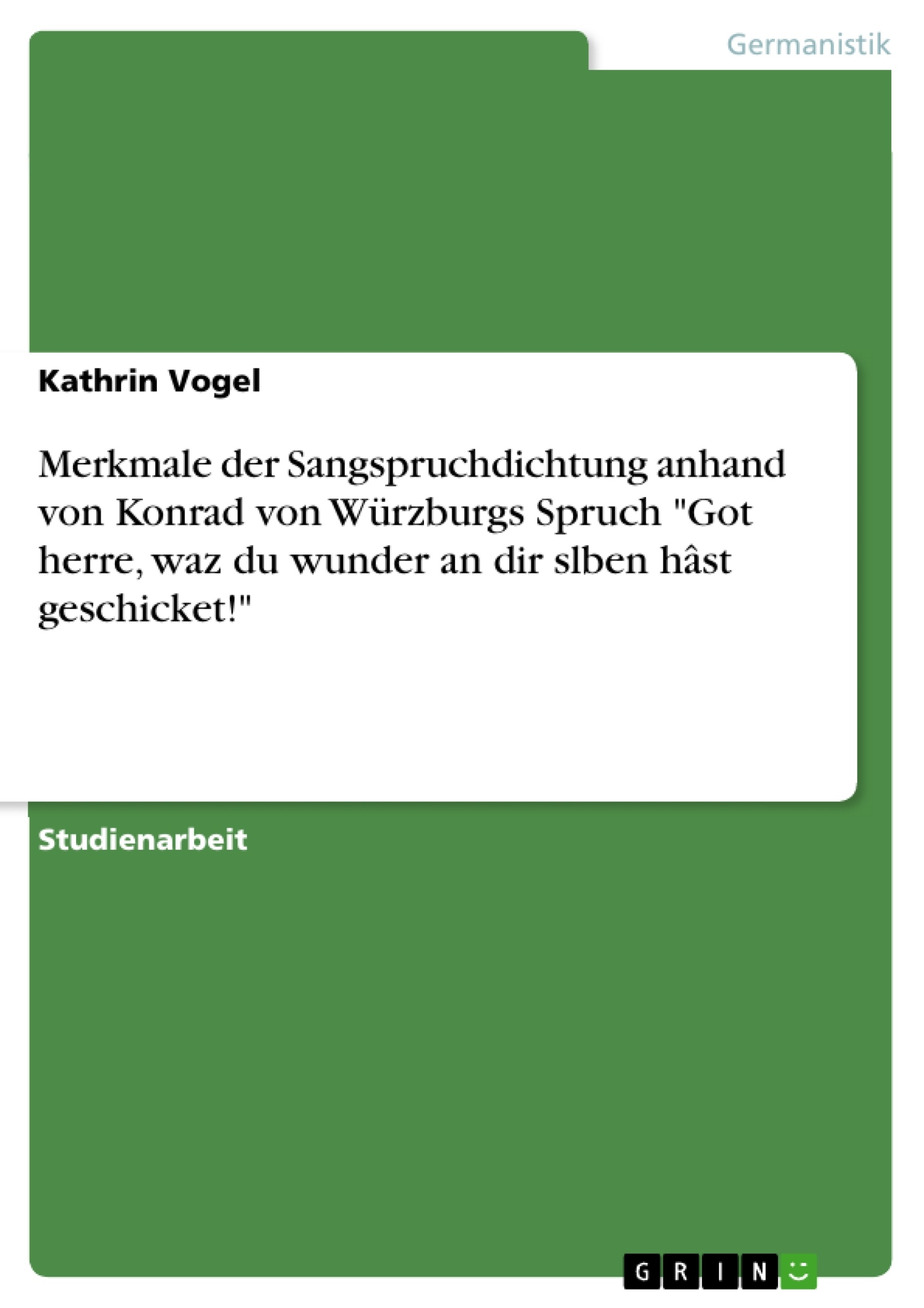Konrad von Würzburgs zeichnet sich durch ein überaus vielfältiges Werk aus, das sowohl Minnelieder als auch Sangspruchdichtung einschließt. In seinen Liedern und Sprüchen wird sowohl eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kunstbegriff seiner Zeit wie auch mit der eigenen Kunstfertigkeit deutlich. In dieser Arbeit werden an einem Sangspruch Konrads von Würzburg exemplarisch die Besonderheiten der Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts im Allgemeinen wie auch die individuelle Ausdrucksform des Dichters in Bezug auf das zu dieser Zeit aufkommende „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchsänger näher untersucht werden. Dazu werden zunächst die Merkmale der Sangspruchdichtung erläutert und auf die Besonderheiten der Spruchdichtung bei Konrad von Würzburg im Allgemeinen eingegangen. Anschließend bildet der Spruch "Got herre, waz du wunders an dir selben hâst geschicket!" die Grundlage für eine Analyse dieser Besonderheiten im Konkreten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sangspruchdichtung im 13. Jahrhundert
- 2.1 Allgemeine Merkmale und Entwicklungen
- 2.2 Besonderheiten der Spruchdichtung bei Konrad von Würzburg
- 3. Motiv und Inhalt des Sangspruchs
- 3.1 Geistliche Thematik in der Sangspruchdichtung
- 3.2 Das Motiv Dreifaltigkeit in Konrads Sangspruch
- 4. Sprache und Form des Sangspruchs am konkreten Beispiel
- 4.1 Sprachliche Gestaltung
- 4.2 Formale Gestaltung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Merkmale der Sangspruchdichtung anhand eines konkreten Beispiels: Konrads von Würzburgs Sangspruch „Got herre, waz du wunder an dir selben hâst geschicket!“. Ziel ist es, die Besonderheiten der Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts im Allgemeinen und die individuelle Ausdrucksform Konrads von Würzburg im Besonderen zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf das „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchsänger.
- Merkmale der Sangspruchdichtung im 13. Jahrhundert
- Besonderheiten der Spruchdichtung bei Konrad von Würzburg
- Geistliche Thematik in der Sangspruchdichtung
- Motiv der Dreifaltigkeit in Konrads Sangspruch
- Sprachliche und formale Gestaltung des Sangspruchs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters ein, hebt die Bedeutung des Minnesangs hervor und stellt die Sangspruchdichtung als ein weniger beachtetes, aber gleichwohl bedeutendes Genre vor. Sie betont die Unterordnung der Sangspruchdichtung unter den Minnesang in der bisherigen Forschung und kündigt die geplante Analyse eines Sangspruchs Konrads von Würzburg an, um die Besonderheiten der Sangspruchdichtung und das „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchsänger zu untersuchen.
2. Sangspruchdichtung im 13. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die allgemeine Problematik der Terminologie und Definition der Sangspruchdichtung. Es beschreibt Sangsprüche als gesungene, strophische Dichtungen, die oft einstrophisch sind und in sich geschlossen, aber auch zu Zyklen zusammengefügt werden können. Im Gegensatz zum Minnesang steht bei Sangsprüchen nicht die thematische Zusammengehörigkeit im Vordergrund, sondern der Darbietungsanlass und die Melodie. Inhaltlich umfassen Sangsprüche vielfältige Themen, darunter moralische, religiöse und politische Aspekte. Weiterhin wird die zunehmende Auseinandersetzung mit der Dichtkunst selbst und die Reflektion der eigenen Kunstfertigkeit der Sangspruchdichter herausgestellt, die auch zu „Dichterfehden“ führten.
3. Motiv und Inhalt des Sangspruchs: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Motiv und den Inhalt von Konrads Sangspruch. Es untersucht die geistliche Thematik in der Sangspruchdichtung allgemein und analysiert dann das Motiv der Dreifaltigkeit im ausgewählten Sangspruch Konrads von Würzburg.
4. Sprache und Form des Sangspruchs am konkreten Beispiel: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse der sprachlichen und formalen Gestaltung des ausgewählten Sangspruchs Konrads von Würzburg. Es untersucht die sprachlichen Mittel, die der Dichter einsetzt, sowie die formale Struktur des Gedichts.
Schlüsselwörter
Sangspruchdichtung, Konrad von Würzburg, Minnesang, mittelhochdeutsche Lyrik, geistliche Thematik, Dreifaltigkeit, Sprachliche Gestaltung, Formale Gestaltung, professionelles Dichterbewusstsein, 13. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Analyse eines Sangspruchs Konrads von Würzburg"
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert einen Sangspruch Konrads von Würzburg, „Got herre, waz du wunder an dir selben hâst geschicket!“, um Merkmale der Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts und die individuelle Ausdrucksform Konrads von Würzburg zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf das „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchsänger.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Merkmale der Sangspruchdichtung im 13. Jahrhundert, Besonderheiten der Spruchdichtung bei Konrad von Würzburg, geistliche Thematik in der Sangspruchdichtung, das Motiv der Dreifaltigkeit in Konrads Sangspruch, sowie die sprachliche und formale Gestaltung des Sangspruchs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Sangspruchdichtung im 13. Jahrhundert, Motiv und Inhalt des Sangspruchs, Sprache und Form des Sangspruchs am konkreten Beispiel und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind die zentralen Fragestellungen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, welche Merkmale die Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts auszeichnen, wie sich Konrads von Würzburgs Stil von anderen Sangspruchdichtern unterscheidet und wie sich das „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchsänger in seinem Werk manifestiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der geistlichen Thematik und des Motivs der Dreifaltigkeit im ausgewählten Sangspruch.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analysemethode, die sowohl die allgemeine Kontextualisierung der Sangspruchdichtung als auch eine detaillierte Interpretation des ausgewählten Sangspruchs Konrads von Würzburg beinhaltet. Es wird die sprachliche und formale Gestaltung des Gedichts analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sangspruchdichtung, Konrad von Würzburg, Minnesang, mittelhochdeutsche Lyrik, geistliche Thematik, Dreifaltigkeit, Sprachliche Gestaltung, Formale Gestaltung, professionelles Dichterbewusstsein, 13. Jahrhundert.
Was ist der Unterschied zwischen Minnesang und Sangspruchdichtung?
Während im Minnesang die thematische Zusammengehörigkeit im Vordergrund steht, ist bei Sangsprüchen der Darbietungsanlass und die Melodie wichtiger. Sangsprüche sind oft einstrophisch und in sich geschlossen, können aber auch zu Zyklen zusammengefügt werden. Inhaltlich umfassen Sangsprüche vielfältigere Themen als der Minnesang.
Welche Bedeutung hat das „professionelle Bewusstsein“ der Sangspruchdichter?
Die Arbeit untersucht, wie sich die zunehmende Auseinandersetzung der Sangspruchdichter mit der Dichtkunst selbst und die Reflektion der eigenen Kunstfertigkeit in ihren Werken manifestiert. Dieses „professionelle Bewusstsein“ führte auch zu „Dichterfehden“.
Wie wird die geistliche Thematik im Sangspruch behandelt?
Die Arbeit analysiert die geistliche Thematik in der Sangspruchdichtung allgemein und im Speziellen das Motiv der Dreifaltigkeit in Konrads von Würzburgs Sangspruch. Die Analyse betrachtet den Inhalt und die sprachliche Gestaltung, um die Darstellung der geistlichen Thematik zu verstehen.
- Quote paper
- Kathrin Vogel (Author), 2009, Merkmale der Sangspruchdichtung anhand von Konrad von Würzburgs Spruch "Got herre, waz du wunder an dir slben hâst geschicket!" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182593