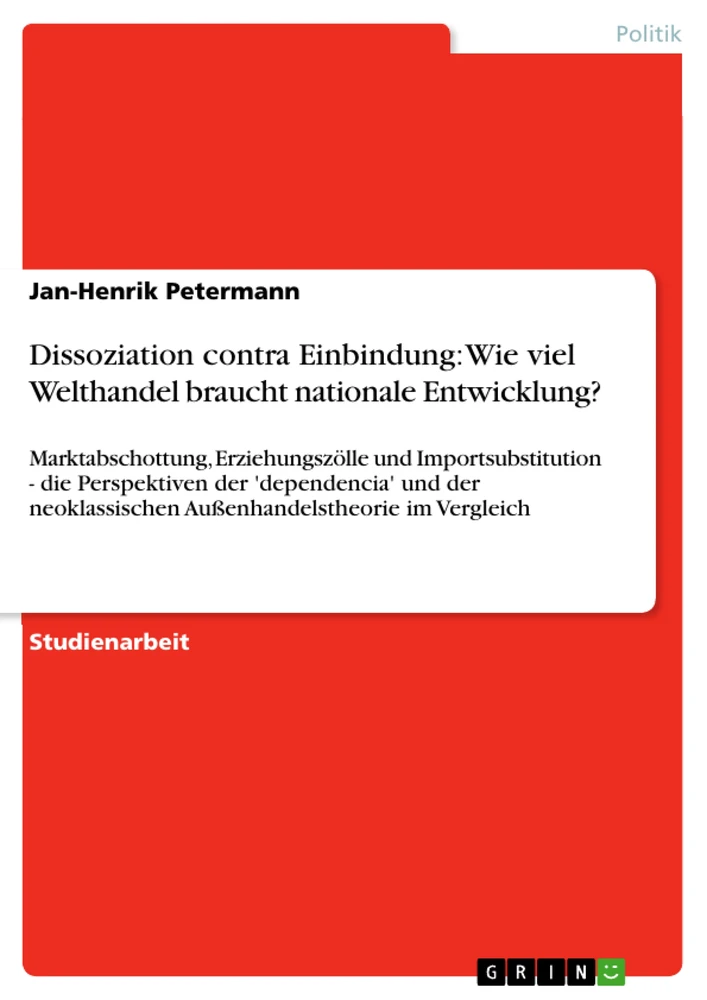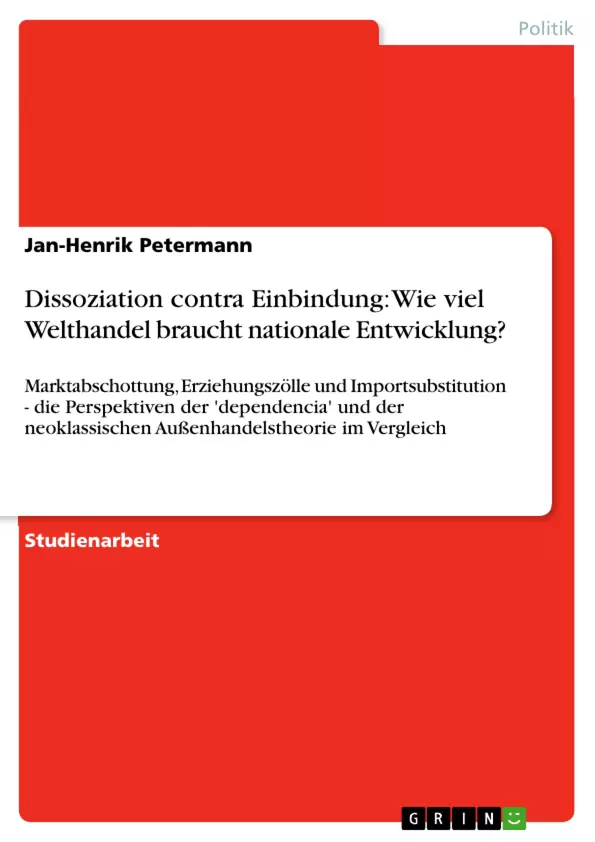Die Dependenztheorie galt von den späten 1960er bis zu den frühen 1980er Jahren als ein bestimmendes Paradigma auf dem Gebiet der Nord-Süd-Beziehungen. Sowohl die theoretischen Fundierungen des Dependencia-Konzepts als auch die zahlreichen Versuche seiner empirisch-praktischen Verifikation gingen dabei weit über den klassischen Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften hinaus: Neben Politologen, Soziologen und Historikern befassten sich auch Ethnologen und Kulturwissenschaftler sowie - nicht zuletzt - eine Vielzahl von Entwicklungsökonomen mit den Prämissen und Implikationen der sich etablierenden Großtheorie, die im akademischen Diskurs über die Ursachen von Entwicklung bzw. Unterentwicklung bald in direkte Konkurrenz zu der bis dato tonangebenden Modernisierungstheorie1 treten sollte.
Im Unterschied zu solchen Mikroansätzen, die das Phänomen der Unterentwicklung weitgehend auf endogene Faktoren innerhalb des jeweils rückständigen Landes zurückzuführen suchten, postulierten die Vertreter der dependenztheoretischen Schule eine strukturell bedingte Abhängigkeit der unterentwickelten Länder von der industrialisierten "Ersten Welt", deren Ursache in der erzwungenen Einbindung der peripheren, sektoral wenig ausdifferenzierten "Dritte-Welt"-Volkswirtschaften in das kapitalistische Weltsystem und insbesondere in einen schrankenlosen Weltmarkt zu sehen sei.
Obgleich die Blütezeit der dependencia als sozialwissenschaftliche Großtheorie aus Sicht zahlreicher Autoren vergangen ist und das Freihandelsprinzip auch in Bezug auf entwicklungstheoretische und -politische Zusammenhänge nahezu unangefochten zu sein scheint, verfügt das dependenztheoretische Teilkonzept der Importsubstitution in einigen Wirtschaftsregionen der Welt nach wie vor über eine hohe Aktualität. Die vorliegende Arbeit geht daher der Frage nach, zu welchen unterschiedlichen Bewertungen der Importsubstitution die Dependenz- und die neoklassische Außenhandelstheorie gelangen und anhand welcher methodischen Maßstäbe diese Bewertungen erfolgen.
Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der Importsubstitution aus Sicht der Dependenztheorie dargelegt. Hierauf folgt eine kurze Analyse der seit den 1980er Jahren maßgeblichen neoklassisch-neoliberalen Schule einschließlich ihrer Beurteilung der Importsubstitution. Abschnitt 4 liefert eine empirische Einzelfallstudie zur praktischen Anwendung des Konzepts der weltmarktlichen Dissoziation. Abschnitt 5 fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Grundzügen der Dependenztheorie: handelspolitische Autarkie als notwendige Bedingung für eigenes Binnenwachstum
- Der dependenztheoretische Kernbefund: strukturelle Abhängigkeit der Entwicklungsländer
- Der Erziehungszoll-Gedanke als zentrales Strategieelement der Dependenztheorie
- Wirkungen der Protektion: von der Importsubstitution zur Exportdiversifikation?
- Die neoliberale Perspektive: Handelsbeschränkungen als Hemmnisse von Entwicklungsprozessen
- Die Position der neoklassischen Außenhandelstheorie
- Neue Ansätze: der handelsregulative Policy Mix und die „strategische Handelspolitik“
- Weltmarktliche Dissoziation aus Sicht der Empirie: das Beispiel Taiwan
- Fazit: Für und wider das Rigorosum der Teilzeit-Abkoppelung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Strategien der Importsubstitution (IS) und Exportdiversifikation (ED) aus der Perspektive der Dependenz- und der neoklassischen Außenhandelstheorie. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Bewertungen dieser Strategien und analysiert die methodischen Grundlagen, auf denen diese Bewertungen beruhen. Die Arbeit fokussiert sich dabei auf das Teilkonzept der IS in Bezug auf reale Gütermärkte und analysiert die potenziellen Auswirkungen der weltmarktlichen Dissoziation.
- Strukturelle Abhängigkeit der Entwicklungsländer
- Erziehungszölle und Importsubstitution
- Neoliberale Kritik an Handelsbeschränkungen
- Weltmarktliche Dissoziation: Theorie und Empirie
- Bewertung der Strategien der IS und ED
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Dependenztheorie und ihre Relevanz für die Nord-Süd-Beziehungen ein. Es beschreibt die zentralen Argumente der Dependenztheorie, die von einer strukturellen Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den Industrieländern ausgehen. Das zweite Kapitel behandelt die Strategie der Importsubstitution (IS) aus der Perspektive der Dependenztheorie. Es erläutert das Konzept des Erziehungszolls und die möglichen Auswirkungen der Protektion auf die Entwicklung eines Landes. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der neoklassischen Außenhandelstheorie und deren Kritik an Handelsbeschränkungen. Es beleuchtet die Argumente der neoklassischen Schule, die in Handelsliberalisierung und freiem Welthandel den Schlüssel zur Entwicklung sehen. Das vierte Kapitel stellt das Beispiel Taiwan als empirischen Fall für die praktische Anwendung der weltmarktlichen Dissoziation vor.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Dependenztheorie, Importsubstitution, Exportdiversifikation, Erziehungszoll, Neoklassische Außenhandelstheorie, Handelsliberalisierung, Weltmarktliche Dissoziation, Entwicklungsländer, Industrieländer, Nord-Süd-Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Dependenztheorie?
Sie postuliert, dass die Unterentwicklung von "Dritte-Welt"-Ländern durch eine strukturelle Abhängigkeit von den Industrieländern der "Ersten Welt" im kapitalistischen Weltsystem bedingt ist.
Was ist Importsubstitution (IS)?
Importsubstitution ist eine Strategie, bei der ein Land versucht, Importe durch eigene inländische Produktion zu ersetzen, oft geschützt durch Zölle (Erziehungszölle).
Wie bewertet der Neoliberalismus Handelsbeschränkungen?
Aus neoliberaler Sicht sind Handelsbeschränkungen Hemmnisse für die Entwicklung. Freier Welthandel und Marktöffnung gelten als Schlüssel zum Wirtschaftswachstum.
Was bedeutet weltmarktliche Dissoziation?
Es bezeichnet die bewusste (teilweise) Abkoppelung einer Volkswirtschaft vom Weltmarkt, um ein eigenständiges, binnenorientiertes Wachstum zu ermöglichen.
Warum wird Taiwan als Beispiel angeführt?
Taiwan dient als empirische Fallstudie, um zu zeigen, wie ein Land durch eine Kombination aus Protektionismus und späterer Weltmarktintegration wirtschaftlich aufsteigen konnte.
Was ist der "Erziehungszoll-Gedanke"?
Dies ist die Idee, junge einheimische Industrien durch temporäre Zölle vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, bis sie international wettbewerbsfähig sind.
- Quote paper
- Jan-Henrik Petermann (Author), 2003, Dissoziation contra Einbindung: Wie viel Welthandel braucht nationale Entwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182603