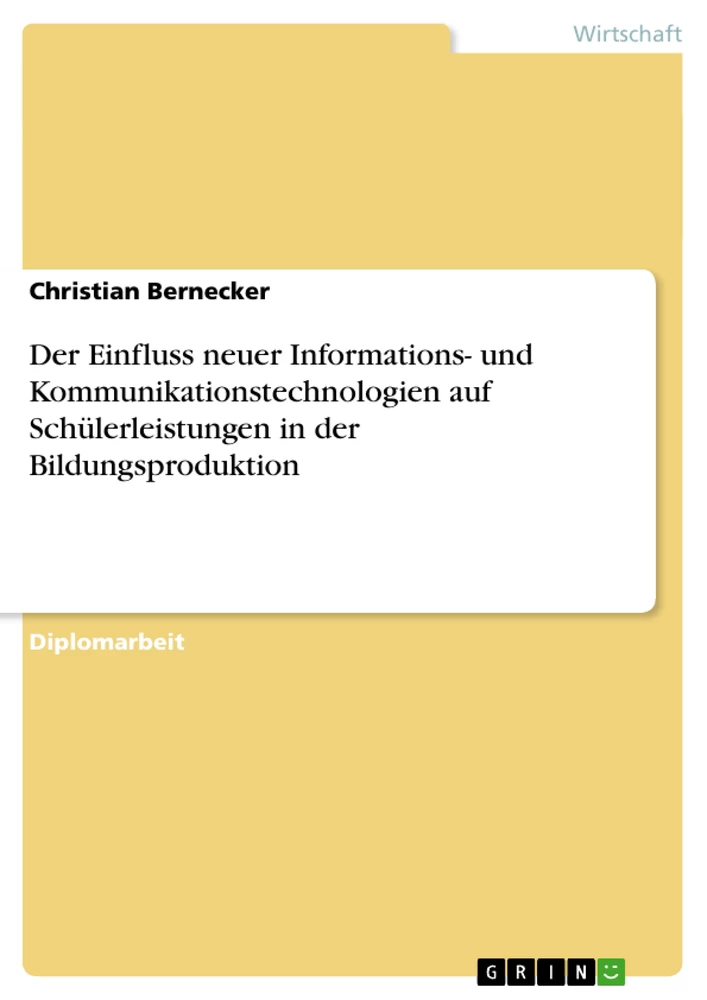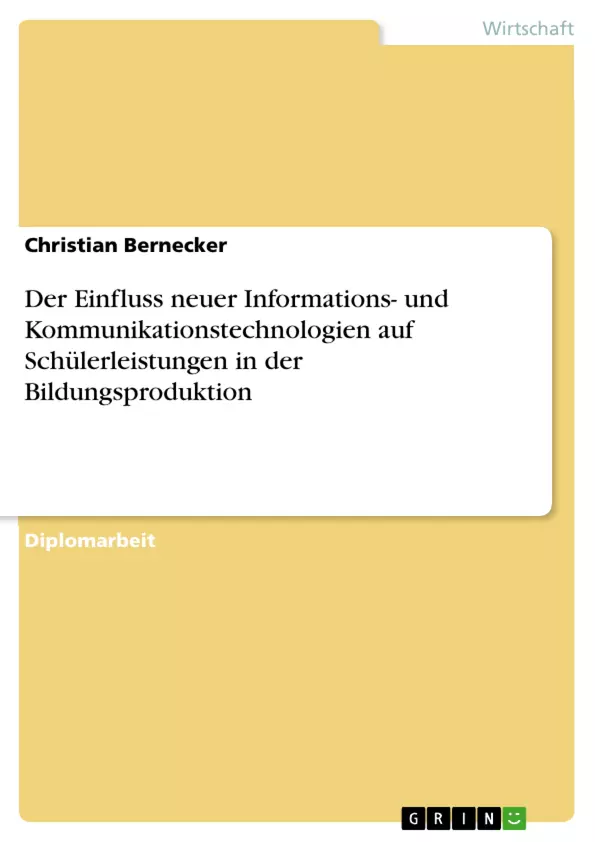Die positive Wirkung von Bildung ist seit langem empirisch bewiesen. Daher ist die Suche nach Faktoren, welche die schulische Leistung von Jugendlichen verbessern können, folgerichtig und wichtig für die Gesellschaft.
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien tatsächlich dazu beitragen können. Insbesondere die Anzahl der verfügbaren Heimcomputer und die zeitliche Erfahrung im Umgang mit einem Computer weisen eine positive Korrelation mit dem Bildungsergebnis auf. Des Weiteren wird für computergestützte Anwendungen, welche ebenfallsfür schulische Zwecke eingesetzt werden können, ein positiver Einfluss auf die Leistung von Schülern gefunden. Dagegen geht offenbar von Aktivitäten, die einen erhöhten Zeitbedarf für einen sicheren Umgang erfordern, eine negative Wirkung aus.
Der Aufbau dieser Arbeit gestaltet sich wie folgt: In Kapitel 2 wird das Konzept der Bildungsproduktionsfunktion, zusammen mit einer Erweiterung um die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Wirkungsweisen, beschrieben. Anschließend gibt Kapitel 3 einen Überblick über die Literatur, die den Einfluss der neuen Medien auf die Leistung von Schülern untersucht. Kapitel 4 stellt Hintergrundinformationen zum PISA-Test bereit und erläutert die in der Analyse verwendeten Daten, gefolgt von deskriptiven Statistiken. Kapitel 5 zeigt die Ergebnisse erster bivariaten Schätzungen. In Kapitel 6 wird das empirische Vorgehen und die sich daraus ergebenen Restriktionen der multivariaten Analyse dargestellt. Die Ergebnisse dieser finden sich in Kapitel 7, zusammen mit weiteren Detailanalysen. Kapitel 8 fasst die Resultate zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungsproduktionsfunkion
- Hintergründe
- Erweiterung um neue Informations- und Kommunikationstechnologien
- Mögliche Wirkungskanäle der Technologien
- Literaturüberblick
- Analyse bereits vorhandener Daten
- Natürliche Experimente
- Experimente
- PISA-Test und Daten
- Hintergründe zum PISA-Test
- Verwendete Daten
- Deskriptive Statistiken
- Motivation: Bivariate Evidenzen
- Identifikation möglicher Zusammenhänge
- Zwischenergebnis
- Empirisches Vorgehen
- Empirisches Modell
- Grenzen der Interpretation
- Ergebnisse der multivariaten Schätzungen
- Hauptergebnisse
- Allgemeine Computernutzung
- Nutzungsfrequenz bei ausgewählten Anwendungen
- Vertrautheit mit ausgewählten Anwendungen
- Unterschiede zwischen den Geschlechtern
- Analyse für Deutschland
- Analyse unterschiedlicher Ländergruppen
- Geographische Einteilung
- Einteilung nach technologischem Fortschritt
- Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds
- Hauptergebnisse
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) auf die Schülerleistungen in der Bildungsproduktion. Ziel ist es, die Auswirkungen der IKT-Nutzung auf die Kompetenzen von Schülern im Bereich Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zu analysieren. Die Arbeit basiert auf Daten des PISA-Tests und verwendet ein multivariates Regressionsmodell, um den Einfluss der IKT-Nutzung auf die Schülerleistungen zu untersuchen.
- Der Einfluss von IKT auf die Schülerleistungen in verschiedenen Kompetenzbereichen
- Die Rolle der IKT-Nutzung in der Bildungsproduktion
- Die Analyse von Wirkungskanälen der IKT-Nutzung auf die Schülerleistungen
- Die Untersuchung von Unterschieden in der IKT-Nutzung und deren Auswirkungen auf die Schülerleistungen zwischen verschiedenen Ländern und Geschlechtergruppen
- Die Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und erläutert die Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert die Bildungsproduktionsfunktion und erweitert diese um den Faktor IKT-Nutzung. Es werden verschiedene Wirkungskanäle der IKT-Nutzung auf die Schülerleistungen diskutiert. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die bestehende Literatur zum Thema IKT und Schülerleistungen. Es werden verschiedene Forschungsansätze und Ergebnisse vorgestellt, die auf Analysen von bereits vorhandenen Daten, natürlichen Experimenten und Experimenten basieren. Kapitel 4 beschreibt den PISA-Test und die verwendeten Daten. Es werden deskriptive Statistiken zu den Kompetenzwerten und der IKT-Nutzung der Schüler präsentiert. Kapitel 5 untersucht bivariate Zusammenhänge zwischen der IKT-Nutzung und den Schülerleistungen. Es werden erste Hinweise auf mögliche Effekte der IKT-Nutzung auf die Schülerleistungen gefunden. Kapitel 6 beschreibt das empirische Vorgehen und das verwendete multivariates Regressionsmodell. Es werden die Grenzen der Interpretation der Ergebnisse diskutiert. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der multivariaten Schätzungen. Es werden die Auswirkungen der allgemeinen Computernutzung, der Nutzungsfrequenz bei ausgewählten Anwendungen und der Vertrautheit mit ausgewählten Anwendungen auf die Schülerleistungen untersucht. Es werden auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen Deutschland und anderen Ländern sowie zwischen verschiedenen Ländergruppen analysiert. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen für die Bildungspolitik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) auf die Schülerleistungen in der Bildungsproduktion, die Analyse von Wirkungskanälen der IKT-Nutzung, die Untersuchung von Unterschieden in der IKT-Nutzung und deren Auswirkungen auf die Schülerleistungen zwischen verschiedenen Ländern und Geschlechtergruppen, die Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds der Schüler sowie die Implikationen für die Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Heimcomputer die Schulleistungen von Jugendlichen?
Die Studie zeigt eine positive Korrelation zwischen der Anzahl verfügbarer Heimcomputer sowie der zeitlichen Erfahrung im Umgang mit dem PC und den Bildungsergebnissen.
Gibt es auch negative Auswirkungen der Computernutzung?
Ja, Aktivitäten, die einen sehr hohen Zeitbedarf für den sicheren Umgang erfordern (oft Freizeitaktivitäten), können offenbar eine negative Wirkung auf die schulische Leistung haben.
Welche Datenbasis wurde für die Untersuchung genutzt?
Die Analyse basiert auf den Daten des PISA-Tests, wobei Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften im Fokus stehen.
Spielt der sozioökonomische Hintergrund eine Rolle?
Ja, die Arbeit berücksichtigt den sozioökonomischen Hintergrund der Schüler in der multivariaten Analyse, um den reinen Effekt der IKT-Nutzung besser isolieren zu können.
Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der IKT-Wirkung?
Die Arbeit führt Detailanalysen durch, die unter anderem Unterschiede in der Nutzungsfrequenz und deren Auswirkungen zwischen Jungen und Mädchen untersuchen.
- Arbeit zitieren
- Christian Bernecker (Autor:in), 2010, Der Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien auf Schülerleistungen in der Bildungsproduktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182610