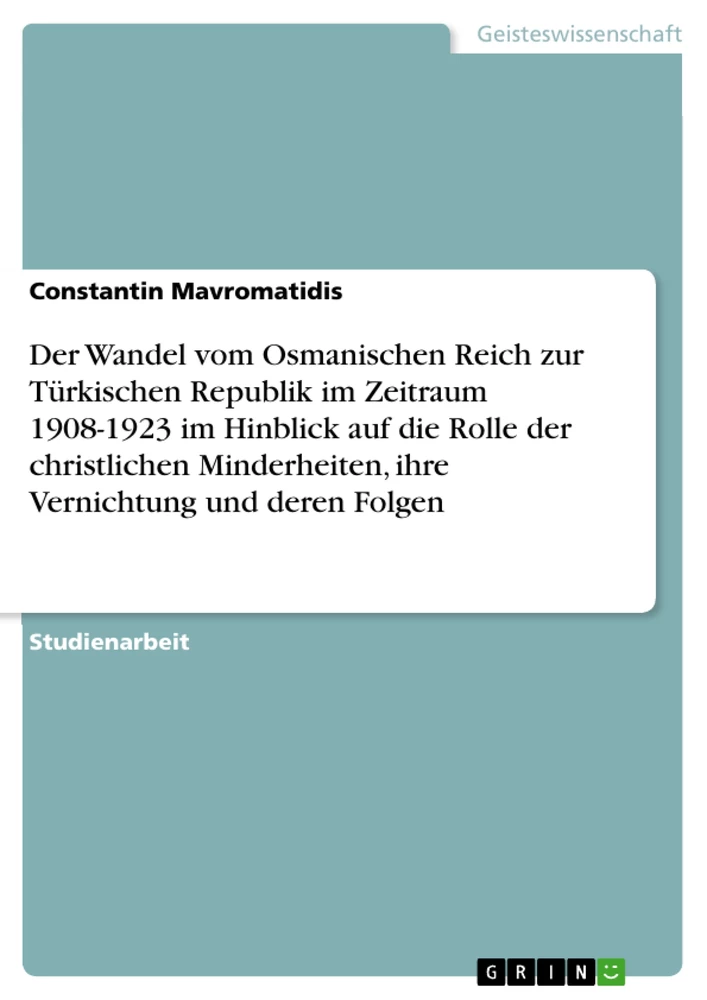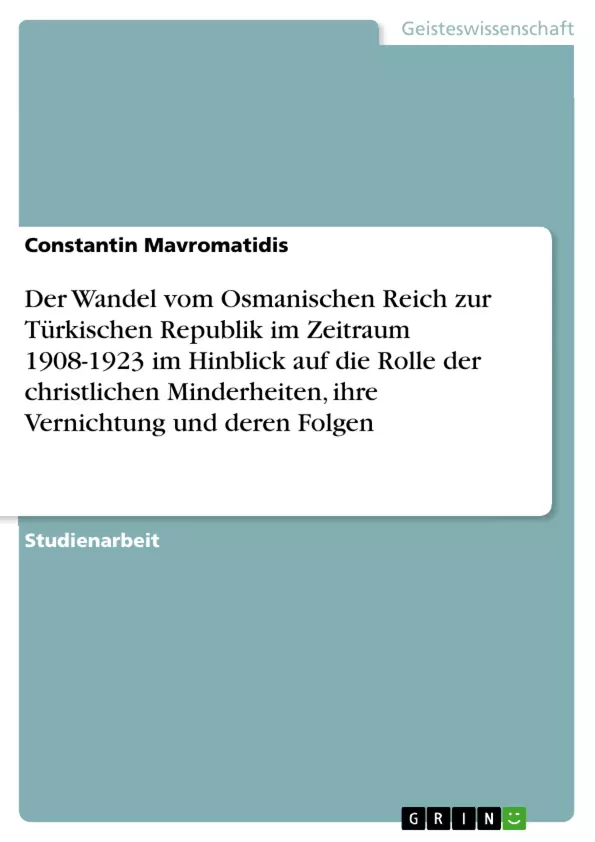1. Einleitung
1.1. Aktuelle Debatte und Situation
„Auf uns werden keine Waffen mehr gerichtet, in einer Millionenmetropole sind wir nicht einmal mehr eine Minderheit“ , stellt Mihail Vasiliadis, Herausgeber und Chefredakteur der „Apoyevmatini“, der in Istanbul erscheinenden griechischsprachigen Tageszeitung, gegenüber der Journalistin Federica Matteoni resignierend fest.
Der demographische Rückgang der christlichen Minderheiten ist ein Phänomen, welches sich auf unterschiedliche Faktoren zurückführen lässt. Es sind nicht nur die aus christlicher Sicht verhängnisvollen historischen Ereignisse der vergangenen einhundert Jahre, sondern auch die bis zum heutigen Tage anhaltenden restriktiven Gesetzesanwendungen der türkischen Regierungen, die sie zu Bürger zweiter Klasse degradieren. Deutlich wird das unter anderem dadurch, das die türkische Rechtsprechung „ […] die Voraussetzung für eine weitgehende Enteignung der nichtmuslimischen Minderheiten geschaffen […]“ hat, wie es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 14.12. 2001 zu lesen war.
Seit dem Jahr 1936 dürfen Minderheiten in der Türkei, weder Vermögen erwerben noch als Schenkung oder Erbschaft annehmen dürfen. Wie es oft bei Erbschaften und Schenkungen der Fall ist, sind keine Rechtsnachfolger der ehemaligen Eigentümer vorhanden. Somit fällt also das Vermögen an den türkischen Staat. Dem sogenannten Stiftungsgesetz aus dem Jahre 1926 und 1935 entsprechend, sind allein in den letzten Jahren 39 Immobilien der armenischen Gemeinde so dem türkischen Staat zugefallen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktuelle Debatte und Situation
- Ziel und Vorgehensweise der Arbeit
- Die Stellung der Nichtmuslime im islamischen Recht
- Kurzer historischer Rückblick
- Der Niedergang des Osmanischen Reiches
- Tanzimatreformen
- Die Entwicklung unter Sultan Abdülhamid
- Die Jungtürken
- Entstehung und Ziele der Bewegung
- Von der sogenannten Revolution zur Diktatur
- Versuch der Errichtung eines Nationalstaates
- Armenier und Griechen
- Türkismus, Pläne und erste Schritte zur Homogenisierung des Reiches
- Erster Weltkrieg und planmäßige Vernichtung der Christen
- Das Ende des Osmanischen Reiches
- Osmanische Niederlage und Teilungspläne der Siegerstaaten
- Atatürk und die „Nationalbewegung“
- Griechisch-Türkischer Krieg
- Das Ende des Krieges, der Lausanner Friedensvertrag und die Ausrufung der Republik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik zwischen 1908 und 1923, mit besonderem Fokus auf die Rolle und das Schicksal christlicher Minderheiten. Es wird der Frage nachgegangen, wie diese Minderheiten durch historische Ereignisse und politische Maßnahmen betroffen waren und welche langfristigen Folgen dies hatte.
- Der Niedergang des Osmanischen Reiches und die Rolle der Minderheiten
- Die Auswirkungen der Jungtürkischen Revolution auf christliche Gemeinschaften
- Die systematische Unterdrückung und Vernichtung christlicher Minderheiten
- Die politische und wirtschaftliche Marginalisierung nach der Staatsgründung
- Der Einfluss der Minderheitenfrage auf die Gestaltung der Türkischen Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die aktuelle Situation der christlichen Minderheiten in der Türkei und skizziert die Ziele der Arbeit. Es folgt eine Darstellung der Stellung der Nichtmuslime im islamischen Recht. Der historische Rückblick behandelt den Niedergang des Osmanischen Reiches, die Tanzimat-Reformen und die Herrschaft Abdülhamids II. Die Kapitel über die Jungtürken beleuchten deren Entstehung, Ziele und die Entwicklung zur Diktatur. Der Versuch der Errichtung eines Nationalstaates wird unter Berücksichtigung der Lage von Armeniern und Griechen und der Politik des Türkismus dargestellt. Der Erste Weltkrieg und die systematische Vernichtung der Christen werden thematisiert. Abschließend wird der Prozess der osmanischen Niederlage, die Rolle Atatürks und der griechisch-türkische Krieg betrachtet.
Schlüsselwörter
Osmanisches Reich, Türkische Republik, Christliche Minderheiten, Armenier, Griechen, Jungtürken, Nationalismus, Genozid, Tanzimat, Atatürk, Lausanner Vertrag, Minderheitenrechte, Vermögenssteuer, Paragraf 301, ethnische Homogenisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Status hatten Christen im Osmanischen Reich?
Christen galten im islamischen Recht als "Dhimmi" (Schutzbefohlene). Sie hatten zwar eine gewisse Religionsfreiheit, waren aber rechtlich gegenüber Muslimen benachteiligt.
Was war das Ziel der Jungtürken-Bewegung?
Ursprünglich strebten sie eine Modernisierung und Konstitutionalisierung an, entwickelten sich aber hin zu einem radikalen Nationalismus und einer Diktatur.
Was passierte mit dem Vermögen christlicher Minderheiten?
Durch Gesetze wie das Stiftungsgesetz von 1936 wurde die Enteignung vorangetrieben; Minderheiten durften oft kein Vermögen mehr erben oder erwerben.
Welche Rolle spielt der Lausanner Friedensvertrag?
Der Vertrag von 1923 legte die Grenzen der modernen Türkei fest und beinhaltete unter anderem den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei.
Was bedeutet der Begriff "Türkismus" in diesem Kontext?
Es bezeichnet die Ideologie zur Schaffung eines ethnisch homogenen türkischen Nationalstaates, was zur systematischen Unterdrückung von Minderheiten führte.
Werden die Massaker an den Armeniern in der Arbeit behandelt?
Ja, die Arbeit thematisiert die planmäßige Vernichtung der Christen während des Ersten Weltkriegs als Teil der Homogenisierungspläne.
- Quote paper
- Constantin Mavromatidis (Author), 2011, Der Wandel vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik im Zeitraum 1908-1923 im Hinblick auf die Rolle der christlichen Minderheiten, ihre Vernichtung und deren Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182684