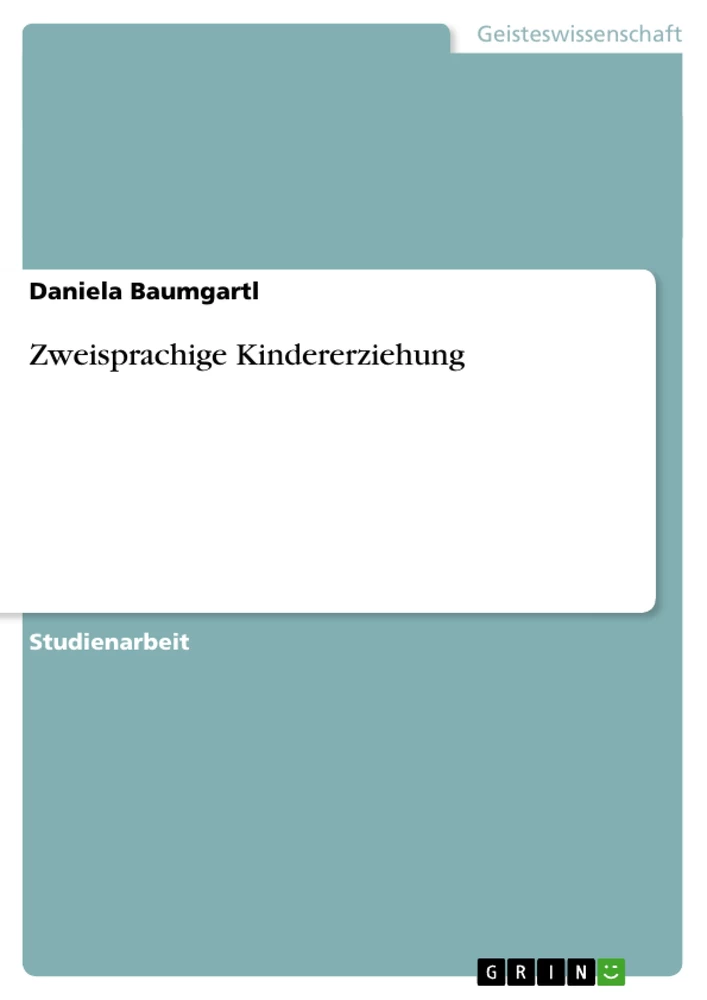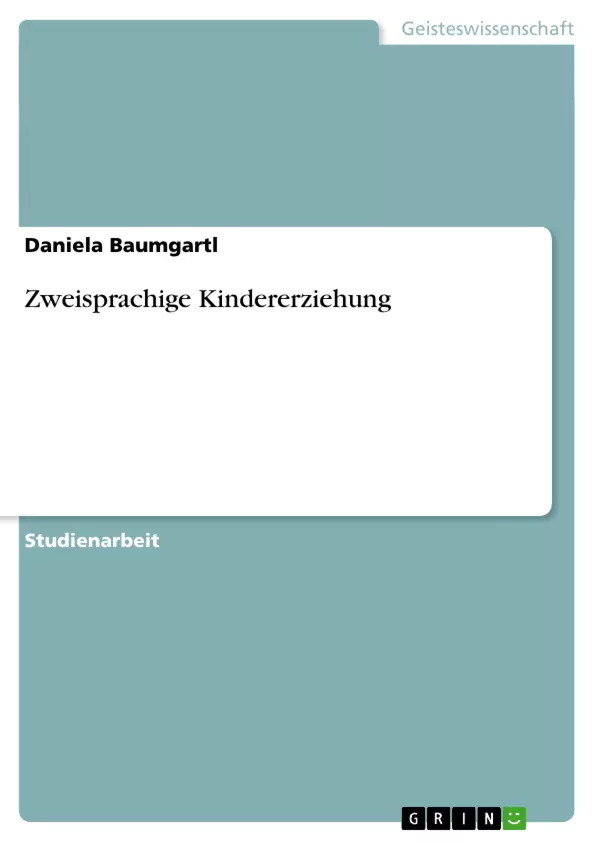Während meines Praktikums in der deutsch - französischen „Kinder - Ecole“ habe ich mich eingehend mit dem Thema „Zweisprachige Erziehung von Kindern“ beschäftigt, da dieser Bereich durch Anregungen und Beobachtungen aus der Praxis bei mir ein besonderes Interesse auslöste. Ich hatte die Möglichkeit, die Kinder in Alltagssituationen und dabei im Umgang mit ihren zwei Sprachen zu erleben.
Zunächst werde ich definieren, was es eigentlich bedeutet, zweisprachig zu sein.
Anschließend gehe ich dann auf die Verwirklichung von Zweisprachigkeit in der Kindeserziehung ein. Am Ende des Berichtes stelle ich eine eigens durchgeführte Fallstudie dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zweisprachige Erziehung
- Definition von Zweisprachigkeit
- Urteile und Vorurteile über Zweisprachigkeit
- Die kindliche Sprachentwicklung
- Lernen zweisprachige Kinder anders sprechen?
- Zweisprachige Erziehung eines Kindes bei Trennung der Eltern
- Wege zur Zweisprachigkeit
- Schwache Sprache - starke Sprache
- Eine Person - eine Sprache (Partnerprinzip)
- Ausnahmen des Partnerprinzips
- Familiensprache - Umgebungssprache
- In einer Fremdsprache erziehen
- Mehrere Sprachen sprechen, mehrere Kulturen leben
- Interkulturelle Erziehung - Interkulturelles Lernen
- Störungen in den Sprachen
- Sprachmischungen und Interferenzen
- Sprachverweigerung
- Stottern
- Eigens durchgeführte Fallstudie zu der unterschiedlichen Entwicklung zweier Kinder, die zweisprachig aufwachsen (Sprachberg)
- Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Zweisprachige Kindererziehung“ befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit in der Kindheit und untersucht die Vorteile und Herausforderungen der zweisprachigen Erziehung. Die Autorin analysiert die verschiedenen Definitionen von Zweisprachigkeit, beleuchtet Urteile und Vorurteile gegenüber zweisprachigen Kindern und erforscht die verschiedenen Wege, die zu Zweisprachigkeit führen können.
- Definition und Merkmale von Zweisprachigkeit
- Vor- und Nachteile der zweisprachigen Erziehung
- Verschiedene Ansätze und Methoden zur Förderung von Zweisprachigkeit
- Interkulturelle Aspekte der Mehrsprachigkeit
- Mögliche Sprachstörungen bei zweisprachigen Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den Kontext des Themas „Zweisprachige Kindererziehung“ vor und erläutert die Motivation der Autorin für die Erstellung dieser Arbeit. In Kapitel 2 werden verschiedene Definitionen von Zweisprachigkeit vorgestellt und diskutiert, gefolgt von einer Analyse von Urteilen und Vorurteilen, die mit dem zweisprachigen Aufwachsen verbunden sind. Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Wege zur Erlangung von Zweisprachigkeit, wie das Partnerprinzip und die Verwendung unterschiedlicher Sprachen im Familien- und Umfeldkontext. Kapitel 4 beleuchtet die Verbindung von Sprache und Kultur und die Bedeutung der interkulturellen Erziehung. In Kapitel 5 werden mögliche Sprachstörungen bei zweisprachigen Kindern, wie Sprachmischungen, Sprachverweigerung und Stottern, beschrieben. Kapitel 6 präsentiert eine eigene Fallstudie zu der Entwicklung zweier zweisprachig aufwachsender Kinder. Das Resumée fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, Kindererziehung, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklung, Partnerprinzip, Interkulturelle Erziehung, Sprachstörungen, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet es, zweisprachig zu sein?
Zweisprachigkeit beschreibt die Fähigkeit, zwei Sprachen im Alltag so zu verwenden, dass eine Kommunikation in beiden Sprachen möglich ist, wobei die Kompetenzstufen variieren können.
Was ist das „Partnerprinzip“ in der zweisprachigen Erziehung?
Das Prinzip „Eine Person – eine Sprache“ besagt, dass jeder Elternteil konsequent nur eine bestimmte Sprache mit dem Kind spricht, um Vermischungen zu vermeiden.
Lernen zweisprachige Kinder anders sprechen?
Die kindliche Sprachentwicklung folgt ähnlichen Mustern wie bei einsprachigen Kindern, kann aber Phasen der Sprachmischung oder kurzzeitige Verzögerungen aufweisen.
Welche Störungen können bei zweisprachigen Kindern auftreten?
Mögliche Probleme sind Sprachmischungen (Interferenzen), zeitweilige Sprachverweigerung oder in seltenen Fällen Stottern, wobei diese oft vorübergehend sind.
Was ist der Unterschied zwischen Familiensprache und Umgebungssprache?
Die Familiensprache ist die zu Hause gesprochene Sprache, während die Umgebungssprache die Sprache der Gesellschaft (Schule, Freunde, Medien) ist.
Fördert Zweisprachigkeit das interkulturelle Lernen?
Ja, durch das Sprechen mehrerer Sprachen leben Kinder oft auch in mehreren Kulturen, was ihre interkulturelle Kompetenz und Toleranz stärkt.
- Citation du texte
- Daniela Baumgartl (Auteur), 2003, Zweisprachige Kindererziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18273