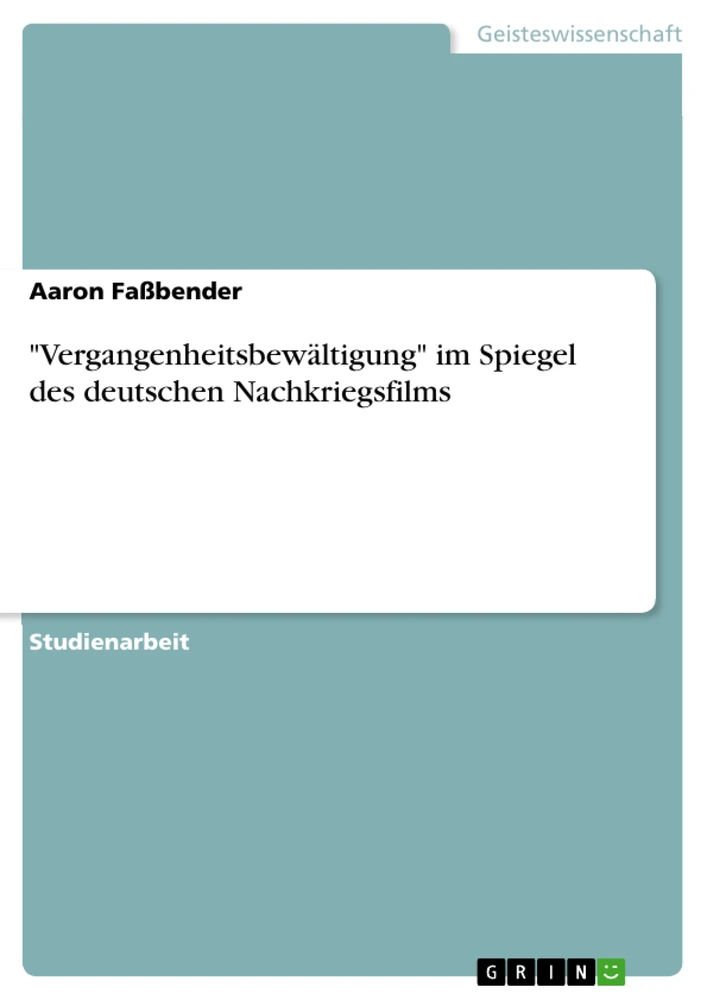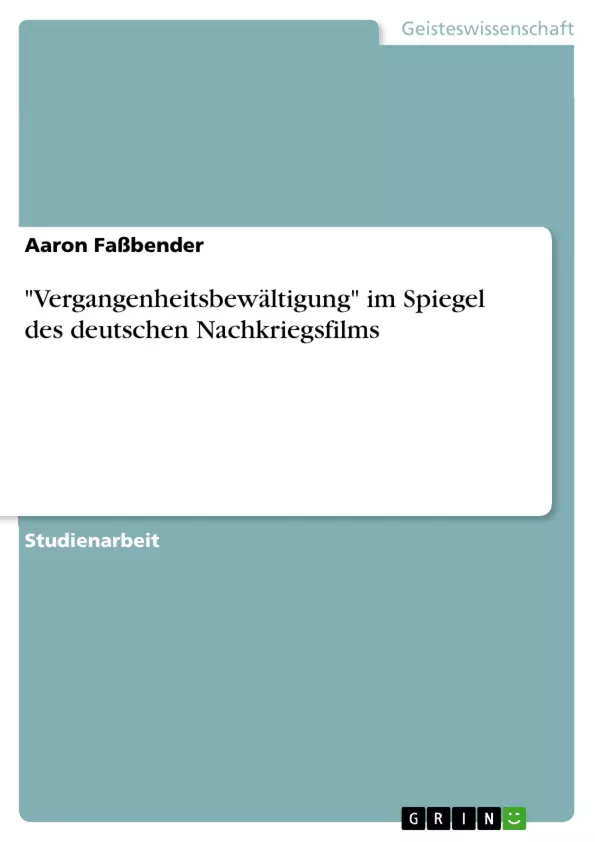Mit 817,5 Millionen Kinobesuchern – allein in den westdeutschen Lichtspielhäusern – erreichte das Kino 1956 so viele Zuschauer wie nie zuvor. Angesichts dieser enormen Anziehungskraft, drängt sich die Frage auf wie der deutsche Film der Nachkriegszeit den Nationalsozialismus aufarbeitete und seine politischen und gesellschaftlichen Folgen bewertete. Der Film verkörpert dabei, sofern er sich denn mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, das gesellschaftliche Produkt der Vergangenheitsbewältigung; gleichzeitig nahm er jedoch seinerseits wieder Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Um die Funktion des Films bei der Aufarbeitung systembedingten Unrechts zu analysieren wird sich die vorliegende Arbeit vor allem auf die westdeutsche Nachkriegszeit konzentrieren, um die gewonnenen Erkenntnisse anschließend mit den Entwicklungen der Sowjetischen Besatzungszone, bzw. der DDR zu vergleichen. Zu diesem Zweck werden zunächst die Rahmenbedingungen des Wiederaufbaus der Filmindustrien in den Besatzungszonen und den beiden deutschen Staaten betrachtet werden. Thematisiert werden hierbei unter anderem die unterschiedlichen Interessen, die der Medienpolitik der Militärregierungen zugrunde lagen und deren Auswirkung auf die deutsche Kinematografie.
Der Erläuterung des Hintergrundes folgt die Vorstellung der ersten Gehversuche des Nachkriegsfilms, des so genannten "Trümmerfilms", seiner Besonderheiten und seinen wichtigsten Repräsentanten. Dem folgt die sozialethische Analyse, der Filmwelt der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Besonderes Augenmerk wird herbei auf die cineastische Aufarbeitung des Nationalsozialistischen Vergangenheit und seinen Folgen gelegt. Während sich der Betrachtung der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im bundesrepublikanischen Kino, ein Exkurs über die Darstellung von Vertriebenen und Kriegsgefangenen anschließt, bietet sich Betrachtung für die DDR-Produktionen nicht an. Im Gegensatz zu der Bundesrepublik, die die Aufnahme von Millionen Flüchtlingen, Kriegsgefangenen und Vertriebenen meistern musste, verließen die Menschen der SBZ/DDR ihre Heimat scharenweise. Da die Darstellung der Flucht in den Westen einem politischen Offenbarungseid gleichgekommen wäre, wurde dieses Thema in den staatlichen Filmproduktionen tabuisiert. Ähnlich verhielt es sich mit den Kriegsgefangenen, da eine öffentliche Diskussion dieser Problematik zwangsläufig eine Konfrontation mit dem sozialistischen Bruderstaat provozieren musste. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Untersuchungsgegenstand und Vorgehensweise
- 1.2 Verwendete Literatur und Forschungsstand
- 2. Alliierte Medienpolitik nach 1945
- 2.1 Alliierte Medienpolitik in den westlichen Besatzungszonen
- 2.2 Die Medienpolitik in der Sowjetischen Besatzungszone: Der Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie
- 2.3 Der Wiederaufbau der westdeutschen Filmindustrie
- 2.4 Trümmerfilme
- 3. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Kinematografie West- und Ostdeutschlands
- 3.1 Die westdeutsche Filmindustrie nach Gründung der Bundesrepublik
- 3.2 Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit im westdeutschen Film
- 3.3 Von Vertriebenen und Kriegsgefangenen – die Aufarbeitung der Kriegsfolgen im jungen bundesdeutschen Film
- 3.4 Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit im ostdeutschen Film
- 3.5 Der Aufbaufilm der DDR
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die sozialethische Funktion des deutschen Nachkriegsfilms im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Sie untersucht, wie der Film die Vergangenheitsbewältigung widerspiegelte und gleichzeitig beeinflusste. Der Fokus liegt auf der westdeutschen Filmindustrie, wobei Vergleiche mit der Entwicklung in der DDR gezogen werden.
- Die alliierte Medienpolitik nach 1945 und ihr Einfluss auf den Wiederaufbau der Filmindustrie.
- Die Darstellung des Nationalsozialismus und seiner Folgen im west- und ostdeutschen Film.
- Die Rolle des Trümmerfilms in der frühen Nachkriegszeit.
- Der Vergleich der Vergangenheitsbewältigung im westdeutschen und ostdeutschen Film.
- Die sozialethische Analyse der Filmproduktion beider deutscher Staaten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Vergangenheitsbewältigung ein und erläutert die Bedeutung der Auseinandersetzung mit systembedingtem Unrecht. Sie begründet die Wahl des deutschen Nachkriegsfilms als Untersuchungsgegenstand und skizziert die Methodik der Arbeit, die sich auf eine sozialethische Analyse konzentriert und die westdeutsche Entwicklung im Vergleich zur DDR beleuchtet. Besonders wird die immense Popularität des Kinos in der Nachkriegszeit hervorgehoben und dessen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Die Arbeit definiert "Vergangenheitsbewältigung" nicht als bloße Bewältigung, sondern als theoretische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
2. Alliierte Medienpolitik nach 1945: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Medienpolitiken der Alliierten in den westlichen und der sowjetischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg. Es analysiert die jeweiligen Interessen der Besatzungsmächte und deren Auswirkungen auf den Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen und Zielen der Alliierten in Bezug auf die Kontrolle und Gestaltung der Medienlandschaft und deren Folgen für die Entwicklung des deutschen Films. Das Kapitel beleuchtet den Wiederaufbau der Filmindustrien in beiden Zonen und beschreibt die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen.
3. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Kinematografie West- und Ostdeutschlands: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung der nationalsozialistischen Vergangenheit und ihrer Folgen im west- und ostdeutschen Film. Es untersucht die unterschiedlichen Herangehensweisen und Strategien in beiden deutschen Staaten und vergleicht die Art und Weise, wie mit der NS-Vergangenheit umgegangen wurde. Die Analyse beinhaltet die westdeutsche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die Darstellung von Vertriebenen und Kriegsgefangenen im bundesdeutschen Film sowie die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und den Aufbaufilm in der DDR. Die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die filmische Darstellung werden hierbei eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Vergangenheitsbewältigung, deutscher Nachkriegsfilm, Medienpolitik, Nationalsozialismus, Trümmerfilm, Aufbaufilm, DDR, Bundesrepublik, sozialethische Analyse, Westdeutschland, Ostdeutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen Nachkriegsfilm und der Vergangenheitsbewältigung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sozialethische Funktion des deutschen Nachkriegsfilms im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Der Fokus liegt auf der westdeutschen Filmindustrie, wobei Vergleiche mit der Entwicklung in der DDR gezogen werden. Die Arbeit untersucht, wie der Film die Vergangenheitsbewältigung widerspiegelte und gleichzeitig beeinflusste.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die alliierte Medienpolitik nach 1945 und deren Einfluss auf den Wiederaufbau der Filmindustrie in West- und Ostdeutschland. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Nationalsozialismus und seiner Folgen im west- und ostdeutschen Film, inklusive der Rolle des Trümmerfilms. Verglichen werden die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Vergangenheitsbewältigung in beiden deutschen Staaten, mit einer eingehenden sozialenthischen Analyse der Filmproduktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur alliierten Medienpolitik nach 1945, ein Kapitel zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Film beider deutscher Staaten und einen Schluss. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Methodik. Das Kapitel zur Medienpolitik analysiert die unterschiedlichen Politiken in West und Ost. Das dritte Kapitel vergleicht die Darstellung der NS-Vergangenheit und ihrer Folgen im Film beider deutscher Staaten.
Welche Rolle spielt der Trümmerfilm?
Der Trümmerfilm wird als wichtiger Bestandteil der frühen Nachkriegszeit behandelt und seine Rolle in der Auseinandersetzung mit den Folgen des Krieges und des Nationalsozialismus analysiert.
Wie wird die Vergangenheitsbewältigung im West- und Ostdeutschen Film verglichen?
Die Arbeit vergleicht die unterschiedlichen Strategien und Herangehensweisen an die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im west- und ostdeutschen Film, unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Was ist die sozialethische Perspektive der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den deutschen Nachkriegsfilm aus einer sozialenthischen Perspektive, indem sie die moralischen und ethischen Implikationen der filmischen Darstellung der NS-Vergangenheit und ihrer Folgen untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vergangenheitsbewältigung, deutscher Nachkriegsfilm, Medienpolitik, Nationalsozialismus, Trümmerfilm, Aufbaufilm, DDR, Bundesrepublik, sozialethische Analyse, Westdeutschland, Ostdeutschland.
Wie wird "Vergangenheitsbewältigung" in der Arbeit definiert?
„Vergangenheitsbewältigung“ wird nicht als bloße Bewältigung verstanden, sondern als theoretische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Welche Bedeutung hatte das Kino in der Nachkriegszeit?
Die immense Popularität des Kinos in der Nachkriegszeit und dessen Einfluss auf die öffentliche Meinung wird hervorgehoben.
- Quote paper
- M. A. Aaron Faßbender (Author), 2006, "Vergangenheitsbewältigung" im Spiegel des deutschen Nachkriegsfilms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182753