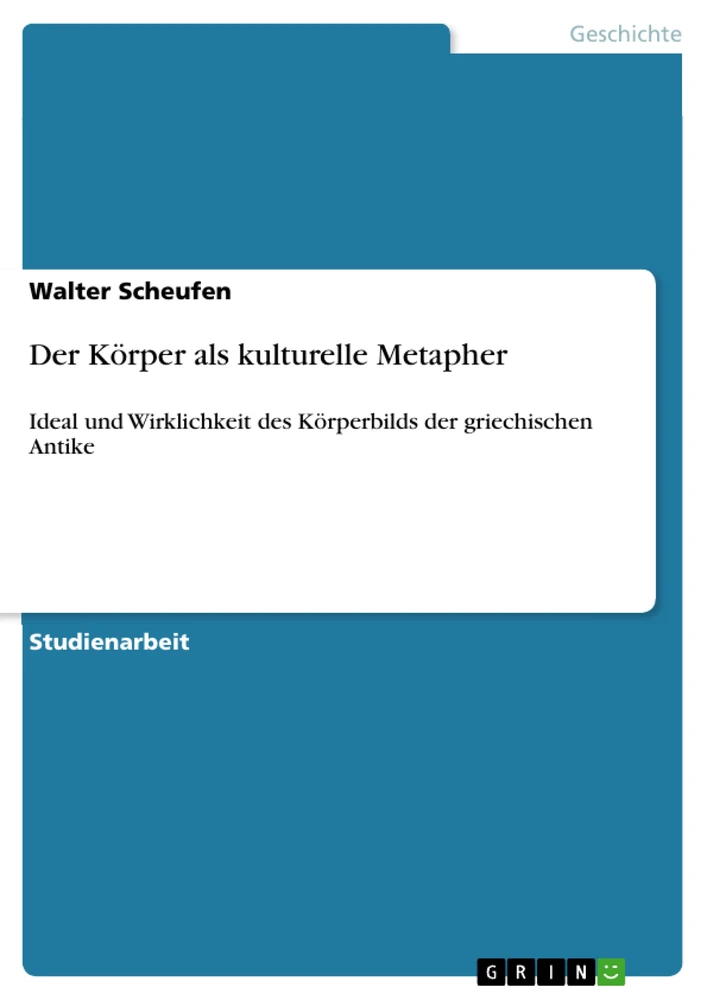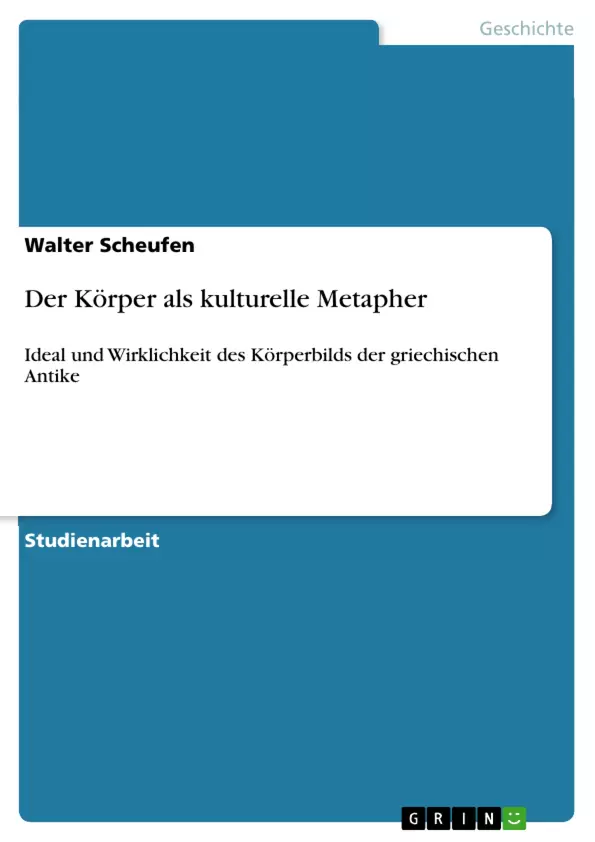Unser heutiges Verhältnis zur körperlichen Selbstempfindung wird maßgebend durch eine medial konstruierte Vorstellung von Schönheit, Makellosigkeit und körperlichen Leitungsvermögen bestimmt. Dieses gesellschaftlich tradierte Bild der physischer Vollkommenheit und Virilität, das aus der modernen Bildbearbeitungskultur entstanden ist – jederzeit löschbar und variabel – entstammt ursprünglich, in all seiner Widersprüchlichkeit, der griechischen Kultur der Antike. Damals wie heute war das gesellschaftliche Verhältnis zur Körperlichkeit von einer ethischen Schizophrenie geprägt. Man wollte erfolgreiche Sportler bejubeln, aber gleichzeitig auch den sittlich moralischen Menschen, dessen Sein durch Körper und Geist gleichermaßen in Balance gehalten wird (Aristoteles). Diese Ansicht des Aristoteles ist gleichzeitig auch die Ausgangsproblematik, der sich diese Arbeit vorrangig widmet; Denn es besteht die Notwendigkeit, diese Balance und Vollständigkeit des Individuums in Bezug auf den Zustand einer (antiken) Gesellschaft – oder globaler den Zeitgeist – zu hinterfragen: „Lässt sich ein kausaler Zusammenhang aus der Erosion ethischer Werte – hier in Bezug auf den Umgang mit dem Körper – und dem Niedergang einer Kultur ableiten?“
Die nachfolgenden Ausführungen sollen die Aktualität und Notwendigkeit einer antiken Körpergeschichte aufzeigen. Die Wahrnehmung, Funktion und Beurteilung von Körpern werden dabei von der Philosophie (Ethik), Kunst und Medizin, aber vor allem dem kulturellen Code einer Gesellschaft bestimmt, die damit auch über die „Qualität“ eines Körpers und seinen Wert für die Gesellschaft befindet; man denke an die Entwicklung bezüglich der Wertschätzung und Integration beeinträchtigter Menschen in unserer Gesellschaft.
Im Hauptteil der Arbeit wird zunächst die Grundlage für die Entstehung und Abwandlung, einer idealen Körpervorstellung als ein Ergebnis der Einflussfaktoren der antiken Mythologie, genauer des Agon, erläutert (Kap. 2). Mit Goethe und der durch die Romantik tradierten Bildern makelloser Körper der griechischen Antik, wird auch die Verklärung und der fehlende Realitätsbezug, des in den Medien vermittelten Körperbildes deutlich.
Fazit: Den makellosen, perfekten Körper, ein Klischee, dass die Historie romantisch verklärt hat, hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Das Verschwinden der griechischen Kultur, ja ihre Errosion, steht nachweislich in enger Verbindung mit einer veränderten Körperkultur, die sich selbst entfremdet hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Natur des Agon und seine Bedeutung für die griechische Gesellschaft
- 2.1 Arete als Körper in Aktion
- 2.1.1 Kalokagathia als Schlüssel zum vollkommenen Menschen
- 2.2 Nacktheit und die Frage nach dem idealen Körperbau
- 2.3 Das Gymnasium - die elitäre Verschmelzung von Körper und Staat
- 3 Der professionelle Athlet und die Mutation des idealen Körpers
- 3.1 Siegreiche Athleten - Körperkult und Selbstinszenierung
- 3.2 Die Anatomie des Schönen in der Bildhauerei
- 4 Die Konstruktion des klassischen Schönheitsideals bei Winckelmann
- 5 Fazit/Ausblick
- 6 Anhang
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Körperbildes in der griechischen Antike und analysiert, wie der Körper als kulturelle Metapher eingesetzt wurde. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Agon und des idealen Körpers in der griechischen Gesellschaft, die Entwicklung des professionellen Athleten und die Entstehung eines neuen Körperkults. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle der Kunst in der Konstruktion des klassischen Schönheitsideals.
- Der Körper als kulturelle Metapher in der griechischen Antike
- Die Bedeutung des Agon und der Arete für die griechische Gesellschaft
- Die Entwicklung des idealen Körpers vom göttlichen Ideal zum individuellen Leistungsträger
- Die Rolle der Kunst in der Konstruktion des klassischen Schönheitsideals
- Die Transformation des Körpers in der griechischen Kultur vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zur Epoche des Hellenismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Diese Einleitung präsentiert die Ausgangsproblematik der Arbeit und setzt den Körper als Gegenstand der Untersuchung in den Kontext einer durch mediale Schönheitsideale geprägten Gesellschaft.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Agon und der Arete für die griechische Gesellschaft. Es analysiert die Konzepte der Kalokagathia und der Nacktheit als kulturelle Metaphern.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des professionellen Athleten und die Mutation des idealen Körpers. Es analysiert die Rolle des Körperkults und die veränderte Rolle des Körpers in der Kunst.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die Konstruktion des klassischen Schönheitsideals bei Winckelmann und die Entstehung eines idealisierten Bildes der griechischen Kultur.
Schlüsselwörter
Körper, Kultur, Metapher, Griechische Antike, Agon, Arete, Kalokagathia, Ideal, Nacktheit, Gymnasium, Athlet, Körperkult, Kunst, Schönheitsideal, Winckelmann, Hellenismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit über den Körper als kulturelle Metapher?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Körperbildes in der griechischen Antike und analysiert, wie der Körper als kulturelle Metapher für gesellschaftliche Werte und den Zustand einer Kultur dient.
Welche Rolle spielt der Begriff "Agon" in der griechischen Gesellschaft?
Der Agon (Wettkampf) war ein zentraler Einflussfaktor für die Entstehung des idealen Körperbildes und prägte das Verständnis von Leistung und gesellschaftlichem Wert.
Was bedeutet "Kalokagathia" im antiken Kontext?
Kalokagathia bezeichnet das Ideal des vollkommenen Menschen, bei dem körperliche Schönheit und ethische Tugend (Geist und Körper) in einer harmonischen Balance stehen.
Gab es den historisch "perfekten" Körper wirklich?
Nein, die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der makellose, perfekte Körper ein Klischee der romantischen Verklärung ist, das es in der Realität so nie gegeben hat.
Wie hängen der Niedergang einer Kultur und die Körperkultur zusammen?
Die Arbeit hinterfragt, ob die Erosion ethischer Werte im Umgang mit dem Körper – eine Entfremdung der Körperkultur – in kausalem Zusammenhang mit dem Niedergang der griechischen Kultur steht.
- Quote paper
- Walter Scheufen (Author), 2011, Der Körper als kulturelle Metapher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182807