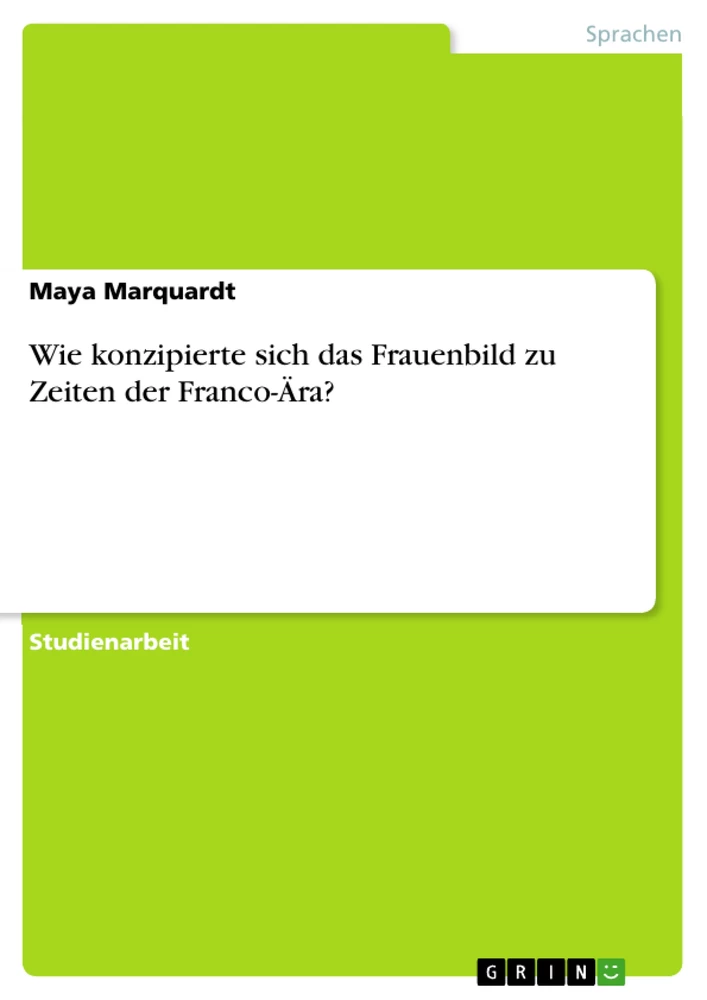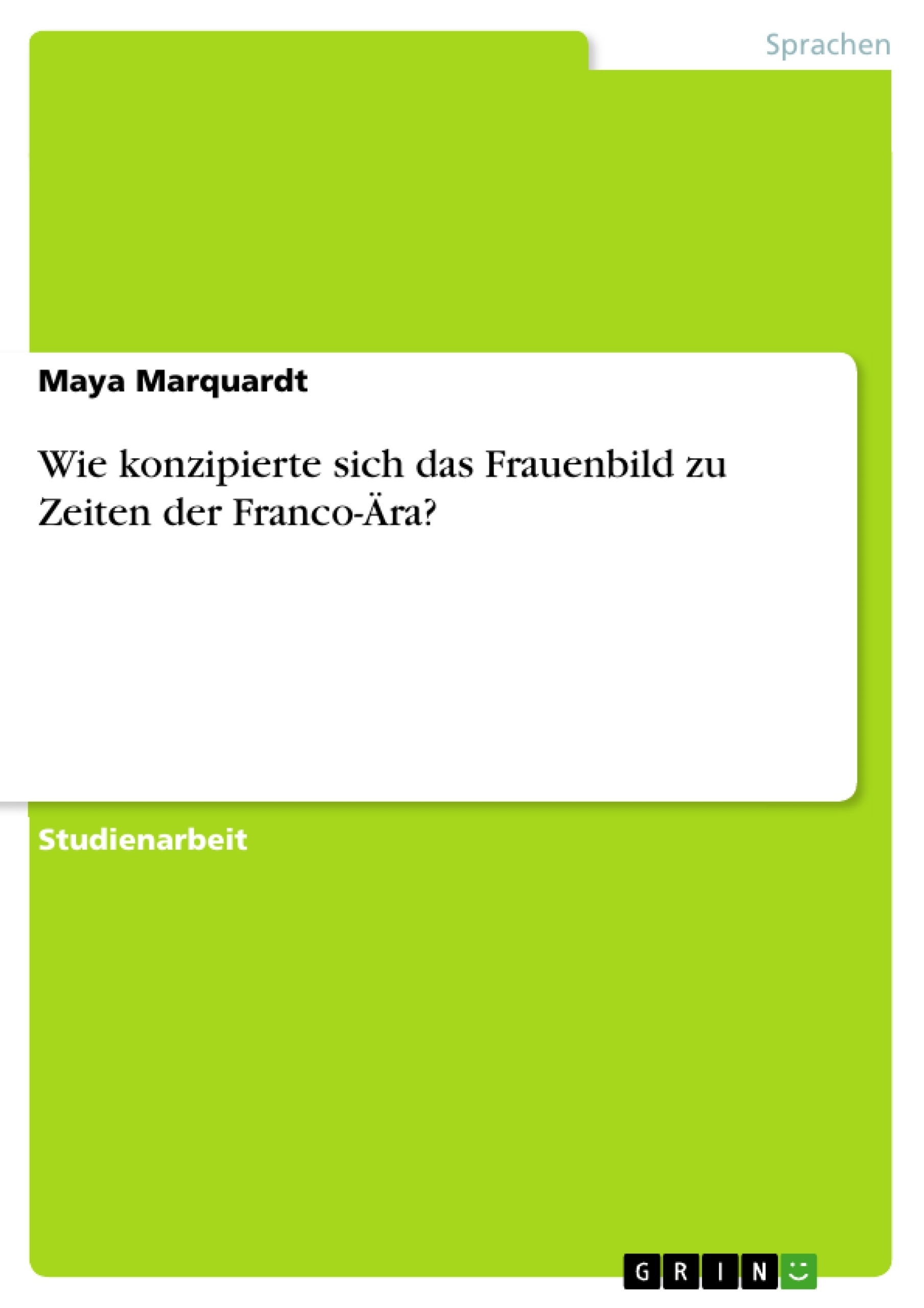Nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges 1939 und somit dem Sieg der Nationalisten über die Liberalisten, begann in Spanien die bis 1975 andauernde Franco- Ära, eine „Phase der Regression“ , die Spaniens Geschichte nachhaltig prägte. Die Errungenschaften der zweiten Republik, die in Spanien von 1931- 1936 herrschte, wurden nahezu komplett durch neue Reformen und Gesetzeseinführungen des Franco- Regimes zunichte gemacht. Zu den Innovationen der zweiten Republik zählten das Vorantreiben und die zögernde aber fortschreitende Adaption des Liberalismus, Kommunismus, der Freimaurerei und des Sozialismus. Die zweite Republik zeigte sich vor allem fortschrittlich in Bezug auf den Zugewinn an Rechten für die Frau. Es wurde eine Zahl von Reformen eingeführt, die bedeutend für die weiblichen Staatsbürger dieser Zeit gewesen sind: Die Wahlstimme der Frau wurde anerkannt, die Zivilehe sowie die Scheidung legalisiert. Außerdem hatten Mann und Frau arbeitsrechtlich annähernd die gleichen Grundlagen und es wurde eine Gesetzgebung eingeführt, die arbeitende Mütter schützte. Symbolisch für die neue Bewegung in Richtung Gleichberechtigung war die Tatsache, dass 1932 elf Frauen in das Spanische Parlament gewählt wurden. Dies konnte als ein großer Erfolg der zuvor stattgefunden politischen Reformen gewertet werden.
Unter der Herrschaft Francos, die bis zu seinem Tod im November 1975 andauerte, wurde sich jedoch bewusst jeglicher Modernisierung entzogen und sich zurück auf traditionelle Werte und Strukturen besonnen. Franco beschrieb es mit der „, Rückkehr zu den ureigensten Elementen des spanischen Wesens’“ . Es wurde schnell klar, dass die Frau nach franquistischen Grundprinzipien als das unterlegene Geschlecht eingeordnet wurde ; dies beschränkte sich nicht nur auf eine internalisierte, nicht gesetzlich festgelegte Ideologie, sondern gipfelte in der Einführung von Gesetzen, die den weiblichen und den männlichen Staatsbürgern unterschiedliche Rechte einräumten. Es gab augenscheinlich abweichende Beurteilungskriterien für Mann und Frau und unangemessenes Verhalten konnte in einer möglichen Bestrafung durch die unter Franco eingeführten geschlechterspezifischen Gesetzlichkeiten münden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesamtüberblick der Situation der Frau von 1939-1975
- 2.1. Grundzüge des Systems Francos
- 2.2. Beruf und Bildung
- 2.3. Institution Familie
- 2.4. Die Kirche und die „Sección Femenina“
- 3. Veränderungen nach 1975
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption des Frauenbildes während der Franco-Ära in Spanien (1939-1975). Sie analysiert den Rückgang der Frauenrechte im Vergleich zur Zweiten Spanischen Republik und beleuchtet die Auswirkungen des franquistischen Regimes auf verschiedene Lebensbereiche der Frauen.
- Rückgang der Frauenrechte unter Franco
- Das Ideal der „casa, cocina, calceta“
- Einfluss von Kirche und „Sección Femenina“
- Beschränkungen in Bildung und Beruf
- Gesetzliche Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den Kontext des spanischen Bürgerkriegs und den Beginn der Franco-Diktatur, hervorhebend den Verlust der Frauenrechte im Vergleich zur Zweiten Republik. Kapitel 2 bietet einen Gesamtüberblick über die Situation der Frauen während der Franco-Ära, beschreibt das „ideal feminino“ und dessen Auswirkungen auf die Lebensbereiche der Frauen. Kapitel 2.1 beleuchtet die Grundzüge des Franquismus, seinen Einfluss auf die gesellschaftlichen Strukturen und die damit verbundene Unterdrückung. Weitere Kapitel befassen sich mit Beruf und Bildung, der Institution Familie sowie dem Einfluss der Kirche und der „Sección Femenina“ auf das Frauenbild.
Schlüsselwörter
Franco-Ära, Spanien, Frauenbild, „ideal feminino“, „casa, cocina, calceta“, Sección Femenina, Katholisch, Diktatur, Frauenrechte, Bildung, Beruf, Familie, Gesetzgebung, Unterdrückung.
- Citation du texte
- Maya Marquardt (Auteur), 2009, Wie konzipierte sich das Frauenbild zu Zeiten der Franco-Ära?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182818