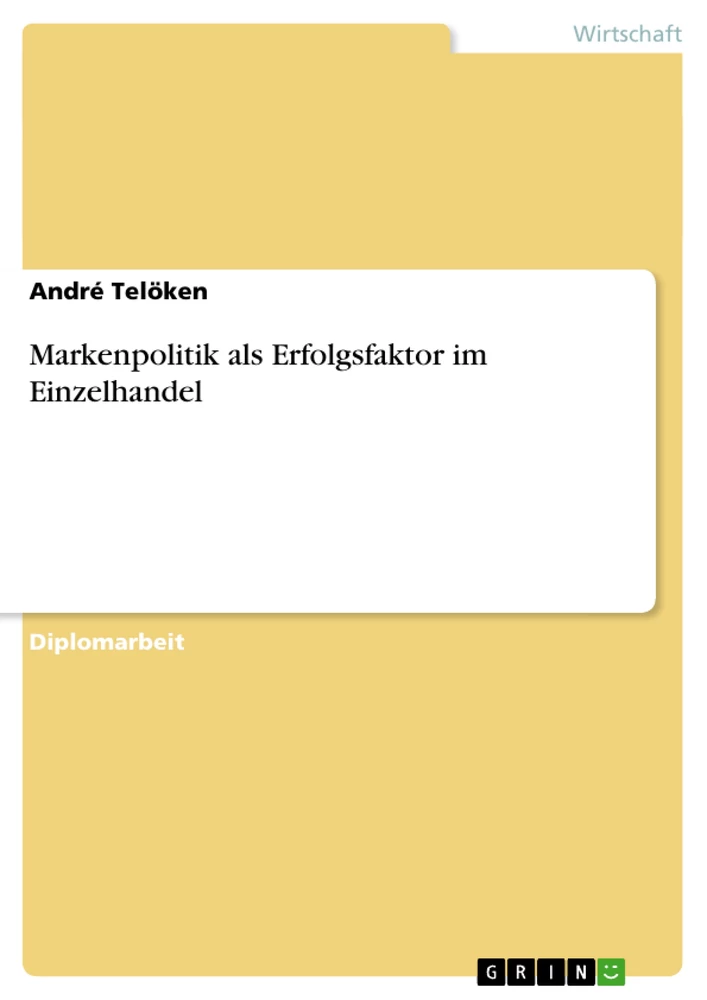Der Einzelhandel in Deutschland ist ein hart umkämpfter Markt. Er ist geprägt durch stagnierende Umsätze und durch eine zunehmende Marktsättigung, die seit den 90er Jahren in Deutschland festzustellen ist. Dies führt zu einem starken Verdrängungswettbewerb. Gleichwohl sind zunehmende Konzentrationstendenzen festzustellen. Die Handelslandschaft gliederte sich einst in eine Vielzahl kleiner und mittlerer Handelsbetriebe, die lediglich eine lokale oder regionale Bedeutung hatten. Durch Akquisitionen, Fusionen oder freiwillige Ketten haben sich die Größenordnungen drastisch verändert.
Ein zusätzliches wesentliches Problem im Einzelhandel ist die hohe Austauschbarkeit von konkurrierenden Handelsunternehmen und das daraus resultierende Profilierungsdefizit. Daraus lässt sich ableiten, dass Handelsunternehmen den Konsumenten keine ausreichenden Differenzierungsmerkmale für ihre Kaufentscheidung mehr geben können. Die Konsequenzen hieraus sind weitreichend: Verlust der Identität der Handelsunternehmen, starke Abhängigkeit von der im Sortiment geführten Marken, sinkende Handelsspannen und hohe Preisreagibilität der Konsumenten bei gleichen Produkten der Konkurrenz. Die Situation im deutschen Einzelhandel lässt sich so beschreiben, dass Konsumenten ein Maximum an Verkaufsfläche, aber ein Minimum an Differenzierung vorfinden. Vor dem Hintergrund austauschbarer Handelsunternehmen und der hohen Wettbewerbsintensität, sind Handelsunternehmen mit niedrigen Preisen und Sonderangeboten kurzfristig im Vorteil.
Handelsunternehmen versuchen als Konsequenz hieraus, durch Markenpolitik ein eigenständiges Profil zu erzeugen, um sich dem Preiskampf und der zunehmenden Homogenisierung der Einzelhandelsbranche zu entziehen.
Deshalb bauen Handelsunternehmen vermehrt einen direkten Kontakt zu den Konsumenten auf. Die Marketingaktivitäten verlagern sich weg von preisorientierten- oder herstellerabhängigen Maßnahmen hin zu einem absatzmarktgerichteten strategischen Einzelhandelsmarketing. Ermöglicht wird dies durch die zu Beginn beschriebene Konzentration im Einzelhandel. Dadurch verfügen Handelsunternehmen über personelle, technische und finanzielle Ressourcen für ein eigenständiges Handelsmarketing.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziele und Aufbau der Arbeit
- 2. Methodische und konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Markenwesen
- 2.1.1 Der Begriff der Marke
- 2.1.2 Funktionen
- 2.1.2.1 Funktionen aus Sicht des Unternehmens
- 2.1.2.2 Funktionen aus Sicht des Konsumenten
- 2.1.3 Rechtliche Grundlagen
- 2.2 Der Begriff der Markenpolitik
- 2.3 Der Begriff des Handelsmarketing
- 2.1 Markenwesen
- 3. Konzept der Markenpolitik im Einzelhandel
- 3.1 Aufgaben und Kernbereiche
- 3.2 Handelsmarken
- 3.2.1 Der Begriff der Handelsmarke
- 3.2.2 Erscheinungsformen
- 3.2.3 Funktionen
- 3.2.4 Entwicklungsphasen
- 3.2.5 Vor- und Nachteile
- 3.3 Retail Branding
- 3.3.1 Der Begriff des Retail Branding
- 3.3.2 Entstehung und Entwicklung
- 3.3.3 Chancen und Risiken
- 3.4 Ziele der Markenpolitik
- 3.4.1 Zielpyramide
- 3.4.2 Markenwert, Markenbekanntheit und Markenimage
- 3.4.3 Markenzufriedenheit, Markenvertrauen, Markenloyalität und Markenbindung
- 3.5 Begründung für die zunehmende Bedeutung der Markenpolitik und ihre zukünftige Ausrichtung
- 4. Aufbau des Erfolgsfaktors Markenpolitik durch Handelsmarken und Retail Branding
- 4.1 Erfolgsvoraussetzungen
- 4.1.1 Allgemeine Leitlinien der Markenführung
- 4.1.2 Handelsmarken
- 4.1.2.1 Handelssystembezogene Voraussetzungen
- 4.1.2.2 Sortiments- und warengruppenbezogene Voraussetzungen
- 4.1.2.3 Konsumentenbezogene Voraussetzungen
- 4.1.3 Retail Branding
- 4.1.3.1 Allgemeine Anforderungen
- 4.1.3.2 Marktsegmentierung
- 4.1.3.3 Profilierung und Positionierung
- 4.2 Integration und Koordination von Handelsmarke und Retail Brand
- 4.3 Marketing-Mix und Handelsmarken als Instrumente im Rahmen des Retail Branding
- 4.3.1 Sortimentspolitik
- 4.3.2 Preispolitik
- 4.3.3 Kommunikationspolitik
- 4.3.4 Servicepolitik
- 4.3.5 In-Store-Management
- 4.3.6 Optimaler Fit als notwendige Bedingung
- 4.1 Erfolgsvoraussetzungen
- 5. Markenpolitik im Einzelhandel anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis
- 5.1 Starke Retail Brands in Deutschland
- 5.2 Tchibo
- 5.3 Real
- 5.4 MediaMarkt/Saturn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Markenpolitik als Erfolgsfaktor im Einzelhandel. Ziel ist es, die Bedeutung von Handelsmarken und Retail Branding für den Erfolg im Einzelhandel zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese Instrumente effektiv eingesetzt werden können. Die Arbeit beleuchtet die konzeptionellen Grundlagen der Markenpolitik und des Handelsmarketings und untersucht deren praktische Anwendung.
- Bedeutung von Handelsmarken im Einzelhandel
- Konzept und Anwendung von Retail Branding
- Erfolgsfaktoren der Markenpolitik im Einzelhandel
- Marketing-Mix Instrumente im Kontext von Handelsmarken und Retail Branding
- Praxisbeispiele erfolgreicher Markenstrategien im Einzelhandel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Das einleitende Kapitel beschreibt die Problemstellung, die sich aus der zunehmenden Bedeutung der Markenpolitik im Einzelhandel ergibt. Es werden die Ziele der Arbeit definiert und der Aufbau der Arbeit skizziert. Der Fokus liegt auf der Analyse von Handelsmarken und Retail Branding als zentrale Erfolgsfaktoren.
2. Methodische und konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert die Begriffe Marke, Markenpolitik und Handelsmarketing und beleuchtet deren Funktionen und rechtliche Rahmenbedingungen. Es bildet die Basis für die anschließende Analyse der Markenpolitik im Einzelhandel.
3. Konzept der Markenpolitik im Einzelhandel: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Konzept der Markenpolitik im Einzelhandel. Es beschreibt die Aufgaben und Kernbereiche der Markenpolitik, analysiert Handelsmarken und Retail Branding in ihren verschiedenen Facetten (Begriffe, Erscheinungsformen, Funktionen, Entwicklungsphasen, Vor- und Nachteile). Es werden die Ziele der Markenpolitik im Detail erläutert, inklusive Markenwert, Markenbekanntheit, Markenimage, -zufriedenheit, -vertrauen, -loyalität und -bindung. Das Kapitel schließt mit einer Begründung für die zunehmende Bedeutung der Markenpolitik und ihrer zukünftigen Ausrichtung.
4. Aufbau des Erfolgsfaktors Markenpolitik durch Handelsmarken und Retail Branding: Hier wird untersucht, wie Handelsmarken und Retail Branding den Erfolg im Einzelhandel beeinflussen. Es werden die Erfolgsvoraussetzungen für beide Strategien analysiert, sowohl aus der Sicht des Handelssystems, des Sortiments, der Warengruppen als auch des Konsumenten. Die Integration und Koordination von Handelsmarken und Retail Brand wird ebenso behandelt wie der Marketing-Mix (Sortiments-, Preis-, Kommunikations-, Servicepolitik und In-Store-Management) im Kontext beider Strategien. Das Kapitel betont die Bedeutung des "optimalen Fits" als notwendige Bedingung für Erfolg.
5. Markenpolitik im Einzelhandel anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis: In diesem Kapitel werden anhand von Praxisbeispielen (u.a. Tchibo, Real, MediaMarkt/Saturn) erfolgreiche Markenstrategien im deutschen Einzelhandel vorgestellt und analysiert. Die Beispiele veranschaulichen die theoretischen Konzepte der vorherigen Kapitel und demonstrieren die erfolgreiche Anwendung von Handelsmarken und Retail Branding in der Praxis.
Schlüsselwörter
Markenpolitik, Einzelhandel, Handelsmarken, Retail Branding, Erfolgsfaktoren, Marketing-Mix, Markenwert, Markenimage, Konsumentenverhalten, Marktsegmentierung, Positionierung, Wettbewerbsvorteil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Markenpolitik im Einzelhandel
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Markenpolitik als Erfolgsfaktor im Einzelhandel. Der Fokus liegt auf der Analyse von Handelsmarken und Retail Branding und deren effektiven Einsatz zur Steigerung des Unternehmenserfolges.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt konzeptionelle Grundlagen der Markenpolitik und des Handelsmarketings, die Bedeutung von Handelsmarken im Einzelhandel, das Konzept und die Anwendung von Retail Branding, Erfolgsfaktoren der Markenpolitik, Marketing-Mix Instrumente im Kontext von Handelsmarken und Retail Branding sowie Praxisbeispiele erfolgreicher Markenstrategien.
Welche methodischen und konzeptionellen Grundlagen werden gelegt?
Die Arbeit definiert die Begriffe Marke, Markenpolitik und Handelsmarketing und beleuchtet deren Funktionen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies bildet die Basis für die Analyse der Markenpolitik im Einzelhandel.
Was wird unter dem Konzept der Markenpolitik im Einzelhandel verstanden?
Das Kapitel beschreibt Aufgaben und Kernbereiche der Markenpolitik, analysiert Handelsmarken und Retail Branding (Begriffe, Erscheinungsformen, Funktionen, Entwicklungsphasen, Vor- und Nachteile), erläutert Ziele der Markenpolitik (Markenwert, Markenbekanntheit, Markenimage, -zufriedenheit, -vertrauen, -loyalität und -bindung) und begründet die zunehmende Bedeutung der Markenpolitik und deren zukünftige Ausrichtung.
Wie wird der Aufbau des Erfolgsfaktors Markenpolitik durch Handelsmarken und Retail Branding dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Handelsmarken und Retail Branding den Einzelhandelserfolg beeinflussen. Erfolgsvoraussetzungen werden aus Sicht des Handelssystems, des Sortiments, der Warengruppen und des Konsumenten analysiert. Die Integration und Koordination von Handelsmarken und Retail Brand sowie der Marketing-Mix (Sortiments-, Preis-, Kommunikations-, Servicepolitik und In-Store-Management) im Kontext beider Strategien werden behandelt. Die Bedeutung des "optimalen Fits" als Erfolgsbedingung wird hervorgehoben.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert erfolgreiche Markenstrategien im deutschen Einzelhandel anhand von Praxisbeispielen wie Tchibo, Real und MediaMarkt/Saturn. Diese veranschaulichen die theoretischen Konzepte und die erfolgreiche Anwendung von Handelsmarken und Retail Branding.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind Markenpolitik, Einzelhandel, Handelsmarken, Retail Branding, Erfolgsfaktoren, Marketing-Mix, Markenwert, Markenimage, Konsumentenverhalten, Marktsegmentierung, Positionierung und Wettbewerbsvorteil.
Welche Ziele verfolgt die Diplomarbeit?
Ziel ist die Analyse der Bedeutung von Handelsmarken und Retail Branding für den Erfolg im Einzelhandel und die Darstellung deren effektiven Einsatzes. Die Arbeit beleuchtet die konzeptionellen Grundlagen und deren praktische Anwendung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den methodischen und konzeptionellen Grundlagen, ein Kapitel zum Konzept der Markenpolitik im Einzelhandel, ein Kapitel zum Aufbau des Erfolgsfaktors Markenpolitik durch Handelsmarken und Retail Branding sowie ein Kapitel mit Praxisbeispielen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
- Quote paper
- André Telöken (Author), 2009, Markenpolitik als Erfolgsfaktor im Einzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182860