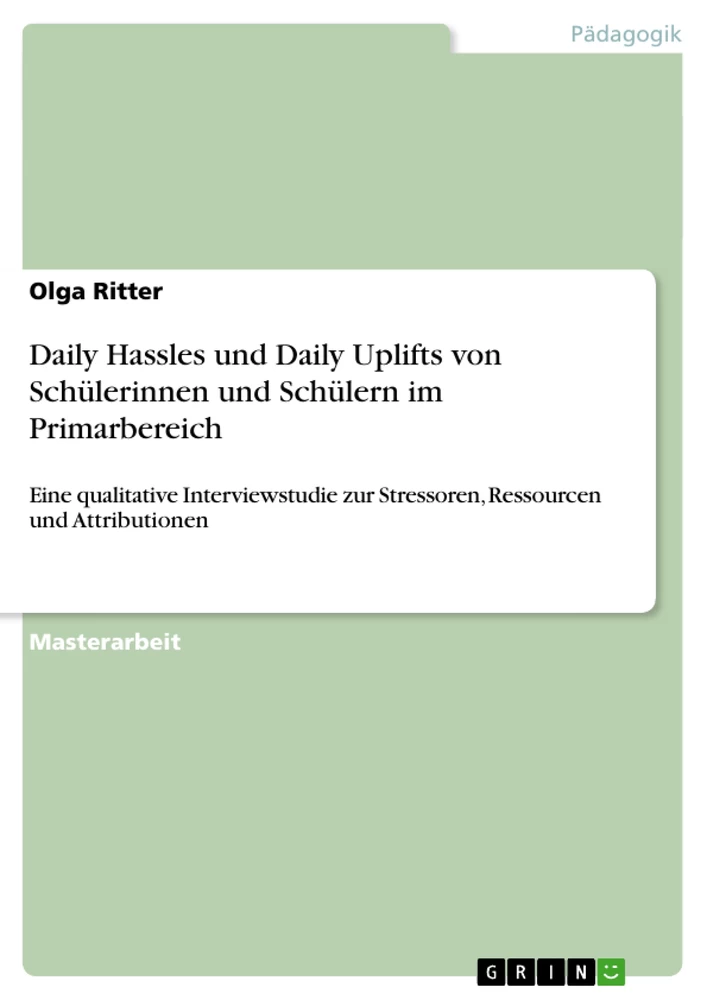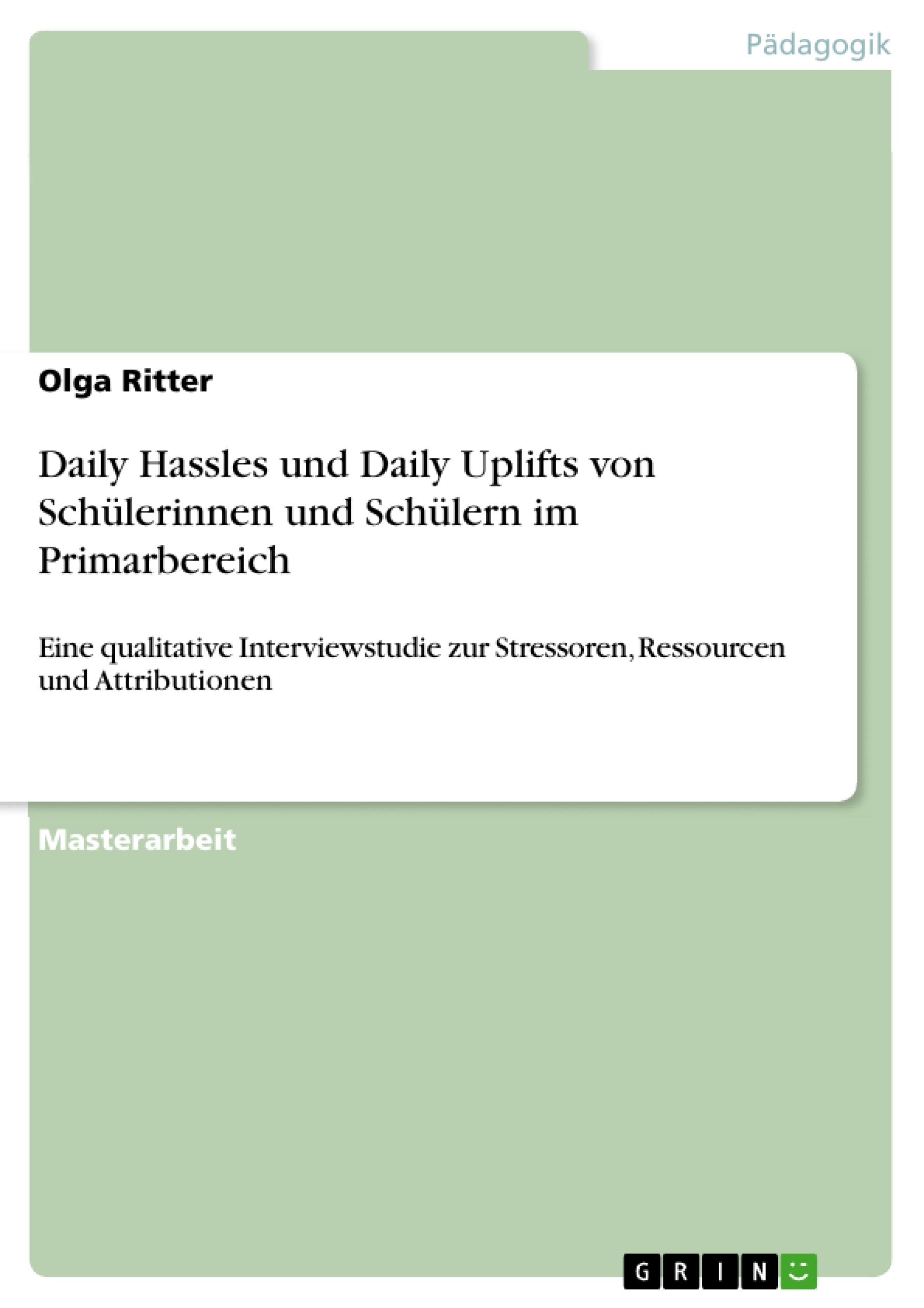Die soziale Entwicklung hat den Jugendlichen nicht nur neue Perspektiven geschaffen, um ihre Individualität zu entfalten, sondern auch hohe Anforderungen und Erwartungen gesetzt. Demnach erleben in der heutigen Gesellschaft bereits Kinder- und Jugendliche physische und psychische Störungen, die ihr Alltagsleben beeinflussen können. Die Stressopfer werden immer jünger und sind bereits in dem Primarbereich zu finden (Hampel 2003, S. 1). Die Folgen von Dauerstress können zu psychosomatischen und funktionellen Krankheiten beitragen, die das Gesundheitssystem und die psychosoziale Entwicklung des heranwachsendes Kindes ungünstig beeinflussen sowie das Erreichen von Lebenszielen behindern kann (Entwicklungspsychologie 2006, S. 1); (Scharf & Rupprecht 2010, S. 5). Dieses Problem wurde seit vielen Jahren nur bei Erwachsenen oder Berufstätigen, wie z.B. Lehrkräften betrachtet und in der Stressforschung untersucht. In dieser Arbeit sollten demzufolge die alltäglichen Vorgänge des Schülers analysiert werden. Lernende erleben immer häufiger Stress müssen ihre Gedanken und das Verhalten ständig regulieren und mit Belastungssituationen umgehen können. Um die kognitiven Prozesse der Schüler genauer zu analysieren bzw. zu verstehen sowie die Arbeitsbelastung und -zufriedenheit in Unterrichtssituationen zu erhellen, wird die Studie von dem Psychologen Grimm, der die kognitive Bewegungslandschaft der Lehrer untersuchte, vorgestellt. Daraufhin wird von der Studierenden Olga Ritter eine qualitative Interviewstudie in drei Grundschulen durchgeführt, die tägliche Stressoren von Schülerinnen und Schülern im Schulleben untersucht und den Zusammenhang zwischen wahrgenommenen Unterrichtsituationen sowie die Schülerzufriedenheit beleuchtet. Ziel der Datenerhebung ist es, zu erfahren, wie die Schüler die unterschiedlichen Unterrichtsituationen bzw. das Schulleben wahrnehmen und attribuieren. Die Zufriedenheit der Schüler ist ebenfalls ein Aspekt, der in diesem Kontext näher betrachtet wird (Grimm, 1996, S. 11). Die Wahrnehmung von Schülern hängt nicht nur von äußeren Zuständen ab, sondern ist das Resultat kognitiver Prozesse, die mit Hilfe von drei verschiedenen Stressmodellen (Lazarus, Hobfoll und Siegrist) die in dieser Arbeit im Fokus stehen, verständlich gemacht werden sollen. Zunächst wird das Transaktionsmodell nach Lazarus veranschaulicht, welches eine dynamische Beziehung zwischen Situation und Person vorstellt.....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Ausgangslage und Problemstellung - Schülerstress
- 1.2. Überblick über das kognitive Landschaftsmodell von Lehrern - Grimm
- 2. Stressverarbeitungsmodelle
- 2.1. Transaktionistischer Ansatz von Lazarus
- 2.1.1. Stressrelevante Personen-Umwelt-Beziehung
- 2.1.2. Stress als mehrstufiger Bewertungsprozess
- 2.1.3. Bewältigung (Copings)
- 2.2. Die Theorie Ressourcenerhaltung nach Hobfoll
- 2.3. Gratifikationskrise nach Siegrist
- 2.3.1. Extrinsische Verausgabung
- 2.3.2. Intrinsische Verausgabung
- 3. Motivationstheorien
- 3.1. Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
- 3.2. Theorie der Arbeitszufriedenheit von Oldham und Hackman
- 3.3. Zweifaktoren Theorie von Herzberg
- 4. Stressquellen von Kindern und Jugendlichen
- 4.1. Positiver und negativer Stress
- 4.2. Stress aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen
- 4.3. Kritische Lebensereignisse
- 4.4. Entwicklungsprobleme
- 4.5. Schule
- 4.6. Selbst
- 4.7. Das Zusammenwirken mehrerer Stressoren
- 5. Stresswirkungen
- 5.1. Physische Stresssymptome
- 5.2. Psychische Stresssymptome
- 6. Vorgehensweisen der Datenerhebung
- 6.1. Vorgehensweisen
- 6.2. Methode und Funktion
- 7. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 7.1. Angenehme Unterrichtssituationen
- 7.2. Unangenehmen Unterrichtssituationen
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die täglichen Herausforderungen und positiven Erlebnisse von Schülerinnen und Schülern im Primarbereich. Ziel ist es, Stressoren, Ressourcen und deren Zuschreibungen qualitativ zu erforschen. Die Studie verwendet qualitative Interviews, um ein tieferes Verständnis für die subjektive Wahrnehmung von Stress bei Kindern zu gewinnen.
- Stressoren und Ressourcen im schulischen Alltag von Grundschulkindern
- Subjektive Wahrnehmung und Bewertung von Stresssituationen
- Bewältigungsstrategien von Kindern im Umgang mit Stress
- Zusammenhang zwischen Stress, Ressourcen und Attribution
- Geschlechterunterschiede im Umgang mit Stress
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Schülerstresses ein und beschreibt den Forschungsansatz. Kapitel 2 behandelt verschiedene Stressverarbeitungsmodelle, darunter den transaktionalen Ansatz von Lazarus und die Theorie der Ressourcenerhaltung nach Hobfoll. Kapitel 3 widmet sich relevanten Motivationstheorien. Kapitel 4 beleuchtet verschiedene Stressquellen bei Kindern und Jugendlichen, eingeteilt in Kategorien wie Schule und Selbst. Kapitel 5 beschreibt physische und psychische Stresssymptome. Kapitel 6 erläutert die Methodik der Datenerhebung mittels qualitativer Interviews. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Studie, getrennt in angenehme und unangenehme Unterrichtssituationen.
Schlüsselwörter
Schülerstress, Primarbereich, qualitative Interviewstudie, Stressoren, Ressourcen, Attribution, Stressverarbeitungsmodelle, Motivationstheorien, Bewältigungsstrategien, kognitive Bewertung, Ressourcenerhaltung, Gratifikationskrise.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Daily Hassles“ und „Daily Uplifts“?
Daily Hassles sind alltägliche kleine Belastungen oder Stressoren, während Daily Uplifts positive Erlebnisse im Alltag darstellen, die als Ressourcen wirken können.
Welche Stressmodelle werden in der Arbeit zur Analyse genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf das Transaktionsmodell von Lazarus, die Theorie der Ressourcenerhaltung nach Hobfoll und das Modell der Gratifikationskrise nach Siegrist.
Warum wird Stress bei Grundschülern immer relevanter?
Steigende Anforderungen und gesellschaftliche Erwartungen führen dazu, dass Kinder bereits im Primarbereich physische und psychische Belastungssymptome zeigen.
Was ist das Ziel der qualitativen Interviewstudie von Olga Ritter?
Ziel ist es zu verstehen, wie Schüler Unterrichtssituationen subjektiv wahrnehmen, attribuieren und wie zufrieden sie in verschiedenen Schulsituationen sind.
Welche Auswirkungen kann Dauerstress auf Kinder haben?
Dauerstress kann zu psychosomatischen Erkrankungen führen und die psychosoziale Entwicklung sowie das Erreichen von Lebenszielen negativ beeinflussen.
Welche Rolle spielt die Attribution im Stresserleben?
Die Wahrnehmung von Stress hängt stark von kognitiven Prozessen ab, also davon, wie Kinder Ursachen für Belastungen oder Erfolge zuschreiben (Attribution).
- Arbeit zitieren
- Master of Educ. Olga Ritter (Autor:in), 2011, Daily Hassles und Daily Uplifts von Schülerinnen und Schülern im Primarbereich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182906