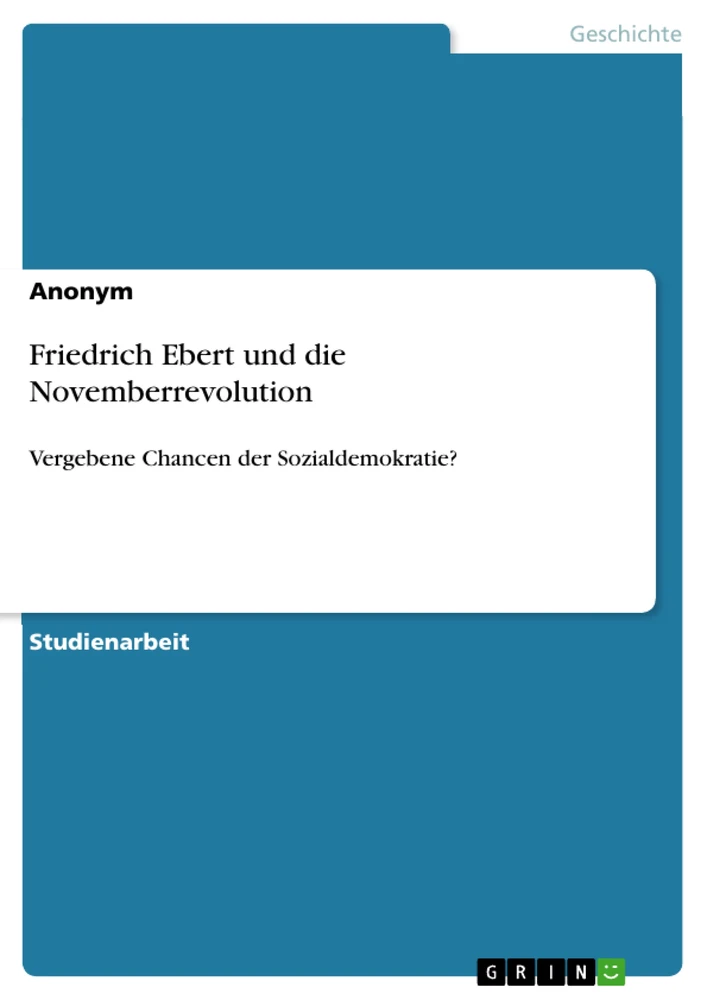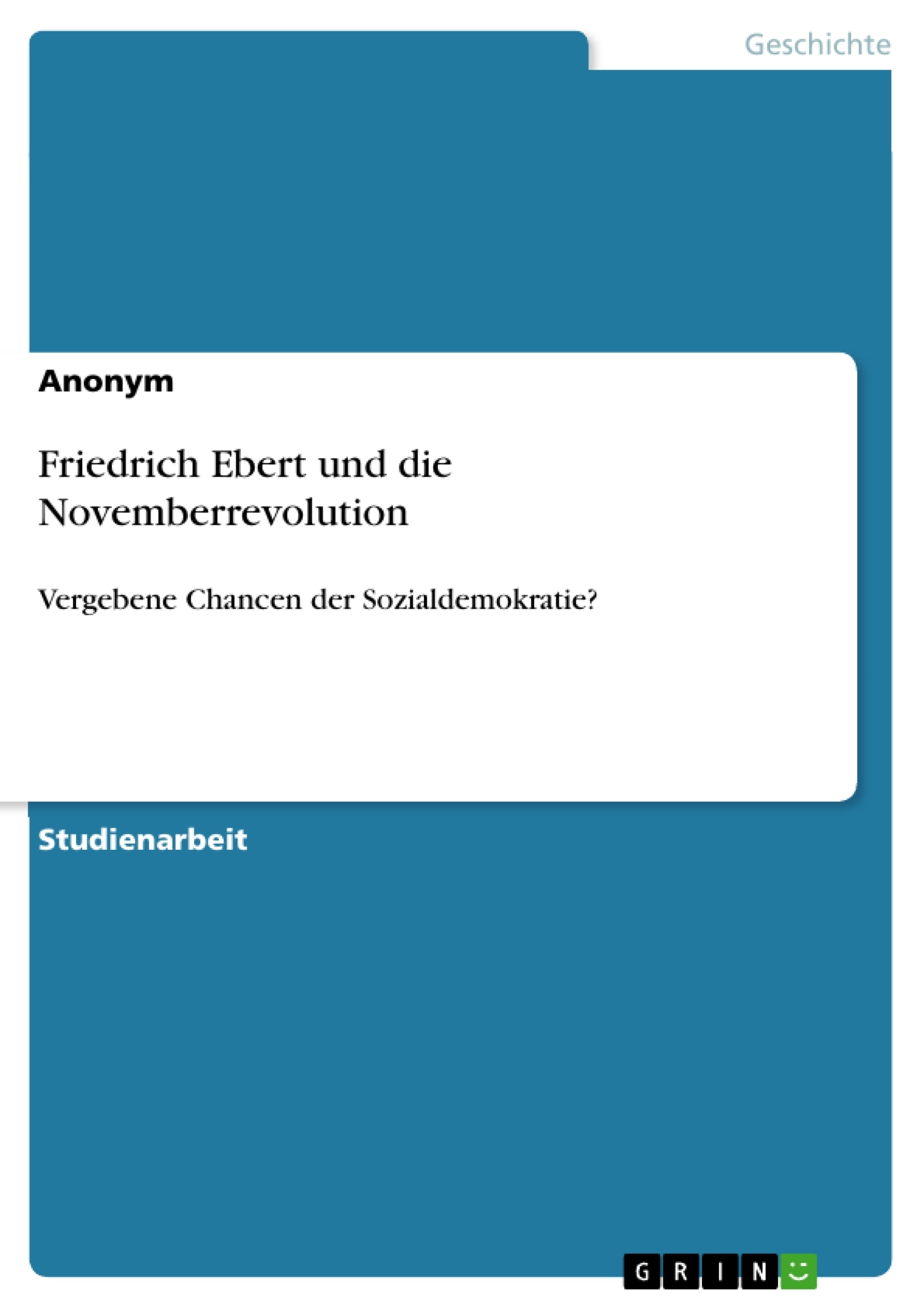[...] Dies wurde auch zeitgenössisch zum Teil schon so empfunden; das viel zitierte
Urteil des linksliberalen Publizisten Theodor Wolff vom 11. November 1918 verdeutlicht
dies: Dies sei (…) die größte aller Revolutionen (…), weil niemals eine so fest gebaute, mit
so soliden Mauern umgebene Bastion so in einem Anlauf genommen worden ist.
Auch in diesem Fall gilt jedoch: Aus der Rückschau stellt sich Vieles anders dar.
Blickt man darauf, was diese größte aller Revolutionen letztlich als Ergebnis aufweisen
konnte- die Weimarer Republik mit ihren strukturellen Schwächen, den Straßenschlachten,
ganz allgemein ihren Krisen und schließlich ihrer Auflösung in nationalsozialistischer Diktatur- so drängt sich die Frage auf, wie es zu einer solchen Entwicklung kommen
konnte. Ins Blickfeld gerät dann zwangsläufig auch die Regierung der
Novemberrevolution, der Rat der Volksbeauftragten. Immerhin waren die Monate von
Mitte November 1918 bis Anfang Februar 1919 jene, in denen die Revolution noch jung,
ihre Strahlkraft dementsprechend groß gewesen sein müsste: Versäumnisse dieser Tage
konnten vielleicht später nicht mehr so leicht nachgeholt werden. Wurden
dementsprechend bereits hier- vielleicht für immer- falsche Weichen gestellt und somit
Chancen verpasst, noch vor der konstituierenden Nationalversammlung ein stabileres
Fundament für die Weimarer Zeit zu schaffen?
Mit dieser Thematik will sich auch die hier vorliegende Arbeit auseinandersetzen.
Sie betritt damit- zugegebenermaßen- kein Neuland. Gerade in der jüngeren
Revolutionsforschung wurde die Frage nach Chancen- vor allem auch vergebenen
Chancen- der Sozialdemokratie seit November 1918 zu einem Leitmotiv5.
Daher ist es nicht Ziel dieser Arbeit, neue Antworten in der Auslegung der Ereignisse zu
finden. Vielmehr soll zu den gängigsten Thesen kritisch Stellung bezogen werden, um eine
eigene Gewichtung in der Auslegung der Ereignisse zu finden. Hierzu soll in einem ersten
Schritt ein kurzer Einblick in die beiden wichtigsten, im Wesentlichen kontroversen
Positionen der Forschung erfolgen. In Bezug hierauf sollen einige zentrale Streitpunkte
analysiert werden, welche die Kontroverse prägen. Dies soll zu guter Letzt zu einer
eigenen Akzentuierung im Urteil zu der genannten Fragestellung führen. Ein besonderes
Augenmerk soll dabei in dieser Arbeit der Person Friedrich Eberts gelten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Abgrenzung zu den Arbeiter- und Soldatenräten
- Das Phänomen der Bolschewismusfurcht
- Politische Ausrichtung der Revolution
- Die Bolschewismusgefahr aus Sicht der MSPD-Führung
- Kooperation nach rechts und ungenügende Reformen
- MSPD und OHL
- Reformpolitik der Regierung
- Das politische Verständnis Eberts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Novemberrevolution von 1918 und beleuchtet insbesondere die Rolle Friedrich Eberts und der Sozialdemokratie in diesem revolutionären Prozess. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob und inwiefern die Sozialdemokratie im Kontext der Revolution Chancen verpasst hat, die zu einem stabileren Fundament für die Weimarer Republik hätten führen können.
- Die Rolle Friedrich Eberts in der Novemberrevolution
- Chancen und Versäumnisse der Sozialdemokratie nach 1918
- Die Entstehung und Bedeutung der Arbeiter- und Soldatenräte
- Der Einfluss der Bolschewismusfurcht auf die politische Entwicklung
- Die Kooperation der Sozialdemokratie mit konservativen Kräften
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der Novemberrevolution dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Es wird die Bedeutung des Tages des 9. Novembers 1918 betont und die Frage aufgeworfen, ob die Regierung der Novemberrevolution Chancen für eine stabilerere Republik verpasst hat.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Revolutionsforschung. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse von 1918/19 dargestellt, angefangen von den stark politisch motivierten Deutungen der Extremen bis hin zu den differenzierten Analysen der neueren Forschung.
- Abgrenzung zu den Arbeiter- und Soldatenräten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der Bolschewismusfurcht und analysiert die politische Ausrichtung der Revolution. Es wird die Perspektive der MSPD-Führung auf die Bolschewismusgefahr beleuchtet.
- Kooperation nach rechts und ungenügende Reformen: Das Kapitel beleuchtet die Zusammenarbeit der Sozialdemokratie mit dem Oberkommando der Armee (OHL) und die Reformpolitik der Regierung. Es wird die Frage nach Eberts politischem Verständnis im Kontext der Revolution diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Novemberrevolution, die Rolle Friedrich Eberts und der Sozialdemokratie, die Arbeiter- und Soldatenräte, den Bolschewismus, die Weimarer Republik, Chancen und Versäumnisse sowie die politische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Friedrich Ebert in der Novemberrevolution?
Ebert agierte als Vorsitzender des Rats der Volksbeauftragten und versuchte, einen geordneten Übergang zur parlamentarischen Demokratie zu sichern, wobei er radikale Umbrüche mied.
Was war die "Bolschewismusfurcht"?
Es war die Angst der MSPD-Führung vor einer Entwicklung nach russischem Vorbild, was zu einer engen Kooperation mit alten Eliten und dem Militär (OHL) führte.
Hat die SPD Chancen zur Stabilisierung der Republik verpasst?
Die Arbeit diskutiert die These, dass durch ungenügende Reformen in Verwaltung und Militär ein instabiles Fundament für die Weimarer Republik geschaffen wurde.
Wie standen Ebert und die MSPD zu den Arbeiter- und Soldatenräten?
Obwohl die Räte Träger der Revolution waren, sah die MSPD-Führung in ihnen eher ein provisorisches Organ und drängte auf eine schnelle Wahl zur Nationalversammlung.
Was war das Ziel des Bündnisses zwischen Ebert und der OHL?
Das Ziel war die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz vor einer befürchteten sozialen Revolution durch linksradikale Kräfte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Friedrich Ebert und die Novemberrevolution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182937