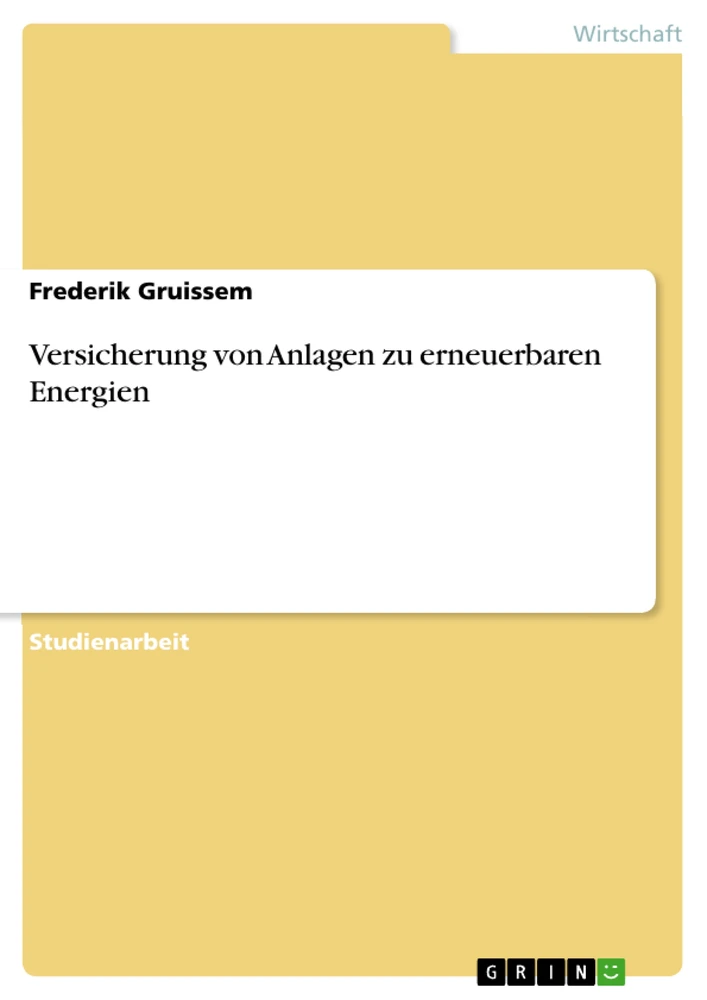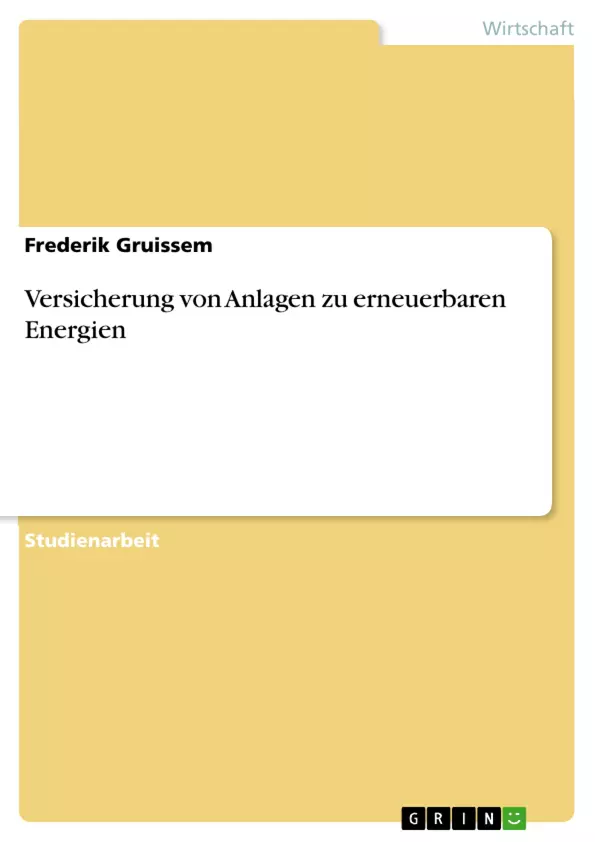Die großen Versicherungskonzerne lassen die Schatten ihrer Jahrhunderte alten Geschäfte hinter sich und wenden sich der Sonne zu, einem einträglichen wie ebenso wachstumsstar-kem Geschäft. Das Wachstum der Solarkraft übertrifft nicht nur das anderer typischer Ver-sicherungszweige, sondern auch das anderer Formen der erneuerbaren Energien.
So betrug im Jahr 2008 der Umsatz aus der Errichtung von Solarkraft-Anlagen in Deutsch-land 7.650 Mio. EUR, mehr als alle anderen erneuerbaren Energieträger zusammen ge-nommen (s. Abb. A.1). Allerdings entwickelt sich die Solarkraft im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien auch von einem sehr geringen Level und wird in Deutschland, was die großen Anlagen betrifft, keine bedeutende Zukunft haben. Aber die Beteiligung der Münchner Rück am Projekt Desertec und eine Exportquote bei Solarmodulen von 35 Pro-zent lassen darauf hoffen, dass deutsche Unternehmen auch ohne starken heimischen Markt von der Entwicklung der Solarkraft profitieren können.
Versicherung ist nur eine Antwort von vielen auf Agency-Probleme bei der Finanzierung von erneuerbaren Energien. Der erste Teil der vorliegenden Arbeit konzentriert sich des-halb auf die Darstellung von anderen Lösungsansätzen, insbesondere auf das bei den Er-neuerbaren dominierende Konzept der Projektfinanzierung; Unterschiede zu den her-kömmlichen Energieträgern werden an entsprechender Stelle hervorgehoben.
Der zweite Teil der Arbeit beschreibt mit Blick auf die Agency-Problematik die Rolle und Zweckmäßigkeit von Versicherungen bei der Solarkraft.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Antworten auf Moral Hazard Probleme am Beispiel der Solarkraft
- Begrenzung der Handlungsspielräume des Managements
- Kreditbedingungen und Errichtungsphase
- Kreditauflagen und Betriebsphase
- Sicherheiten
- Einpreisung in den geforderten Zins
- Ausgliederung in eine Projektgesellschaft
- Andere Instrumente
- Begrenzung der Handlungsspielräume des Managements
- Wechselwirkungen zwischen Finanzierung und Versicherung
- Versicherung des Sponsors
- Versicherung der Anlagenhersteller
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Versicherung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, wobei der Fokus auf der Solarkraft liegt. Das Hauptziel ist es, die Rolle und Zweckmäßigkeit von Versicherungen im Kontext von Agency-Problemen bei der Finanzierung von erneuerbaren Energien zu analysieren.
- Die Agency-Problematik bei der Finanzierung von erneuerbaren Energien
- Lösungsansätze zur Behebung von Agency-Problemen, insbesondere Projektfinanzierung
- Die Rolle von Versicherungen bei der Solarkraft
- Die Bedeutung von Versicherungen zur Reduzierung von Risiken für Stakeholder
- Die Wechselwirkungen zwischen Finanzierung und Versicherung in der Solarkraftbranche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung dar, die sich aus der Finanzierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ergibt. Die Arbeit verdeutlicht die Bedeutung der Solarkraft und die Herausforderungen, die sich aus den Agency-Problemen bei der Finanzierung dieser Anlagen ergeben.
Kapitel 2 analysiert verschiedene Lösungsansätze zur Behebung von Moral Hazard Problemen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung von Solaranlagen auftreten können. Hierzu zählen Maßnahmen zur Begrenzung der Handlungsspielräume des Managements, die Bereitstellung von Sicherheiten, die Einpreisung von Risiken in den geforderten Zins und die Ausgliederung der Anlage in eine Projektgesellschaft.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Wechselwirkungen zwischen Finanzierung und Versicherung. Es werden die Vorteile der Versicherung für den Sponsor und den Anlagenhersteller erläutert. Der Fokus liegt dabei auf der Reduzierung von Risiken, dem Einkauf von Expertise in Verlustbewertung und -vermeidung sowie weiteren Vorteilen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themengebiete erneuerbare Energien, insbesondere Solarkraft, Agency-Probleme, Projektfinanzierung, Versicherung, Risikomanagement und Stakeholder. Es werden wichtige Konzepte wie Moral Hazard, Agency-Kosten, Versicherungsformen und Finanzierungstools diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Versicherungen für Solarkraft-Anlagen so wichtig?
Versicherungen helfen dabei, Agency-Probleme (wie Moral Hazard) bei der Finanzierung zu lösen und Risiken für Sponsoren und Kreditgeber zu minimieren.
Was ist das „Desertec“-Projekt?
Desertec ist ein Großprojekt zur Gewinnung von Solarenergie in Wüstengebieten, an dem Unternehmen wie die Münchner Rück beteiligt sind, um von globalen Solarkraft-Entwicklungen zu profitieren.
Welche Rolle spielt die Projektfinanzierung bei erneuerbaren Energien?
Die Projektfinanzierung ist das dominierende Konzept, bei dem die Anlage oft in eine eigene Projektgesellschaft ausgegliedert wird, um Risiken vom Hauptunternehmen (Sponsor) zu trennen.
Wie kann Moral Hazard bei Solaranlagen begrenzt werden?
Durch Kreditbedingungen in der Errichtungsphase, Kreditauflagen in der Betriebsphase, die Bereitstellung von Sicherheiten und die Einpreisung von Risiken in den Zins.
Welchen Vorteil haben Versicherungen für Anlagenhersteller?
Hersteller können durch Versicherungen Garantierisiken absichern und zusätzliche Expertise in der Verlustbewertung und -vermeidung einkaufen.
- Quote paper
- Diplo-Betriebswirt Frederik Gruissem (Author), 2009, Versicherung von Anlagen zu erneuerbaren Energien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182941