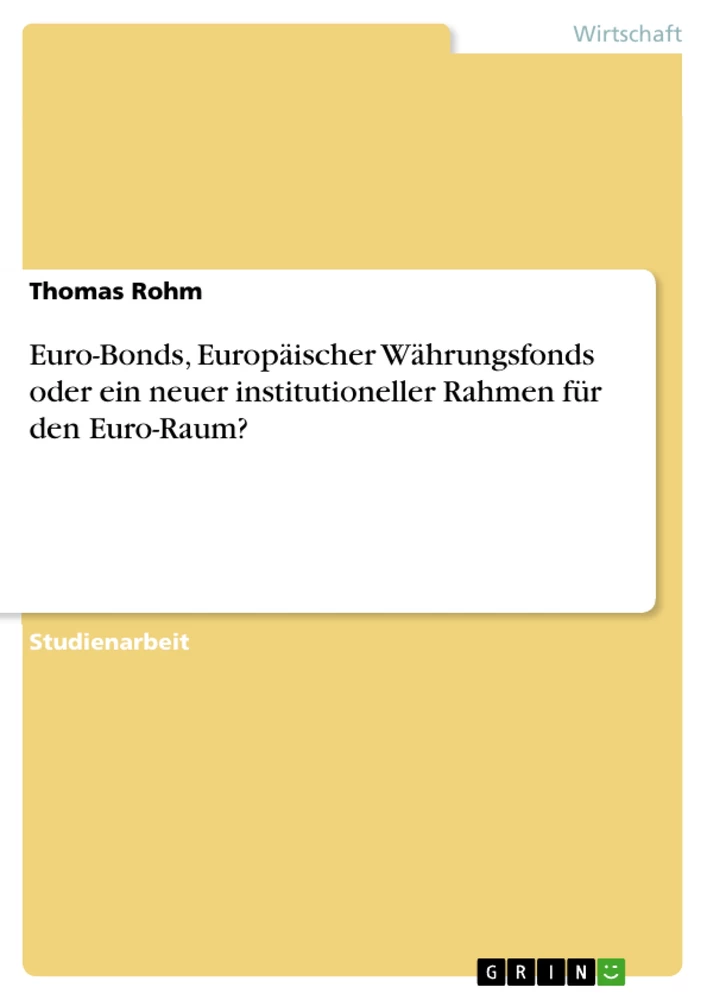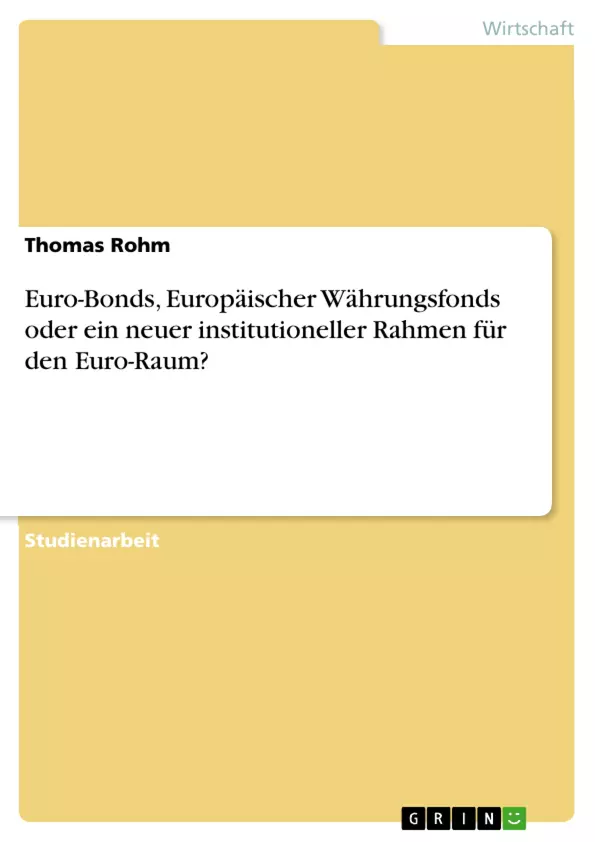„Man sollte politischen Entscheidungsträgern nicht allzu laut dafür applaudieren, dass es nach einer Welle der Schuldenkrisen in den 1980er- und 1990er-Jahren zwischen 2003 und 2009 keine größeren Zahlungsausfälle bei Auslandsschulden gegeben hat. Gehäufte Zahlungsausfälle bleiben die Norm, wobei internationale Krisenwellen typischerweise viele Jahre […] auseinanderliegen.“ Die Worte der renommierten US-Ökonomen Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff, zitiert aus ihrem im Original 2009 erschienen Buch „Dieses Mal ist alles anders“, klingen wie eine dunkle Vorahnung dessen, was nur wenige Monate später, mitten in Europa zur bitteren Realität werden sollte und die Staatengemeinschaft bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wohl aber auch noch einige Zeit darüber hinaus vor große Herausforderungen stellt bzw. stellen wird. Ihren Anfang nahm die jüngste Schuldenkrise, von der hier die Rede ist, in Griechenland. Doch die Griechen waren nur das erste Glied in einer immer länger werdenden Kette von Staaten, die eingeholt von einer ausufernden Schuldenpolitik ihre Refinanzierungsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten mehr und mehr beschränkt sahen. [...] Trotz der enormen Geldbeträge, welche die Währungsgemeinschaft aufgeboten hat, ist es bisher nicht gelungen, den Euro-Raum nachhaltig zu stabilisieren, im Gegenteil, die Anleihenmärkte gerieten sogar noch stärker unter Druck. Dass die gegenwärtigen Rettungsmaßnahmen als langfristige Lösung ungeeignet und darüber hinaus mit schwerwiegenden Anreizproblemen behaftet sind, darin ist sich die Wirtschaftswissenschaft weitgehend einig. Anspruch vorliegender Arbeit ist es allerdings nicht, ausführlich Kritik an den bisherigen Maßnahmen zu üben oder einen umfassenden Überblick über den Verlauf der Krise zu gewähren. Vielmehr geht es darum Lösungsalternativen aufzuzeigen sowie ihre Vor- und Nachteile zu diskutieren, um schließlich einen Eindruck zu vermitteln, auf welche Basis ein langfristig tragfähiges Konzept zur erfolgreichen Stabilisierung der Währungsunion gestellt werden muss. Dabei spannt sich der Bogen von dem lange Zeit heiß diskutierten Konzept der Euro-Bonds über das Modell eines Europäischen Währungsfonds bis hin zu tief greifenden Reformvorschlägen für das institutionelle Gefüge des Euro-Raums.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Euro-Bonds
- 2.1. Charakteristik der Euro-Bonds Auflage
- 2.2. Grundannahmen
- 2.3. Zwischenergebnis
- 2.4. Eine grundlegende Kritik
- 3. Europäischer Währungsfonds
- 3.1. Ein geregeltes Insolvenzverfahren
- 3.2. Finanzierungs-, Beistands- und Durchsetzungsmechanismen
- 3.3. Zwischenergebnis
- 4. Neuer institutioneller Rahmen für den Euro
- 4.1. Erste Säule: Stabilitätspakt mit mehr Biss
- 4.2. Zweite Säule: Mehr Stabilität für das private Finanzsystem
- 4.3. Dritte Säule: Ein Europäischer Krisenmechanismus
- 5. Resümee und Ausblick
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Lösungsalternativen zur Stabilisierung der Eurozone angesichts der Schuldenkrise. Sie analysiert verschiedene Ansätze, diskutiert deren Vor- und Nachteile und strebt nach einem tragfähigen Konzept für die langfristige Stabilisierung der Währungsunion.
- Analyse von Euro-Bonds als Krisenlösung
- Bewertung eines Europäischen Währungsfonds
- Diskussion tiefgreifender Reformen des institutionellen Gefüges des Euro-Raums
- Bewertung der jeweiligen Vor- und Nachteile der Lösungsansätze
- Entwicklung eines tragfähigen Konzepts für die Stabilisierung der Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt den Beginn der europäischen Schuldenkrise und deren Ausmaß. Sie betont die unzureichenden bisherigen Rettungsmaßnahmen und begründet die Notwendigkeit nach alternativen Lösungsansätzen.
Kapitel 2 (Euro-Bonds): Dieses Kapitel beleuchtet die umstrittene Idee der Euro-Bonds, ihre Vorteile und Nachteile, insbesondere die Problematik der kollektiven Haftung und die Anreizwirkungen. Es präsentiert ein modifiziertes Modell von de Grauwe und Moesen, welches die Liquiditätsprobleme an den Anleihemärkten stärker berücksichtigt.
Kapitel 3 (Europäischer Währungsfonds): Hier wird ein Europäischer Währungsfonds als möglicher Lösungsansatz vorgestellt. Die Kapitel behandeln Aspekte wie Insolvenzverfahren und Finanzierungsmechanismen.
Kapitel 4 (Neuer institutioneller Rahmen für den Euro): Dieser Abschnitt skizziert umfassendere Reformen für den Euro-Raum, die auf mehreren Säulen beruhen und den Stabilitätspakt, das private Finanzsystem und einen europäischen Krisenmechanismus betreffen.
Schlüsselwörter
Euro-Bonds, Europäischer Währungsfonds, Europäische Schuldenkrise, Staatsschulden, Währungsunion, Liquiditätsrisiko, Rettungsmaßnahmen, institutionelle Reformen, Finanzstabilität, Risikoaversion.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Euro-Bonds?
Euro-Bonds sind gemeinsame Staatsanleihen der Euro-Staaten, bei denen eine kollektive Haftung für Schulden übernommen wird.
Welche Vorteile bietet ein Europäischer Währungsfonds?
Ein solcher Fonds könnte ein geregeltes Insolvenzverfahren für Staaten ermöglichen und Finanzierungsmechanismen zur Stabilisierung bereitstellen.
Was ist die Hauptkritik an Euro-Bonds?
Kritiker bemängeln falsche Anreize für die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten und die Problematik der gemeinschaftlichen Haftung.
Welche drei Säulen umfasst der neue institutionelle Rahmen für den Euro?
Die Säulen sind ein verschärfter Stabilitätspakt, mehr Stabilität für das private Finanzsystem und ein europäischer Krisenmechanismus.
Wo nahm die europäische Schuldenkrise ihren Anfang?
Die Krise begann in Griechenland und weitete sich auf andere Staaten der Währungsunion aus.
Wer sind Reinhart und Rogoff?
Es handelt sich um renommierte US-Ökonomen, die in ihrem Werk „Dieses Mal ist alles anders“ historische Schuldenkrisen analysiert haben.
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Thomas Rohm (Autor:in), 2011, Euro-Bonds, Europäischer Währungsfonds oder ein neuer institutioneller Rahmen für den Euro-Raum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182954