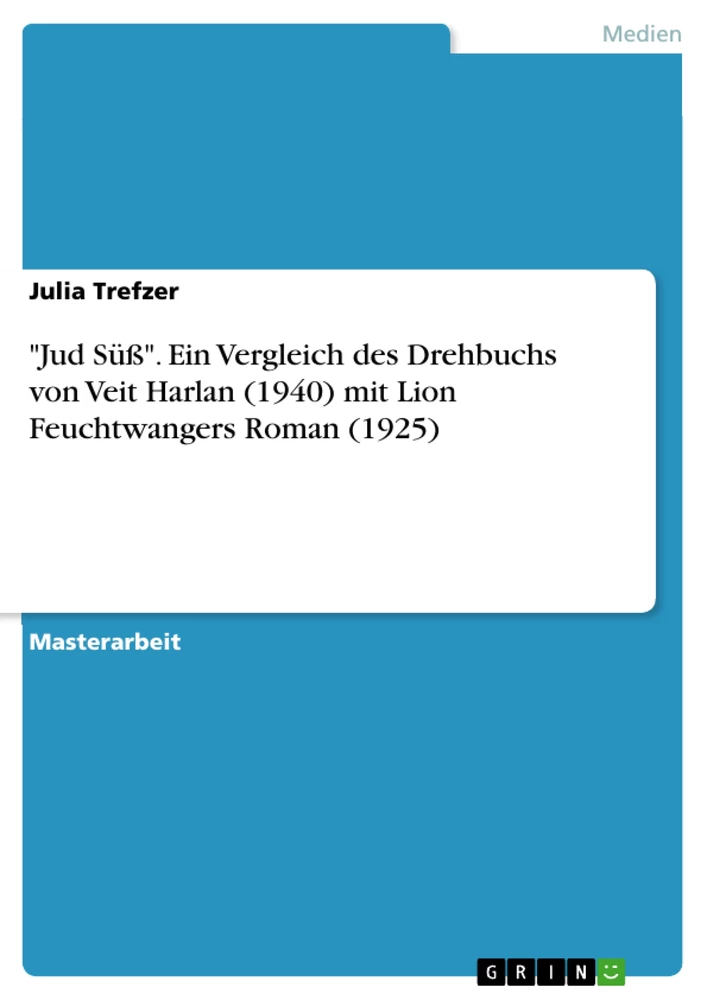Noch immer ist sich die Literaturwissenschaft uneinig, wessen Vorlage der Regisseur Veit Harlan benutzte, um einen internationalen Blockbuster zu produzieren, der mit der nationalsozialistischen Ideologie im Einklang steht. Mit dieser Arbeit soll erstmals die Frage geklärt werden, ob „Feuchtwangers 'Süß' von Harlan buchstäblich ausgeschlachtet wurde.“
Der erste Teil befasst sich mit einem Textvergleich des Romans „Jud Süß“ von Lion Feuchtwanger und des gleichnamigen Drehbuchs von Veit Harlan anhand eines Textvergleichsprogrammes. Sowohl der Roman als auch das Drehbuch liegen als Textdatei vor. Durch ein Computerprogramm soll festgestellt werden, ob der Regisseur vom Autor „abgekupfert“ hat. Davor stellt sich die Frage, ob es eine Software gibt, die in der Lage ist, die Textdatei des Romans mit der des Drehbuchs zu vergleichen und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Dabei wird überprüft, ob es sinnvoll ist, einen solchen Vergleich vorzunehmen.
Im zweiten Teil werden die beiden Werke mittels der Nutzentheorie verglichen. Durch die vergleichende Werkanalyse können empirische Daten erfasst werden. Die formalen Kriterien wie Personen, Personenzahl, Handlungsort, Ort-, Zeit- Personenwechsel und Lebensbereiche bilden die Erhebungseinheiten, die später von Erhebungsbögen abgefragt werden, dabei sind Drehbuch und Roman in ihre kleinste dramatische Einheit, genannt „Situation“, aufgeteilt.
Im dritten Teil geht es um die Frage, ob Harlan anhand der Brechtschen Abbauproduktion als Dieb geistigen Eigentums entlarvt werden kann. Während Bertolt Brecht gegen die faschistische Verfilmung seiner „Dreigroschenoper“ klagte, blieb Feuchtwanger ein Prozess verwehrt. Er konnte lediglich in einem offenen Brief sein Entsetzen über den Film äußern, indem er die Schauspieler direkt ansprach: „ […] wie Sie [gemeint sind die Schauspieler] alle dazu beigetragen haben, die Geschichte jenes Juden, von dem Sie alle wußten, daß er ein großer Mann war, ins genaue Gegenteil zu verkehren.[…]
Bertolt Brecht hingegen lieferte mit dem Essay „Der Dreigroschenprozess“ einen Beitrag zur Filmtheorie. Sein soziologisches Experiment handelt von dem Zerfall eines literarischen Produkts. Er schildert, inwiefern sich das Kunstwerk einem Abbauprozess unterziehen muss, um den Markt zu erreichen. In Anlehnung an dieses Schema wird im dritten Teil aufgezeigt, dass sich Harlan vom Feuchtwanger-Roman die eindrucksvollsten Motive „herauspickte“ und zu einer „spektakulären Schauergeschichte“ abbaute.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- DIE GESCHICHTE DES JOSEPH SÜß OPPENHEIMER
- 1. TEIL: DAS TEXTVERGLEICHSPROGRAMM
- 1. VERGLEICH DER TEXTDATEIEN VON ROMAN UND DREHBUCH
- 2. MATERIAL UND METHODIK
- 3. ERGEBNIS
- 4. DISKUSSION
- 2. TEIL DIE VERGLEICHENDE WERKANALYSE
- I THEORIE: DER NUTZENANSATZ ODER USES AND GRATIFICATIONS APPROACH
- 1. ZIEL DER UNTERSUCHUNG: DEDUKTIVES VORGEHEN
- 2. ERLÄUTERUNG DES NUTZENTHEORETISCHEN ANSATZES
- 3. BEGRÜNDUNG DER ANWENDUNG
- II METHODE: VERFAHREN UND ANWENDUNG DER INHALTSANALYSE
- 1. INHALTSANALYSE NACH BERELSON
- 2. ERKLÄRUNG DER ZÄHLEINHEITEN: ERSTELLUNG DER KATEGORIEN UND DIE ZÄHLEINHEIT „SITUATION“
- 3. AUFBEREITUNG DES UNTERSUCHUNGSMATERIALS
- 4. DIE OPERATIONALISIERUNG
- 4. VARIABLEN
- III AUSWERTUNG UND INTERPRETATION DER DATEN
- IV VARIABLE 1: GRÖßE DER BEZIEHUNGSEINHEIT
- V VARIABLE 2: ANWESENHEIT VON PERSONEN UND GRUPPEN
- VI VARIABLE 3: SCHAUPLÄTZE
- VII VARIABLE 4: ORTSWECHSEL
- VIII VARIABLE 5: ZEITWECHSEL
- IX VARIABLE 6: PERSONENWECHSEL
- X VARIABLE 7: LEBENSBEREICHE
- XI SPEZIELLE AUSWERTUNGEN SÜB
- XI AUSWERTUNG INSGESAMT
- 3. TEIL DIE ABBAUPRODUKTION
- 1. BRECHTS DREIGROSCHENPROZESS
- 2. FEUCHTWANGERS OFFENER BRIEF AN DIE SCHAUSPIELER
- 3. BRECHTS ABBAUPRODUKTION
- 4) MOTIVE, DIE HARLAN ÜBERNOMMEN HAT
- 5. JUD SÜB ALS ANTISEMITISCHER HETZFILM?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Vergleich zwischen Lion Feuchtwangers Roman "Jud Süß" (1925) und Veit Harlans gleichnamigem Drehbuch (1940). Ziel ist es, den Umfang der Übernahme von Elementen aus dem Roman in das Drehbuch zu ermitteln und die Frage nach der Verwendung von Feuchtwangers Werk als Vorlage für Harlans antisemitische Propaganda zu beleuchten. Die Arbeit kombiniert textuelle Analyse mit Methoden der Inhaltsanalyse.
- Textvergleich zwischen Roman und Drehbuch mithilfe von Software
- Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf antisemitische Tendenzen
- Anwendung des Uses-and-Gratifications-Ansatzes zur Erläuterung der Rezeption
- Inhaltsanalyse zur Erfassung von Variablen wie Personen, Schauplätze und Zeit
- Untersuchung der Frage nach Harlans möglicher Schuld und Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den Erfolg von Feuchtwangers Roman "Jud Süß" und die Kontroverse um Harlans Verfilmung beleuchtet. Sie erläutert die wissenschaftliche Fragestellung, ob Harlan Feuchtwangers Werk "buchstäblich ausgeschlachtet" hat und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in einen textvergleichenden und einen werkvergleichenden Teil gliedert.
1. TEIL: DAS TEXTVERGLEICHSPROGRAMM: Dieser Teil beschreibt die Methodik des textlichen Vergleichs von Roman und Drehbuch mittels Software. Es wird eine Marktübersicht über verfügbare Programme gegeben und die gewählte Software (Beyond Compare und Suite Compare) detailliert erklärt. Die Ergebnisse des automatisierten Vergleichs werden dargestellt und diskutiert.
2. TEIL DIE VERGLEICHENDE WERKANALYSE: Dieser umfangreiche Teil der Arbeit wendet den Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Inhaltsanalyse auf Roman und Drehbuch an. Er analysiert verschiedene Variablen wie die Anzahl der auftretenden Personen, deren soziale Gruppenzugehörigkeit und das Verhältnis von Schauplätzen und Zeitsprüngen um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung aufzuzeigen. Die Ergebnisse liefern detaillierte Einblicke in die unterschiedlichen Erzählweisen und die jeweilige Gewichtung von Elementen.
3. TEIL DIE ABBAUPRODUKTION: Dieser Teil beleuchtet den Kontext der Entstehung von Harlans Film, indem er Brechts "Dreigroschenprozess" und Feuchtwangers offenen Brief an die Schauspieler thematisiert. Es werden Motive untersucht, die Harlan möglicherweise aus Feuchtwangers Roman, aber auch aus anderen Quellen übernommen hat, wie z.B. Wilhelm Hauffs Werke oder die Oper Tosca. Der Teil untersucht kritisch, inwieweit Harlans Film als antisemitische Hetzschrift zu bewerten ist.
Schlüsselwörter
Jud Süß, Lion Feuchtwanger, Veit Harlan, Textvergleich, Inhaltsanalyse, Uses and Gratifications, Antisemitismus, Propagandafilm, Nationalsozialismus, Werkvergleich, Filmgeschichte, Literaturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zu "Jud Süß": Ein Vergleich von Roman und Verfilmung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit vergleicht Lion Feuchtwangers Roman "Jud Süß" (1925) mit Veit Harlans gleichnamiger Verfilmung (1940). Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Harlan Elemente aus Feuchtwangers Roman übernahm und ob Harlans Film als antisemitische Propaganda zu werten ist.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert verschiedene Methoden: Ein automatisierter Textvergleich mittels Software (Beyond Compare und Suite Compare) analysiert die Übereinstimmung zwischen Roman und Drehbuch. Zusätzlich wird eine Inhaltsanalyse nach Berelson durchgeführt, die Variablen wie Personen, Schauplätze, Zeit und Handlung untersucht. Der Uses-and-Gratifications-Ansatz hilft, die Rezeption des Films zu verstehen.
Welche Aspekte werden im Textvergleich untersucht?
Der Textvergleich konzentriert sich auf die Übernahme von Elementen aus dem Roman in das Drehbuch. Es werden sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede hinsichtlich des antisemitischen Inhalts analysiert. Die Ergebnisse des automatisierten Vergleichs werden detailliert dargestellt und diskutiert.
Welche Variablen werden in der Inhaltsanalyse betrachtet?
Die Inhaltsanalyse untersucht verschiedene Variablen, um Roman und Drehbuch zu vergleichen: die Größe der Beziehungseinheiten, die Anwesenheit von Personen und Gruppen, Schauplätze, Ortswechsel, Zeitwechsel, Personenwechsel und Lebensbereiche. Die Auswertung dieser Variablen soll Unterschiede in der Erzählweise und der Gewichtung von Elementen aufzeigen.
Welche Rolle spielt der Uses-and-Gratifications-Ansatz?
Der Uses-and-Gratifications-Ansatz dient dazu, die Rezeption von Harlans Film zu erklären und zu verstehen, welche Bedürfnisse und Erwartungen der Film bei seinem Publikum befriedigte.
Wie wird die Frage nach Harlans Schuld und Verantwortung behandelt?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit Harlans Film als antisemitische Hetzschrift zu bewerten ist und welche Motive ihn möglicherweise bei der Adaption von Feuchtwangers Roman leiteten. Dabei werden auch Brechts "Dreigroschenprozess", Feuchtwangers offener Brief an die Schauspieler und mögliche Einflüsse anderer Werke (z.B. Hauff, Tosca) berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Einleitung, Textvergleichsprogramm (inkl. Methodik und Ergebnisse), vergleichende Werkanalyse (mit Inhaltsanalyse und Uses-and-Gratifications-Ansatz) und Abbauproduktion (Kontext der Entstehung des Films und kritische Bewertung des Antisemitismus). Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Jud Süß, Lion Feuchtwanger, Veit Harlan, Textvergleich, Inhaltsanalyse, Uses and Gratifications, Antisemitismus, Propagandafilm, Nationalsozialismus, Werkvergleich, Filmgeschichte, Literaturvergleich.
- Arbeit zitieren
- Julia Trefzer (Autor:in), 2010, "Jud Süß". Ein Vergleich des Drehbuchs von Veit Harlan (1940) mit Lion Feuchtwangers Roman (1925), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182958