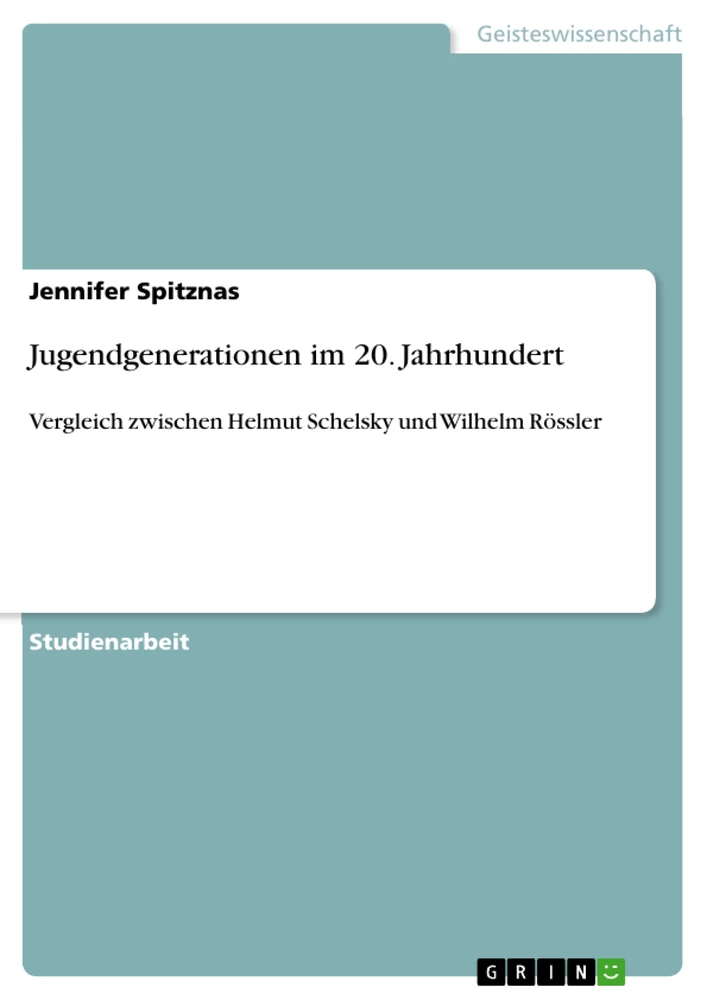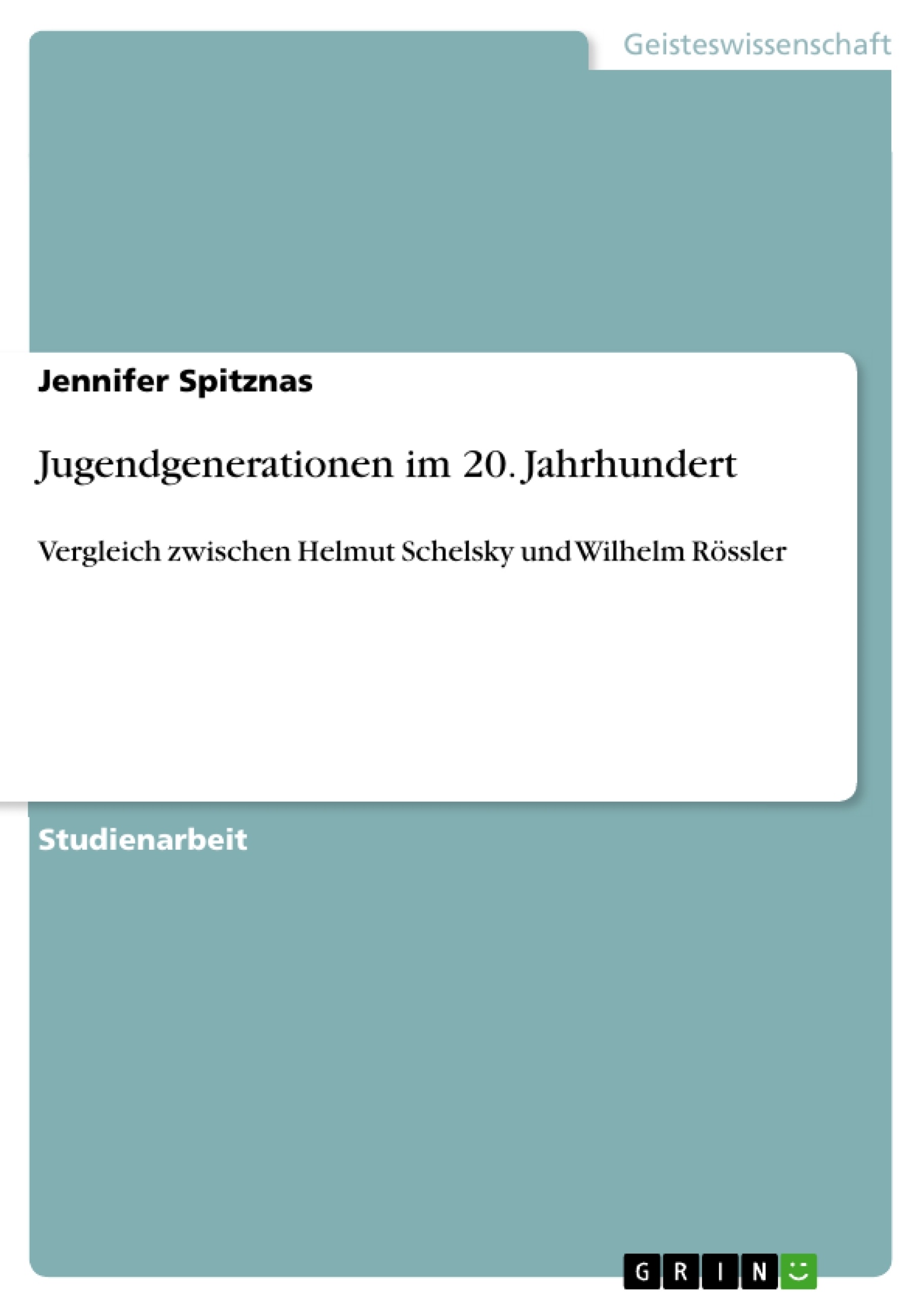I. Einleitung
Die Studie von Helmut Schelsky „Die skeptische Generation“ und die Studie von Wilhelm Roessler „Jugend im Erziehungsfeld“, haben jeweils eine andere Darstellungsweise aus verschiedenen „wissenschaftlichen Räumen“.
Schelsky hat eine soziologische Studie verfasst, in der westdeutsche Jugendliche der Jahre 1945-1955, vor- nehmlich die arbeitenden Jugendlichen, ihm das empirisches Material liefern, verfasst und Roessler einen erziehungswissenschaftlichen Beitrag, in dem er anhand von Selbstzeugnissen besonders die Schüler näher untersucht.
Im Folgenden werde ich zuerst auf die Vorworte bzw. die Einführungen eingehen, um die Ansatzpunkte beider Studien festzuhalten.
Schelsky versucht im Rückgriff auf eine Fülle jugendsoziologischer Studien, anhand des sich da- raus ergebenden Materials, ein Gesamtbild der deutschen Jugend zu erstellen. Er beabsichtigt eine Synthese der empirischen Untersuchungen. Beeinflusst wird seine Arbeit zusätzlich durch viele, von ihm und seinen Mitarbeitern, bereits verfasste Studien. Die Aussagen, die er innerhalb der Stu- die gibt, werden grösstenteils anhand empirischer Ergebnisse belegt.
Jugendkriminalität und -verwahrlosung, sowie das sexuelle Verhalten der Jugendlichen, werden in Schelskys Arbeit ausgelassen oder nur am Rande erwähnt; zum einen aus Gründen des speziellen Themas, welches den Ansatzpunkt des Gesamtbildes verfälschen würde, und zum anderen durch wenig vorhandenes aufschlussreiches empirisches Material.
Pädagogische Aspekte werden bewusst vermieden.
Seine Studie ist eine Analyse der berufstätigen Jugendlichen zwischen 14-25 Jahren. „Weil uns der junge Arbeiter und Angestellte, und nicht der Oberschüler und Hochschüler, die strukturleitende und verhaltensprägende Figur dieser Jugendgeneration darzustellen scheint“. (Schelsky, Helmut: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. 1963. S. 8)
Zeitlich und regional ist die Studie eingeschränkt. Interkultureller Vergleiche der Jugend werden fast gar nicht aufgegriffen, da die Gefahr der Überinterpretation als Außenstehender sehr groß ist.
Daher beschränkt sich die Studie auf die westdeutsche Jugendgeneration.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriff der Jugend
- III. Sozialgeschichtlicher Hintergrund
- 1. Jeunesse dorée
- 2. Die Generation der Jugendbewegung
- 3. Die Generation der politischen Jugend
- 4. Jugend zwischen den Ideologien
- 5. Zusammenbruch der Illusionen
- IV. Die Jugend in Kriegs- und Nachkriegszeit
- V. Die skeptische Generation
- VI. Westdeutsche Jugend der Zeit nach 1945
- VII. Vergleich der beiden dargestellten Jugenden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit vergleicht zwei Studien zur deutschen Jugend im 20. Jahrhundert: Schelskys soziologische Studie „Die skeptische Generation“ und Roesslers erziehungswissenschaftliche Arbeit „Jugend im Erziehungsfeld“. Ziel ist es, die unterschiedlichen methodischen Ansätze und Ergebnisse beider Studien zu analysieren und zu kontrastieren.
- Definition des Begriffs „Jugend“ in soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive
- Sozialgeschichtliche Entwicklung der Jugend im 20. Jahrhundert
- Der Einfluss von Krieg und Nachkriegszeit auf die Jugend
- Vergleich der westdeutschen Jugend in den Studien von Schelsky und Roessler
- Methodische Unterschiede der beiden Studien (empirische vs. erziehungswissenschaftliche Ansätze)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I (Einleitung): Einführung in die Thematik und Vorstellung der beiden zu vergleichenden Studien von Schelsky und Roessler. Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven werden kurz umrissen.
Kapitel II (Begriff der Jugend): Diskussion der verschiedenen Definitionen von Jugend, sowohl in soziologischer als auch in allgemeiner Perspektive. Schelsky betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung, während Roessler die Schwierigkeit einer eindeutigen Alterszuordnung hervorhebt.
Kapitel III (Sozialgeschichtlicher Hintergrund): Dieser Abschnitt behandelt verschiedene Jugendgenerationen des 20. Jahrhunderts, von der „Jeunesse dorée“ bis zum „Zusammenbruch der Illusionen“. Es werden verschiedene soziale und politische Einflüsse auf die Jugend skizziert.
Kapitel IV (Die Jugend in Kriegs- und Nachkriegszeit): Beschreibung der Auswirkungen von Krieg und Nachkriegszeit auf die Jugend. Die sozialen und psychischen Belastungen werden angesprochen.
Kapitel V (Die skeptische Generation): Zusammenfassung der Kernaussagen von Schelskys Studie, fokussiert auf die westdeutsche Jugend der Jahre 1945-1955.
Kapitel VI (Westdeutsche Jugend der Zeit nach 1945): Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse von Roesslers Studie zur westdeutschen Jugend nach 1945, basierend auf Selbstzeugnissen von Schülern.
Schlüsselwörter
Jugendsoziologie, Erziehungswissenschaft, westdeutsche Jugend, 20. Jahrhundert, „Die skeptische Generation“, „Jugend im Erziehungsfeld“, empirische Forschung, Selbstzeugnisse, Sozialgeschichte der Jugend, Jugendbewegungen, Nachkriegsgeneration.
Häufig gestellte Fragen zu Jugendgenerationen im 20. Jahrhundert
Wer war die „skeptische Generation“?
Der Soziologe Helmut Schelsky bezeichnete damit die westdeutsche Jugend zwischen 1945 und 1955, die nach dem Zusammenbruch der NS-Ideologien Misstrauen gegenüber großen politischen Visionen zeigte.
Wie unterschieden sich die Studien von Schelsky und Roessler?
Schelsky verfasste eine soziologische Analyse basierend auf empirischen Daten arbeitender Jugendlicher, während Roessler einen erziehungswissenschaftlichen Ansatz mit Selbstzeugnissen von Schülern verfolgte.
Welche Rolle spielte die Nachkriegszeit für die Jugend?
Die Jugend war geprägt vom „Zusammenbruch der Illusionen“ und den materiellen Belastungen der Trümmerzeit, was zu einer pragmatischen und berufsorientierten Lebenshaltung führte.
Was kennzeichnete die „Generation der Jugendbewegung“?
Diese frühere Generation suchte nach Authentizität und Naturverbundenheit als Gegenentwurf zur industrialisierten Welt des frühen 20. Jahrhunderts.
Warum wurden pädagogische Aspekte in Schelskys Studie vermieden?
Schelsky wollte ein wertfreies soziologisches Gesamtbild der Jugend erstellen, ohne durch pädagogische Zielsetzungen die empirische Analyse zu verzerren.
- Citar trabajo
- Jennifer Spitznas (Autor), 2003, Jugendgenerationen im 20. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183014