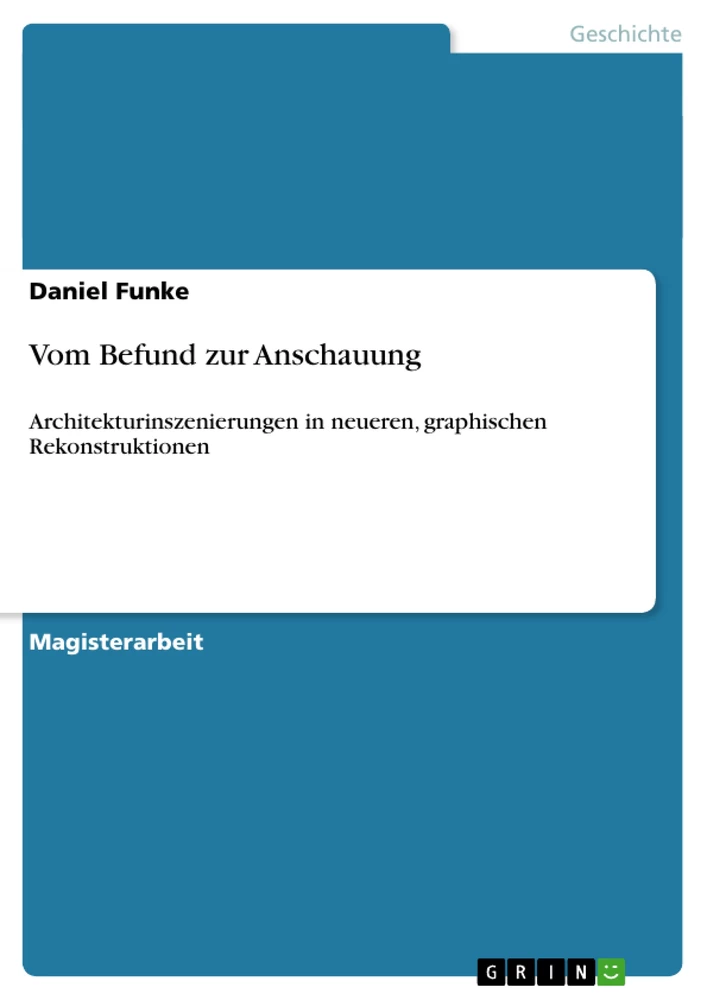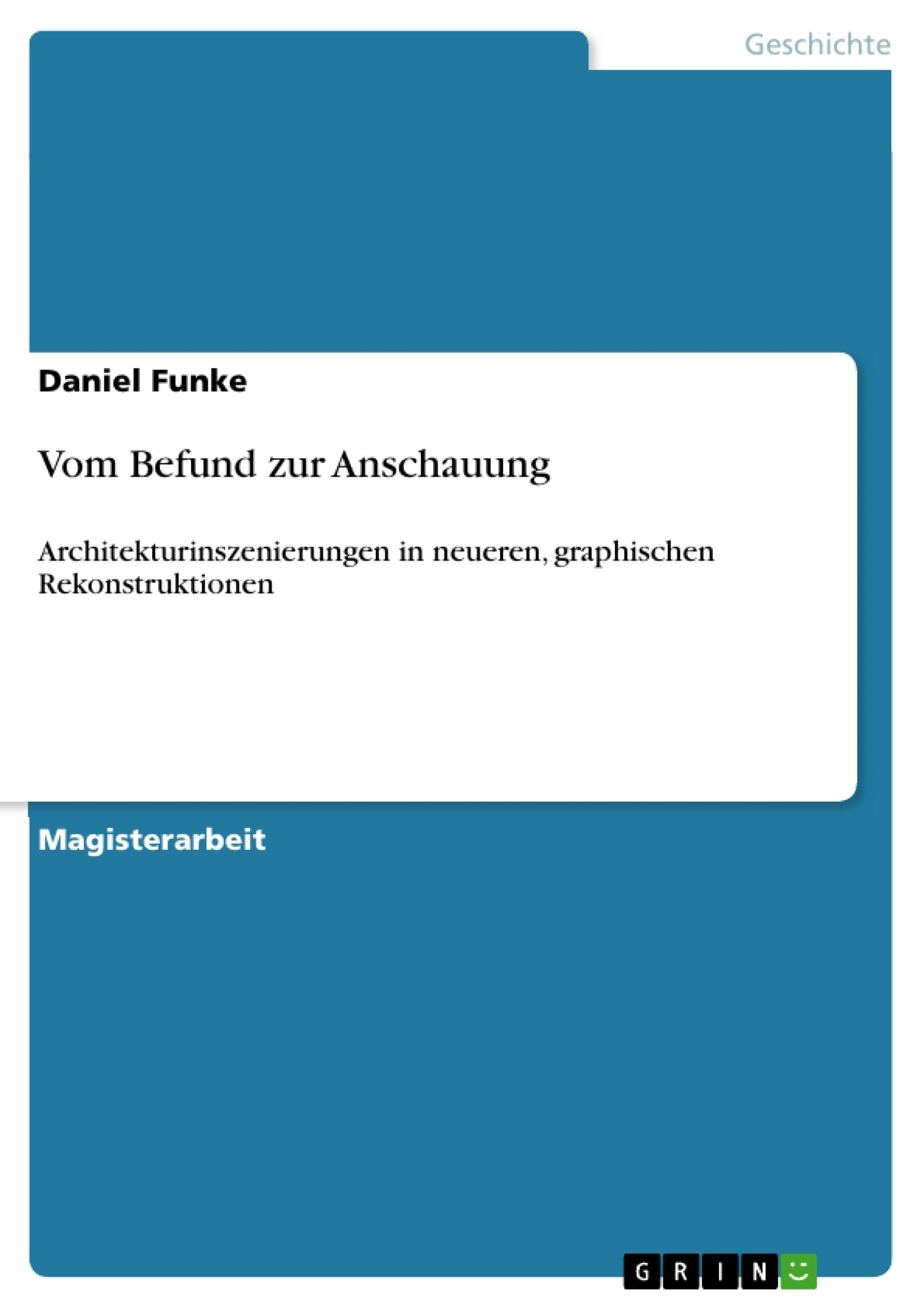Für die graphische Rekonstruktion antiker Architektur steht gegenwärtig ein breites Spektrum an Darstellungsformen zur Verfügung. Es reicht von nüchterner Aufnahme der Grabungsbefunde mit angedeuteten Ergänzungen bis hin zur lückenlos ausgearbeiteten Anschauung; von exakter und präziser Bauzeichnung in der Tradition architektonischer Konstruktionszeichnungen bis hin zu naturalistisch wirkenden Computergraphiken und suggestiven Illustrationen.
Die Vielfalt an Darstellungsformen ist sicherlich als Reaktion auf unterschiedliche Ansprüche zu verstehen, die an sie geknüpft werden. So hat sich innerhalb der archäologischen Fächer eine Tradition von geeigneten Darstellungsformen für die Dokumentation von Befunden und die Kommunikation von Hypothesen entwickelt, die sich stark anlehnt an den Umgang mit Bildformen innerhalb der Fachrichtung der Architektur und im Speziellen der Bauforschung. Die archäologische Dokumentation ist heute geprägt von der nüchternen Sachlichkeit ihrer Bildsprache, von Reduktion, Abstraktion und Normierung der graphischen Mittel. Das Bild und die Bilder, die aus diesem wissenschaftlichen Zugang entstehen, sind gekennzeichnet durch die Lücke und durch den Kontrast zwischen dichter Information und Leerstellen. Dagegen steht das Verlangen eines geschlossenen, erfahrbaren Bildes, dass die Sicht auf das unversehrte Original erlaubt und einen Einblick bietet in den antiken Urzustand in seiner ursprünglichen Lebenswirklichkeit. Die anschauliche Rekonstruktion schließt die Lücke zwischen wissenschaftlich diskreten Informationsbeständen und dem Bedürfnis nach einer geschlossenen Interpretation, dem Wunsch, die überlieferten Baufragmente zu einem „sinnvollen, vielleicht auch ersehnten Ganzen zu vervollständigen“. Den größten Impuls erfuhr die graphische Rekonstruktion von Architektur in den letzten Jahren aus den Möglichkeiten der Visualisierung am Computer.
Die zugrunde liegende Methode der vorliegenden Arbeit ist die Bildanalyse. Die Rekonstruktionszeichnungen werden hinsichtlich der Art ihrer Umsetzung, der graphischen Mittel und Codierungen, der Bildauswahl sowie der veranschaulichten Inhalte untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das technische Bild der Vergangenheit: Befundrekonstruktion
- 2.1 Das technische Bild der Vergangenheit: Befundrekonstruktion
- 2.2 Die archäologische Dokumentation: Befund und Befundergänzung
- 2.3 Die architektonische Trias: Grundrisse, Ansichten und Schnitte
- 2.4 Die didaktische Vermittlung: Axonometrien, Linearperspektiven und Montagen
- 2.5 Der Umgang mit Unsicherheit: Validität
- 3. Das künstlerische Bild der Vergangenheit: Anschauungen
- 3.1 Das Hinzufügen von Kontext: Veranschaulichung und Illustration
- 3.2 Der Bezug zu Ort und Zeit
- 3.3 Die Visualisierung von Funktion: Ausstattung und Inventar
- 3.4 Die Humanisierung des Bildes: Szenarien
- 3.5 Die gestaltete Antike: Modularität
- 4. Das computergestützte Bild der Vergangenheit: CAD-Rekonstruktionen
- 4.1 Die Verwaltung des Mangels: frühe Visualisierungen
- 4.2 Der Siegeszug der Computergraphik: Rekonstruktionen des 21. Jahrhunderts
- 4.3 Ein Schnappschuss der Vergangenheit: Fotorealismus
- 4.4 Die Suche nach Alternativen
- 5. Resumeé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Tendenzen aktueller architektonischer Rekonstruktionen in der Klassischen Archäologie. Im Fokus steht die Frage, wie Architektur in diesen Rekonstruktionen „inszeniert“ wird, unterscheidend zwischen einem „technischen Bild“ (objektiv, präzise) und einer „Anschauung“ (subjektiv, aspekthafte Sicht). Die Analyse konzentriert sich auf die graphischen Mittel und deren Wirkung auf die Rezeption.
- Analyse verschiedener graphischer Darstellungsformen antiker Architektur
- Untersuchung des Spannungsfelds zwischen wissenschaftlichem und künstlerischem Zugang zur Rekonstruktion
- Bewertung der Rolle der Computergraphik in der Architekturvisualisierung
- Auswertung der ästhetischen Wirkung verschiedener Rekonstruktionsmethoden
- Beurteilung der Validität und der Interpretationsspielräume in den Darstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Vielfalt der aktuellen Darstellungsformen. Kapitel 2 beleuchtet das „technische Bild“, die dokumentarische Rekonstruktion archäologischer Befunde. Kapitel 3 widmet sich dem „künstlerischen Bild“, der anschaulichen Rekonstruktion und der Gestaltung von Kontext, Ort, Zeit und Funktion. Kapitel 4 behandelt die computergestützten Rekonstruktionen, von frühen Ansätzen bis hin zum Fotorealismus.
Schlüsselwörter
Architekturrekonstruktion, Klassische Archäologie, Bildanalyse, Computergraphik, Validität, Inszenierung, Technische Rekonstruktion, Künstlerische Anschauung, Antikenrezeption, Medienwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Befund und Anschauung?
Ein Befund ist die sachliche Dokumentation archäologischer Reste. Eine Anschauung hingegen ist eine interpretative Rekonstruktion, die das Gebäude in seinem ursprünglichen Zustand zeigt.
Welche Rolle spielt CAD in der Archäologie?
Computer-Aided Design (CAD) ermöglicht präzise digitale Rekonstruktionen und bildet die Basis für fotorealistische Visualisierungen antiker Architektur.
Was versteht man unter der 'Humanisierung des Bildes'?
Dies beschreibt das Hinzufügen von Menschen, Szenarien und Alltagssituationen in Rekonstruktionen, um die einstige Lebenswirklichkeit erfahrbar zu machen.
Wie geht man mit Unsicherheit bei Rekonstruktionen um?
Die Validität ist ein zentrales Thema: Wissenschaftliche Zeichnungen kennzeichnen Lücken oft klar, während suggestive Grafiken diese oft künstlerisch schließen.
Was ist die 'architektonische Trias'?
In der Bauforschung bezeichnet dies die drei grundlegenden Darstellungsformen: Grundriss, Ansicht und Schnitt.
- Quote paper
- M. A. Daniel Funke (Author), 2010, Vom Befund zur Anschauung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183020