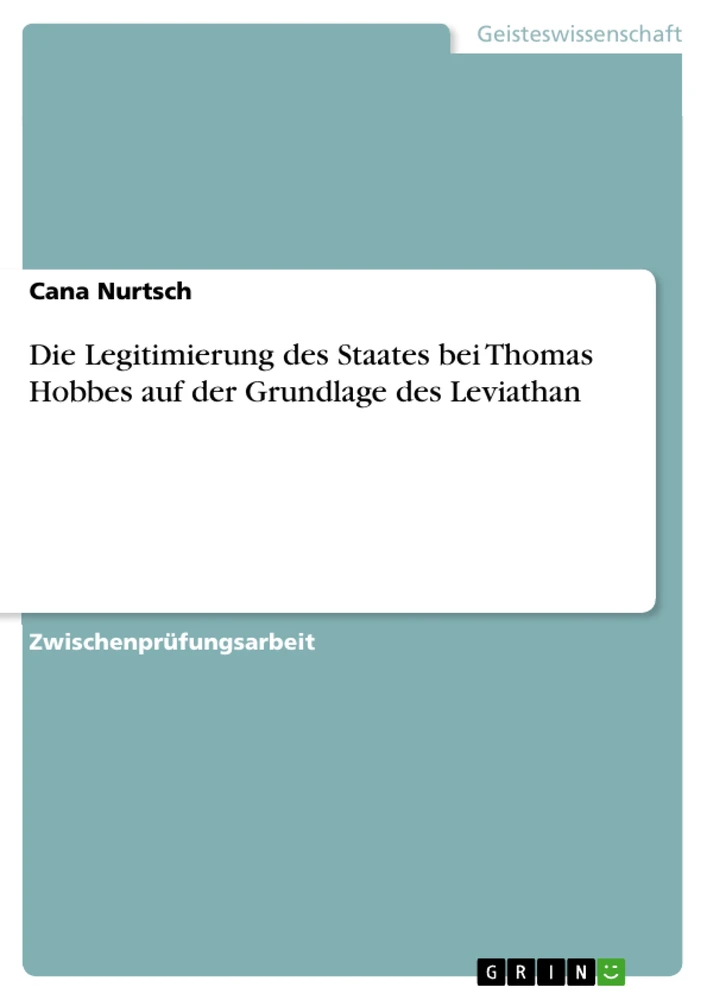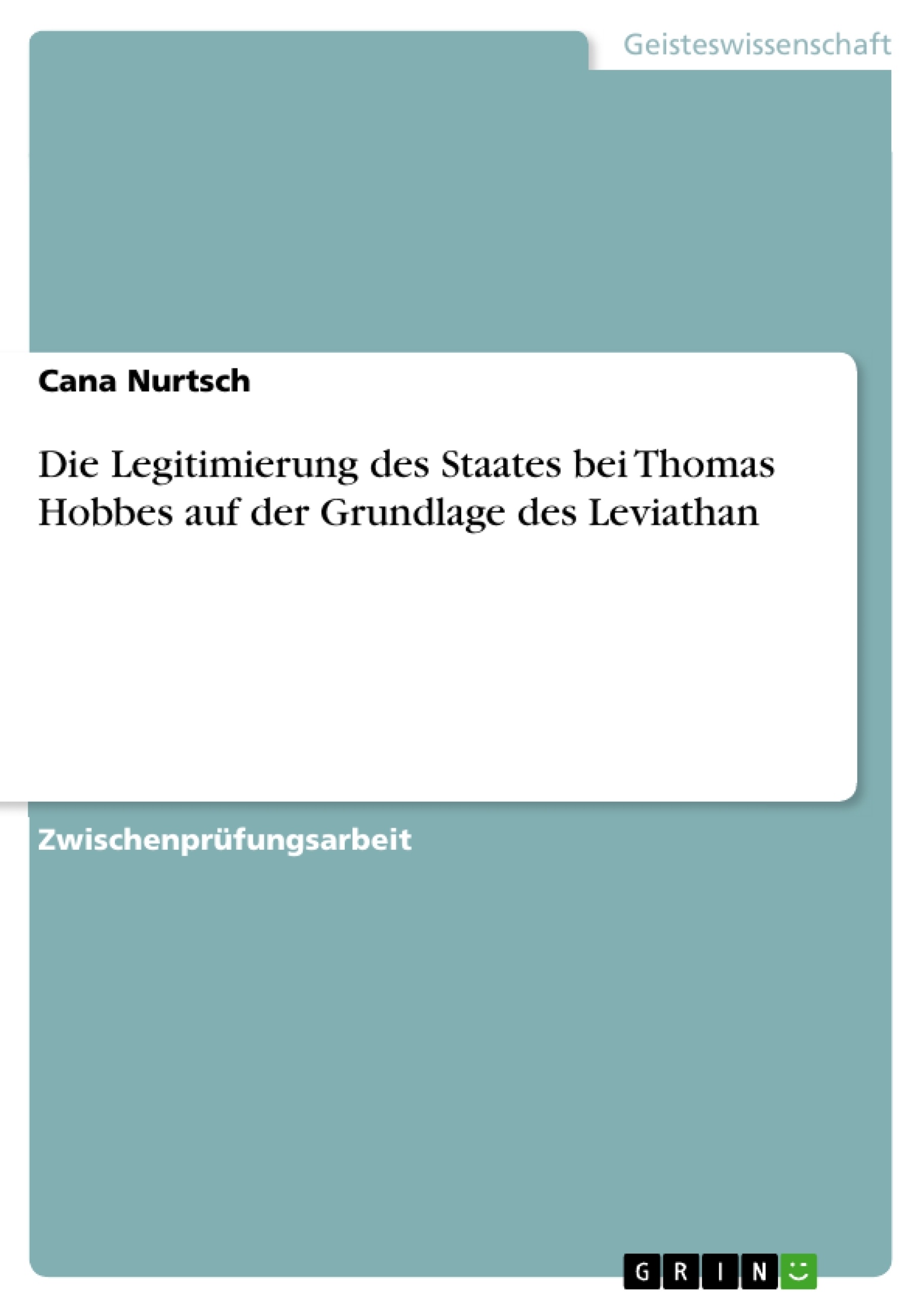Der Engländer Thomas Hobbes (1588-1679) gehört zu den Begründern der neuzeitlichen politischen Philosophie. Angeregt durch die revolutionären Umwälzungen und Bürgerkriege, die er im 17. Jahrhundert beobachten musste, verfasste er 1651 sein Hauptwerk über den Staat, den 'Leviathan'. Der Leviathan ist ein unbesiegbares Ungeheuer der biblischen Mythologie (aus dem Buch Hiob) und symbolisiert bei Hobbes den allmächtigen Staat, dem sich jeder mit bedingungslosem Gehorsam unterwerfen muss.
Das Werk liefert den Beweis der Notwendigkeit des Staates und bildet den Rahmen, in dem später politikphilosophische Denker über Recht und Herrschaft reflektierten. Die Hauptthese des Werkes besagt, dass der Individualismus überwunden werden muss, um ein Gemeinwohl zu erlangen. Dies geschieht durch die Errichtung eines Staates. Im Gegensatz dazu steht die Annahme, dass der "Mensch von Natur aus ein politisches Lebewesen", ein Bürger (zoon politicon), "ist.", auf welche Aristoteles das alteuropäische Politikverständnis begründet. Seine Philosophie bietet keine Begründung der Notwendigkeit des Staates. Der größte Gegensatz besteht jedoch im Verständnis des dann errichteten Staates. Im aristotelischen Modell kommen die Menschen als politische Wesen zu einer großen politischen Gemeinschaft zusammen, sie machen die Politik. Im Hobbesschen Staat gibt es eine klare Trennung von Gesellschaft und Staat; sobald dieser errichtet ist zieht sich der Mensch aus dem politischen Geschehen zurück. Thematisiert wird bei Aristoteles auch die Qualität der Herrschaft, nicht die Existenz einer Herrschaft überhaupt. Hobbes dagegen will vor dem seiner Meinung nach unpolitischen Menschen Herrschaft zunächst einmal rechtfertigen. "Hobbes ersetzt die für den politischen Aristotelismus charakteristische normative Opposition zwischen guter und schlechter Herrschaft durch den fundamentaleren Gegensatz zwischen Anarchie und Herrschaftsordnung."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- mechanisches Weltbild der Neuzeit
- Hobbes und die Vernunft
- rationale Argumentation aus Prinzipien
- Faszination Geometrie
- Hobbes und die Bürgerkriege
- Hauptteil - Der Leviathan
- Formelle Darstellung des Leviathan und argumentative Vorgehensweise
- synthetisch analytisches Prinzip
- Anthropologie Hobbes - Die Natur des Menschen
- Der Naturzustand
- Naturrecht und Naturgesetz
- Der Weg aus dem Naturzustand - 'Vertrag eines jeden mit jedem'
- Der Staat als Notwendigkeit zur vollständigen Überwindung des Naturzustandes
- Die Rechte des Souveräns
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Legitimierung des Staates bei Thomas Hobbes anhand seines Hauptwerks "Leviathan" zu analysieren. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die anthropologischen Grundlagen seiner Argumentation gelegt, sowie auf die Rolle der Vernunft und der mathematischen Methode in seiner politischen Philosophie.
- Die anthropologische Grundlage des Leviathan: Das Naturrecht und die Notwendigkeit des Staates
- Die Rolle der Vernunft und der Mathematik in Hobbes' Philosophie
- Der Einfluss des mechanischen Weltbilds der Neuzeit auf Hobbes' Staatsverständnis
- Der Unterschied zwischen Hobbes' Philosophie und dem aristotelischen Politikverständnis
- Die Bedeutung des Leviathan für die neuzeitliche politische Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt zunächst die Bedeutung des mechanischen Weltbilds der Neuzeit für Hobbes' Philosophie. Anschließend wird die Rolle der Vernunft und der Mathematik in seiner Argumentation erläutert. Abschließend wird der historische Kontext von Hobbes' Werk und dessen Bedeutung für die Entstehung des modernen Staatsgedankens beleuchtet.
Der Hauptteil des Textes befasst sich mit der Analyse des Leviathan. Zunächst wird die formelle Darstellung des Leviathan und Hobbes' argumentative Vorgehensweise erklärt. Anschließend wird seine anthropologische Argumentation, die sich auf die Natur des Menschen und den Naturzustand bezieht, dargestellt. In diesem Zusammenhang werden auch die Begriffe Naturrecht und Naturgesetz erläutert. Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Weg aus dem Naturzustand, der durch den "Vertrag eines jeden mit jedem" ermöglicht wird. Abschließend werden die Notwendigkeit des Staates und die Rechte des Souveräns diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Thomas Hobbes, Leviathan, Naturzustand, Naturrecht, Naturgesetz, Staat, Souverän, Vernunft, Mathematik, mechanisches Weltbild, Politik, Philosophie, Bürgerkriege, Individualismus, Gemeinwohl.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der "Leviathan" bei Thomas Hobbes?
Der Leviathan, ein biblisches Ungeheuer, symbolisiert bei Hobbes den allmächtigen Staat, der geschaffen wird, um Anarchie zu verhindern und Frieden zu sichern.
Wie definiert Hobbes den "Naturzustand"?
Der Naturzustand ist ein hypothetischer Zustand ohne staatliche Ordnung, geprägt durch einen "Krieg eines jeden gegen jeden", in dem das Leben "einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz" ist.
Warum ist der Staat laut Hobbes notwendig?
Der Staat ist notwendig, um den zerstörerischen Individualismus des Naturzustandes zu überwinden und durch einen Gesellschaftsvertrag Sicherheit und Gemeinwohl zu garantieren.
Was unterscheidet Hobbes von Aristoteles?
Während Aristoteles den Menschen als "zoon politikon" (von Natur aus politisches Wesen) sieht, betrachtet Hobbes den Menschen als unpolitisch und muss Herrschaft erst rational rechtfertigen.
Welche Rolle spielt die Mathematik in Hobbes' Philosophie?
Hobbes war fasziniert von der Geometrie und versuchte, seine politische Philosophie auf rationalen, fast mathematischen Prinzipien und einem mechanischen Weltbild aufzubauen.
- Citar trabajo
- Cana Nurtsch (Autor), 2007, Die Legitimierung des Staates bei Thomas Hobbes auf der Grundlage des Leviathan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183039