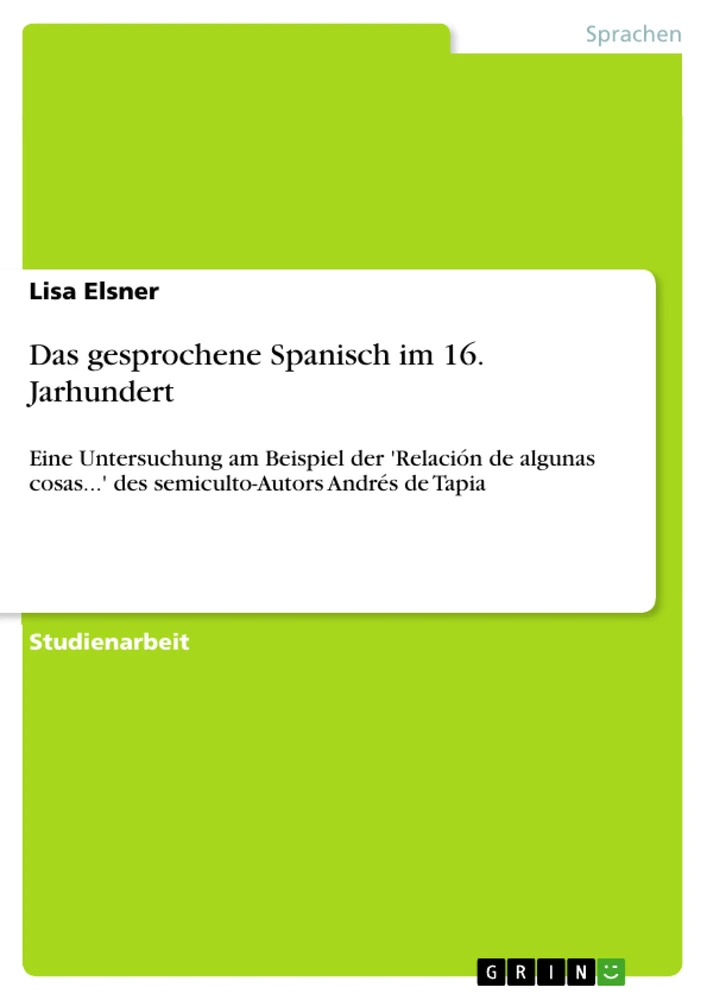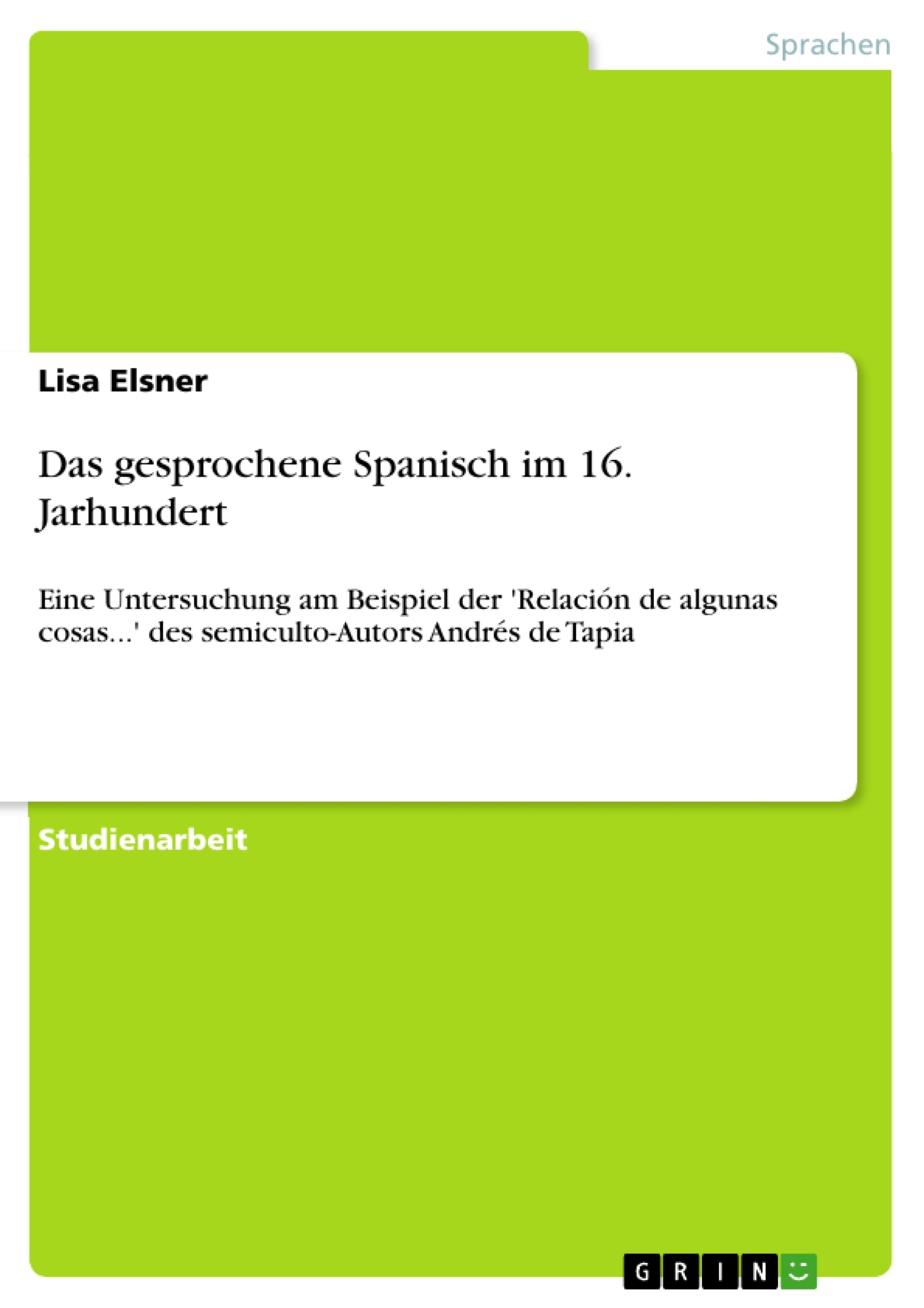Das Ziel dieser Arbeit ist es, dem Beispiel des Teilprojektes B9 folgend, den Stand des gesprochenen Spanisch (‚coloquial’) zur Mitte des 16. Jahrhunderts herauszuarbeiten. Hierzu soll die ‚Relación de algunas cosas de las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don Hernando Cortés, Marques del Valle, desde que se determinó ir á descubrir tierra en la Tierra Firme del Mar Océano’ von Andrés de Tapia, einem semiculto-Autor, auf sprachliche sowie textpragmatische Merkmale des gesprochenen Spanisch untersucht werden.
Vorab sollen jedoch in Kapitel 1 und 2 einige Hintergrundinformationen gegeben werden, die für das weitere Verständnis dieser Arbeit von großer Bedeutung sind. So wird zunächst das von Wulf Oesterreicher sowie Peter Koch entwickelte Modell einer Nähe- und Distanzsprache erläutert. Hier wird festgestellt, dass die von Oesterreicher und Koch so bezeichnete Nähesprache auch unter der Bedingung, dass sie verschriftlicht wird, der gesprochenen Sprache entspricht. Gegeben dieser Voraussetzung kann man sich also auf die Suche nach geeigneten Quelltexten zur diachronen Analyse der gesprochenen Sprache begeben. Dieses stellt allerdings insofern eine Herausforderung dar, als dass die Mehrheit der heute noch erhaltenen historischen Texte literarischer Art sind, die nähesprachlich geprägten Texte hingegen bis auf wenige Ausnahmen nicht-literarischer Art sind.1 In Kapitel 1.2 dieser Arbeit werden wir dann sehen, dass uns dennoch eine Reihe von Möglichkeiten bleiben, die gesprochene Sprache der vergangenen Jahrhunderte anhand nicht-mündlicher, also dementsprechend anhand graphischer Quellen zu analysieren.
In Kapitel 2 werden als erstes die Besonderheiten der kolonialhistorischen Geschichtsschreibung dargestellt, die die Voraussetzung für das Entstehen von semiculto-Werken bilden. Daraufhin werden in Kapitel 2.2 sowie 2.3 das Ideal der Schriftlichkeit und die Diskurstraditionen der damaligen Zeit erläutert, um so im nächsten Kapitel die semiculto-Autoren von den für uns uninteressanten gebildeten Autoren abgrenzen zu können.
In Kapitel 3 werden zunächst Hintergrundinformationen zu dem semiculto-Autor Andrés de Tapia und zu seinem Werk gegeben und im folgenden Teil wird mit der Analyse der nähesprachlich geprägten Merkmale in de Tapias relación begonnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Schriftlichkeit und Mündlichkeit
- 1.1 Nähesprachlich geprägte Schreibkompetenz
- 1.2 Zeugnisse der gesprochenen Sprache in der Geschichte
- 2. Die Besonderheiten der Texte von semiculto-Autoren
- 2.1 Die kolonialhistorische Geschichtsschreibung
- 2.2 Das Ideal der Schriftlichkeit und der Schreibprozess
- 2.3 Die Diskurstraditionen einer relación im 16. Jahrhundert
- 2.4 Der Begriff des semiculto-Autors
- 3. Textanalyse: Die relación von Andrés de Tapia
- 3.1 Über den Autor und sein Werk
- 3.2 Untersuchung der relación auf nähesprachlich geprägte Merkmale
- 3.2.1 Textpragmatische Merkmale
- 3.2.2 Syntaktische Merkmale
- 3.2.3 Semantische Merkmale
- 3.2.4 Morphologische Merkmale
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stand des gesprochenen Spanisch („coloquial“) Mitte des 16. Jahrhunderts anhand der „Relación de algunas cosas de las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don Hernando Cortés, Marques del Valle, desde que se determinó ir á descubrir tierra en la Tierra Firme del Mar Océano“ von Andrés de Tapia. Sie verfolgt das Ziel, nähesprachlich geprägte Merkmale in diesem Text eines semiculto-Autors zu identifizieren und zu analysieren, um so ein besseres Verständnis der gesprochenen Sprache dieser Zeit zu ermöglichen. Die Arbeit baut auf dem Forschungsansatz von Oesterreicher und Koch auf, der die Nähe- und Distanzsprache unterscheidet.
- Nähe- und Distanzsprache im 16. Jahrhundert
- Merkmale nähesprachlich geprägten Schreibens bei semiculto-Autoren
- Analyse der „Relación“ von Andrés de Tapia auf sprachliche Besonderheiten
- Rekonstruktion der gesprochenen Sprache anhand schriftlicher Quellen
- Die kolonialhistorische Geschichtsschreibung und ihre Besonderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rekonstruktion der gesprochenen Sprache vergangener Jahrhunderte ein und erläutert die Herausforderungen und Forschungsansätze dieses Gebiets. Sie hebt die Bedeutung des Projekts „Nähesprachlich geprägtes Schreiben in der Kolonialhistoriographie Hispanoamerikas (1500-1615)“ hervor und beschreibt das Ziel der vorliegenden Arbeit: die Analyse der „Relación“ von Andrés de Tapia zur Rekonstruktion des gesprochenen Spanisch im 16. Jahrhundert.
1. Schriftlichkeit und Mündlichkeit: Dieses Kapitel erläutert das Modell der Nähe- und Distanzsprache von Koch und Oesterreicher. Es differenziert zwischen den Begriffen „Schriftlichkeit“ und „Mündlichkeit“ und ihren medialen und konzeptionellen Aspekten. Anhand von Abbildungen wird das Kontinuum zwischen Nähe- und Distanzsprache veranschaulicht, wobei Faktoren wie Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien berücksichtigt werden. Das Kapitel legt die Grundlage für die Unterscheidung zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten und deren Eignung zur Analyse der gesprochenen Sprache.
2. Die Besonderheiten der Texte von semiculto-Autoren: Kapitel 2 behandelt die Besonderheiten der kolonialhistorischen Geschichtsschreibung als Kontext für das Entstehen von Texten von semiculto-Autoren. Es beleuchtet das Ideal der Schriftlichkeit und die Diskurstraditionen des 16. Jahrhunderts, um den Schreibstil dieser Autoren von dem gebildeter Autoren abzugrenzen. Der Begriff des „semiculto-Autors“ wird definiert und seine Relevanz für die Untersuchung der gesprochenen Sprache begründet. Die Kapitel erläutern den historischen und sprachlichen Kontext für die spätere Textanalyse.
Schlüsselwörter
Nähesprache, Distanzsprache, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, semiculto-Autoren, Kolonialhistoriographie, Relación, Andrés de Tapia, gesprochenes Spanisch, 16. Jahrhundert, Sprachgeschichte, Textanalyse, Textpragmatik, Syntax, Semantik, Morphologie.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Nähesprachlich geprägtes Schreiben in der Kolonialhistoriographie Hispanoamerikas (1500-1615)" - Analyse der Relación von Andrés de Tapia
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rekonstruktion des gesprochenen Spanisch im 16. Jahrhundert anhand der „Relación“ von Andrés de Tapia. Sie analysiert nähesprachlich geprägte Merkmale in diesem Text eines semiculto-Autors, um ein besseres Verständnis der gesprochenen Sprache dieser Zeit zu ermöglichen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Forschungsansatz von Oesterreicher und Koch, der Nähe- und Distanzsprache unterscheidet. Es wird eine detaillierte Textanalyse der „Relación“ durchgeführt, die textpragmatische, syntaktische, semantische und morphologische Merkmale umfasst.
Wer ist Andrés de Tapia und was ist seine „Relación“?
Andrés de Tapia ist ein semiculto-Autor des 16. Jahrhunderts. Seine „Relación de algunas cosas de las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don Hernando Cortés, Marques del Valle, desde que se determinó ir á descubrir tierra en la Tierra Firme del Mar Océano“ ist eine schriftliche Quelle, die Aufschluss über die Sprache dieser Zeit geben soll.
Was sind semiculto-Autoren?
Der Begriff "semiculto-Autor" bezeichnet Autoren, die nicht zur gebildeten Elite gehörten, aber dennoch schreiben konnten. Ihre Texte zeigen oft Merkmale der gesprochenen Sprache, was sie für die sprachhistorische Forschung besonders interessant macht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und einen Schluss mit Schlüsselwörtern. Kapitel 1 behandelt Schriftlichkeit und Mündlichkeit und das Modell von Koch und Oesterreicher. Kapitel 2 fokussiert auf die Besonderheiten der Texte von semiculto-Autoren im Kontext der kolonialhistorischen Geschichtsschreibung. Kapitel 3 analysiert die „Relación“ von Andrés de Tapia hinsichtlich nähesprachlich geprägter Merkmale.
Welche sprachlichen Aspekte werden analysiert?
Die Analyse der „Relación“ umfasst textpragmatische, syntaktische, semantische und morphologische Merkmale. Ziel ist es, Merkmale der gesprochenen Sprache im 16. Jahrhundert zu identifizieren.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die Sprachgeschichte?
Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Rekonstruktion der gesprochenen Sprache des 16. Jahrhunderts. Durch die Analyse der „Relación“ eines semiculto-Autors ermöglicht sie neue Einblicke in die sprachliche Vielfalt und Entwicklung dieser Epoche.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Nähesprache, Distanzsprache, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, semiculto-Autoren, Kolonialhistoriographie, Relación, Andrés de Tapia, gesprochenes Spanisch, 16. Jahrhundert, Sprachgeschichte, Textanalyse, Textpragmatik, Syntax, Semantik und Morphologie.
- Quote paper
- Lisa Elsner (Author), 2010, Das gesprochene Spanisch im 16. Jarhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183111