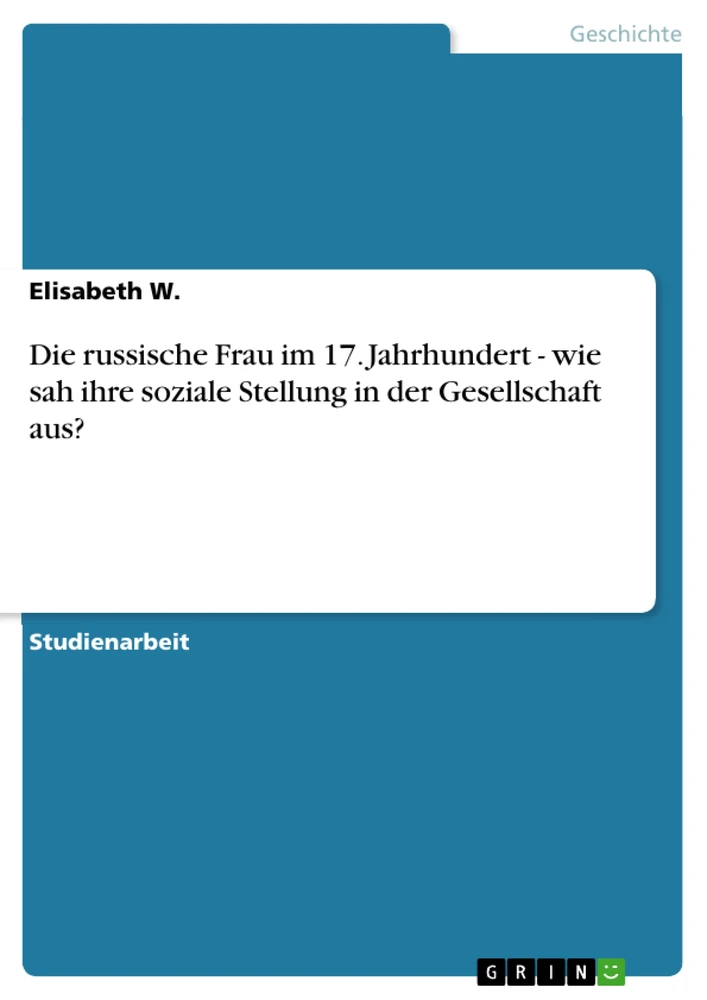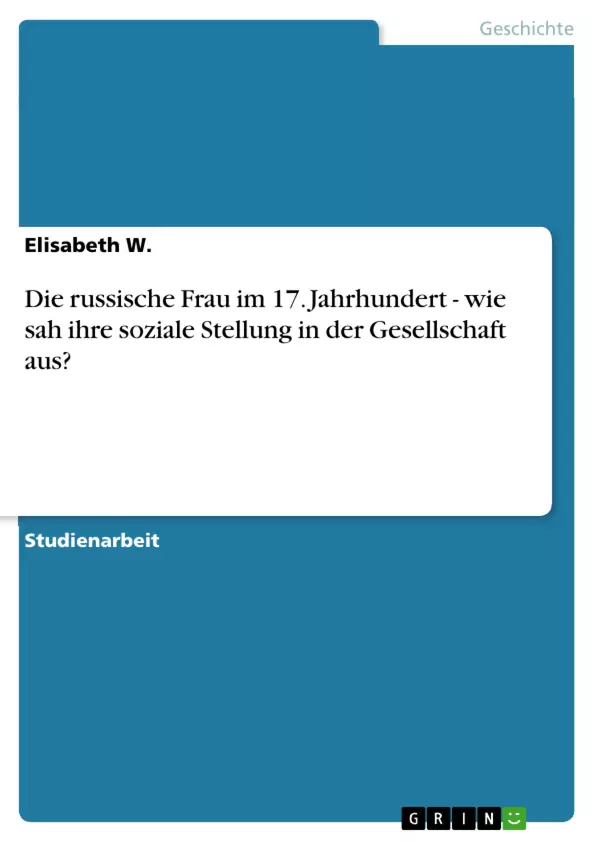In dieser hausarbeit wird die soziale Stellung der russischen Frau im 17. Jahrhundert angesprochen. Diese fragestellung wird anhand der Aspekte Sexualität und Ehe untersucht
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Frau in der Ehe
- 2.1. Berichte europäischer Reisender über die Stellung der Frau in der Ehe
- 2.2. Die Ideale für die Ehe im Domostroj und in der Kirche
- 2.3. Eherealitäten
- 3. Die Sexualität der Frau
- 3.1. Eindrücke europäischer Reisender
- 3.2. Einfluss der Kirche und des Domostrojs auf das Sexualverhalten der Frau
- 3.3. Vergewaltigung der Frau
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stellung der Frau im 17. Jahrhundert in Russland, fokussiert auf die Bereiche Ehe und Sexualität. Ziel ist es, die sozialen Erwartungen an Frauen anhand dieser Aspekte zu beleuchten und die Widersprüche zwischen idealisierten Vorstellungen und der Realität aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Kirche und des Domostrojs auf das Leben der Frauen.
- Die Rolle der Frau in der Ehe im 17. Jahrhundert Russland
- Der Einfluss der Kirche und des Domostrojs auf die Ehe und das Leben der Frau
- Die Widersprüche zwischen den idealisierten Vorstellungen der Ehe und der Realität
- Die Darstellung der weiblichen Sexualität in historischen Quellen
- Die Interpretation historischer Quellen und deren Limitationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, die Stellung der Frau im patriarchalen Russland des 17. Jahrhunderts zu untersuchen. Sie erläutert die Fokussierung auf Ehe und Sexualität als zentrale Aspekte zur Darstellung der sozialen Erwartungen an Frauen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Autorin reflektiert die Herausforderungen der Quellenlage, die hauptsächlich aus Reiseberichten und Werken über die Zeit nach der Oktoberrevolution besteht. Die grundlegenden Themen wie Heirat, Familie und Rechtslage der Frau sind zwar erforscht, doch zentrale Fragen bleiben aufgrund der Quellenknappheit ungeklärt.
2. Die Frau in der Ehe: Dieses Kapitel beleuchtet die Ehe im 17. Jahrhundert in Russland. Es wird deutlich, dass die Kirche die Kontrolle über die Eheschließungen hatte und die Frauen oft schon in jungen Jahren verheiratet wurden, oft ohne eigenes Mitspracherecht. Die Autorin vergleicht die Darstellungen der Ehe in Reiseberichten europäischer Reisender mit den Forschungen von Historikerinnen wie Nada Boškovska, wobei sie auf Widersprüche hinweist. Reiseberichte schildern oft ein Bild von unterdrückten Frauen, eingesperrt im "Terem", während Boškovska die Verwendung des Begriffs "Terem" in diesem Kontext kritisch hinterfragt. Das Kapitel analysiert weiter die Ideale der Ehe im Domostroj, einem Hausbuch mit Regeln für das Zusammenleben, das die Unterordnung der Frau unter den Mann betont. Die Autorin führt Beispiele aus dem Domostroj an, die die erwartungsgemäße Unterwerfung und den Gehorsam der Frau gegenüber ihrem Mann verdeutlichen. Abschließend untersucht das Kapitel die Eherealität anhand von Korrespondenzen adliger Moskoviterinnen, die zeigen, dass Frauen unter bestimmten Umständen durchaus Entscheidungsbefugnis hatten.
Schlüsselwörter
Frau, Ehe, Sexualität, 17. Jahrhundert, Russland, Domostroj, Kirche, Reiseberichte, patriarchale Gesellschaft, soziale Erwartungen, historische Quellen, Eherealitäten, Gewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Stellung der Frau im 17. Jahrhundert in Russland
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Stellung der Frau im 17. Jahrhundert in Russland, mit Fokus auf Ehe und Sexualität. Sie analysiert die sozialen Erwartungen an Frauen in diesen Bereichen und die Widersprüche zwischen idealisierten Vorstellungen und der Realität. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss von Kirche und Domostroj.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter Reiseberichte europäischer Reisender, der Domostroj (ein Hausbuch mit Regeln für das Zusammenleben), Korrespondenzen adliger Moskoviterinnen und Forschungen von Historikerinnen wie Nada Boškovska. Die Autorin thematisiert dabei auch die Herausforderungen und Limitationen der Quellenlage, insbesondere die Knappheit an Quellenmaterial.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Einleitung): Motivation der Autorin, Forschungsfrage, Methoden, Herausforderungen der Quellenlage und Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Die Frau in der Ehe): Stellung der Frau in der Ehe, Vergleich von Reiseberichten und historischen Studien (z.B. Boškovska), Analyse des Domostrojs und Eherealitäten anhand von Korrespondenzen. Kapitel 3 (Die Sexualität der Frau): Darstellungen der weiblichen Sexualität in historischen Quellen, Einfluss von Kirche und Domostroj, Thema Vergewaltigung. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Rolle spielen Kirche und Domostroj?
Kirche und Domostroj werden als maßgebliche Einflussfaktoren auf das Leben der Frauen im 17. Jahrhundert in Russland dargestellt. Die Kirche kontrollierte die Eheschließungen, während der Domostroj die Unterordnung der Frau unter den Mann betonte und eindeutige Regeln für das Zusammenleben vorschrieb. Die Arbeit analysiert, wie diese Ideale die Realität beeinflussten und welche Widersprüche es gab.
Welche Widersprüche werden aufgezeigt?
Die Arbeit deckt Widersprüche zwischen den idealisierten Vorstellungen der Ehe (wie sie im Domostroj und in kirchlichen Schriften dargestellt werden) und der Eherealität auf. Sie zeigt, dass Frauen unter bestimmten Umständen mehr Entscheidungsbefugnis hatten als die idealisierten Vorstellungen vermuten lassen. Auch die unterschiedlichen Darstellungen der weiblichen Lebenswirklichkeit in Reiseberichten und wissenschaftlichen Studien werden kritisch gegenübergestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Frau, Ehe, Sexualität, 17. Jahrhundert, Russland, Domostroj, Kirche, Reiseberichte, patriarchale Gesellschaft, soziale Erwartungen, historische Quellen, Eherealitäten, Gewalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sozialen Erwartungen an Frauen im 17. Jahrhundert in Russland anhand der Aspekte Ehe und Sexualität zu beleuchten. Sie möchte die Widersprüche zwischen idealisierten Vorstellungen und der Realität aufzeigen und den Einfluss von Kirche und Domostroj auf das Leben der Frauen analysieren.
- Quote paper
- Elisabeth W. (Author), 2011, Die russische Frau im 17. Jahrhundert - wie sah ihre soziale Stellung in der Gesellschaft aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183219