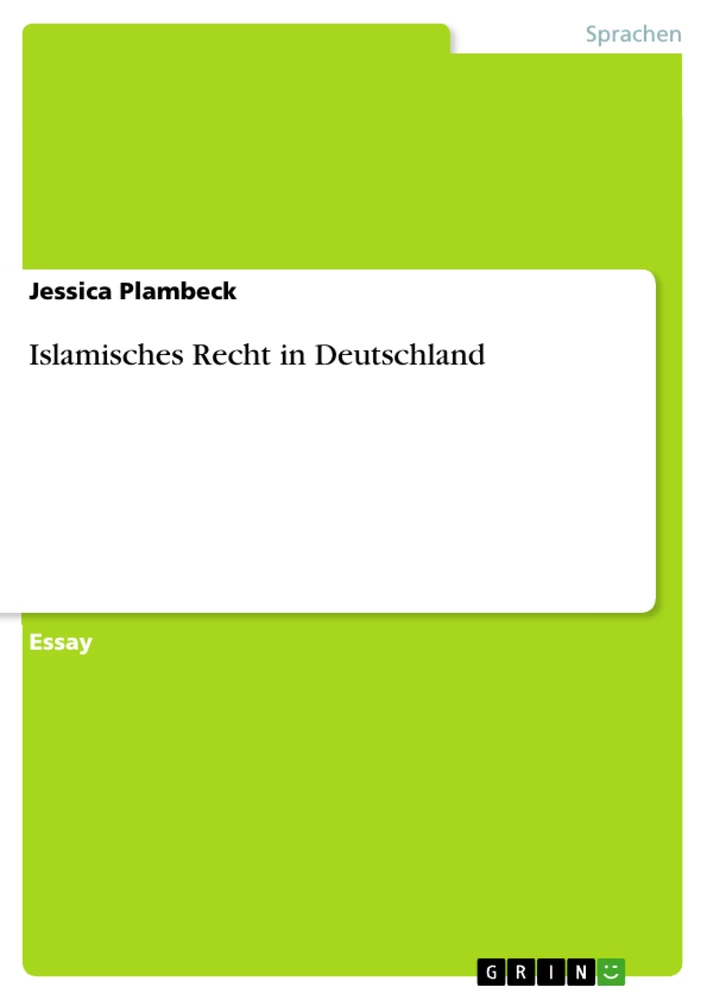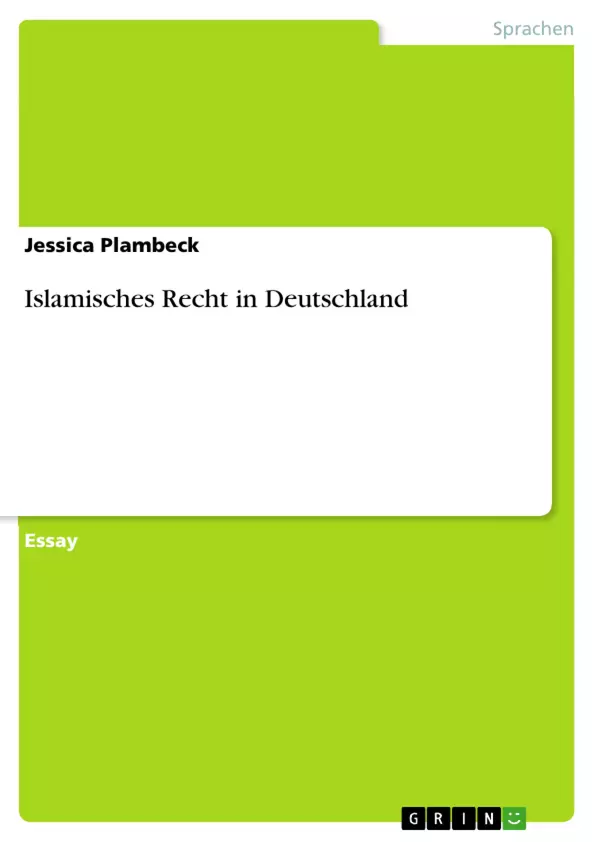Derzeit ist der Islam die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Deutschland, gleich nach dem Christentum. Dies ist in erster Linie eine Folge aus der Arbeitermigration, welche Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre stattfand. Sowohl die Migranten als auch Deutschland als Aufnahmeland sahen den Aufenthalt der Muslime als vorübergehend an. Daher beschäftigte man sich anfangs kaum mit dem Thema der Integration der Gastarbeiter in die deutsche Gesellschaft. Das Verhalten der Zuwanderer änderte sich jedoch Anfang der siebziger Jahre drastisch dadurch, dass die Familien in den Migrationsprozess mit einbezogen wurden. Die Anwesenheit der Familie sowie die damit zusammenhängende schwindende Aussicht auf Rückkehr in das Heimatland hatten eine Wandlung des Verhaltens der Migranten zur Folge. Die Beständigkeit des Aufenthaltes weckte im religiösen Bereich das Bedürfnis nach Einrichtungen, in denen man gemeinsam religiöse Pflichten erfüllen und den hier aufwachsenden Kindern die eigene religiöse und kulturelle Identität vermitteln konnte. Heutzutage ist es so, dass besonders bei der jüngeren, hier geborenen und aufgewachsenen Generation ein gesteigertes Interesse am Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft besteht, um zum Ausdruck zu bringen, dass man sich diesem neuen Heimatland mehr verbunden fühlt, als dem Heimatland der Eltern. Trotz der vorhandenen Integrationsbereitschaft möchte man dennoch nicht auf die Ausübung der Religion und an die Bindung derselbigen verzichten.
Das Problem, mit dem die in der Diaspora lebenden Muslime konfrontiert sind, ist sich einerseits an die Souveränität des Staates, in dem sie leben und andererseits an die Ge- und Verbote ihrer Religion zu halten, wobei es in einigen Fällen zu Unvereinbarkeiten kommen kann. Die freiwillige dauerhafte Ansiedlung von Muslimen in Europa und damit außerhalb der islamischen Welt stellt in der Dimension, wie wir sie heute vorfinden, eine völlig neue Situation dar. In diesem Essay soll die Frage behandelt werden, ob es für einen Muslim, der sich der Scharia verpflichtet fühlt, möglich ist, in unserem deutschen Rechtssystem zu leben und sich an die geltenden Rechtsnormen zu halten ohne damit gegen die für ihn nach islamischem Recht geltenden Rechtsnormen und seine religiösen Überzeugungen zu verstoßen. Es soll erläutert werden, in welchen Bereichen es zu Unvereinbarkeiten oder Schwierigkeiten zwischen deutschem und islamischem Recht kommen kann und inwiefern es möglich ist, [...]
Inhaltsverzeichnis
- Islamisches Recht in Deutschland
- Integration und Religionsausübung
- Scharia: Ibadat und Muamalat
- Verfassungsrechtlicher Rahmen und Religionsfreiheit
- Präzedenzfälle und islamische Rechtsauffassungen
- Konflikte zwischen deutschem und islamischem Recht
- Schächten von Tieren
- Familienrecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Vereinbarkeit von islamischem Recht (Scharia) und deutschem Rechtssystem. Es wird analysiert, inwieweit Muslime in Deutschland ihre religiösen Pflichten erfüllen können, ohne gegen deutsche Gesetze zu verstoßen. Ein Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen individuellen religiösen Pflichten (Ibadat) und staatlichen Rechtsnormen (Muamalat) im islamischen Recht.
- Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle der Scharia im Leben von Muslimen in Deutschland
- Konflikte zwischen deutschem und islamischem Recht im Alltag
- Verfassungsrechtliche Garantien der Religionsfreiheit in Deutschland
- Differenzierte islamische Rechtsauffassungen und ihre Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit der Darstellung der wachsenden muslimischen Gemeinschaft in Deutschland und deren Integrationsbemühungen. Es wird die Entwicklung von der anfänglichen Gastarbeitermigration hin zur dauerhaften Ansiedlung und dem Wunsch nach religiösen Einrichtungen beleuchtet. Anschließend wird die Problematik der Vereinbarkeit von deutscher und islamischer Rechtsordnung thematisiert, wobei die Unterscheidung zwischen Ibadat und Muamalat im Zentrum steht. Es wird dargelegt, wie die deutsche Verfassung die Religionsfreiheit gewährleistet und wie diese im Kontext des islamischen Rechts zu verstehen ist. Der Essay verweist auf historische und aktuelle Beispiele, um die unterschiedlichen Interpretationen des islamischen Rechts und deren Auswirkungen auf die Praxis in Deutschland zu verdeutlichen.
Im weiteren Verlauf werden konkrete Beispiele für potenzielle Konflikte zwischen deutschem und islamischem Recht vorgestellt, wie beispielsweise das Schächten von Tieren und Fragen des Familienrechts. Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen innerhalb des Islams werden beleuchtet, und es wird diskutiert, wie diese Vielfältigkeit die Suche nach Kompromissen beeinflusst.
Schlüsselwörter
Islamisches Recht, Scharia, Ibadat, Muamalat, Integration, Religionsfreiheit, Deutschland, deutsches Rechtssystem, Grundgesetz, Konflikt, Tierschutzgesetz, Familienrecht, Igtihad, Rechtspluralismus.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Scharia mit dem deutschen Recht vereinbar?
Der Essay untersucht, ob Muslime ihre religiösen Pflichten (Ibadat) erfüllen können, während sie gleichzeitig die staatlichen Rechtsnormen (Muamalat) Deutschlands respektieren.
Was ist der Unterschied zwischen Ibadat und Muamalat?
Ibadat bezieht sich auf die individuellen gottesdienstlichen Handlungen, während Muamalat die zwischenmenschlichen und rechtlichen Beziehungen regelt, die oft mit staatlichem Recht kollidieren können.
Welche Konflikte gibt es zwischen islamischem und deutschem Recht?
Häufige Konfliktfelder sind das Schächten von Tieren (Tierschutzgesetz) sowie Fragen des Familienrechts (z. B. Scheidungsrecht oder Sorgerecht).
Wie schützt das Grundgesetz die Religionsausübung von Muslimen?
Die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit garantiert das Recht auf ungestörte Religionsausübung, stößt jedoch an Grenzen, wenn andere Grundrechte oder Gesetze verletzt werden.
Warum ist das Thema Integration heute relevanter als früher?
Früher galt der Aufenthalt als vorübergehend (Gastarbeiter). Heute leben Muslime dauerhaft in Deutschland und suchen nach Wegen, ihre religiöse Identität im neuen Heimatland zu wahren.
- Arbeit zitieren
- Jessica Plambeck (Autor:in), 2006, Islamisches Recht in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183239