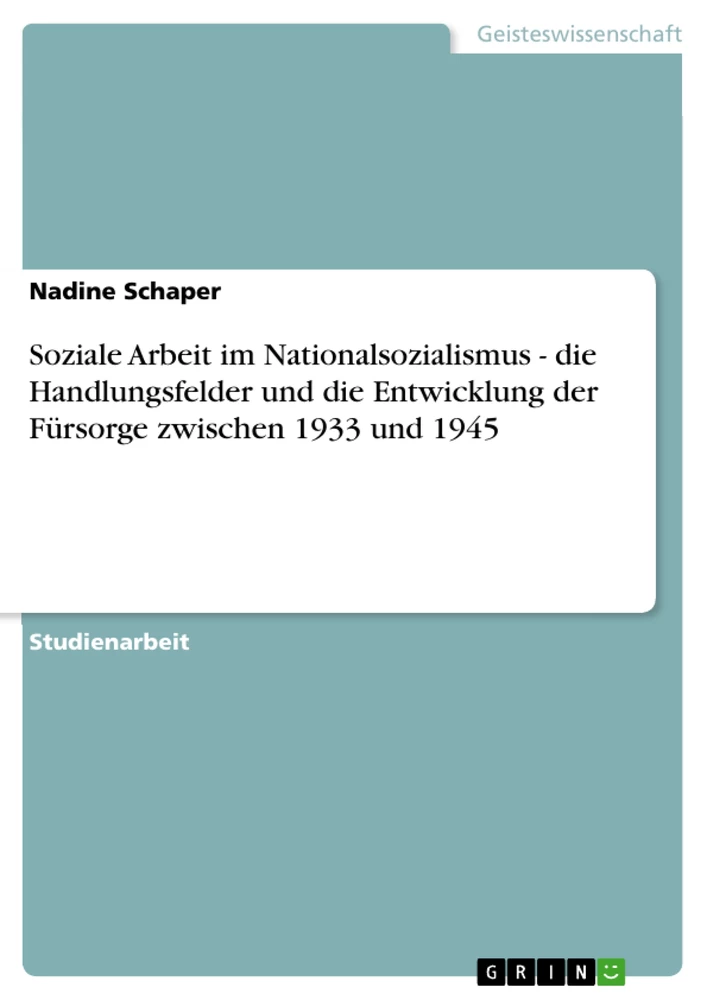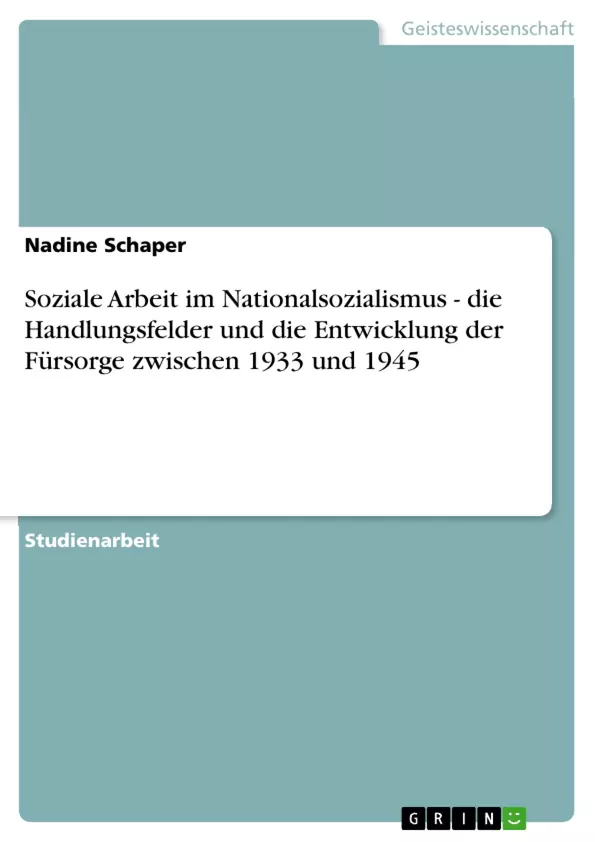„Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 beginnt eine Epoche, in der alle bisherigen Reformbewegungen der Sozialen Arbeit zunichte gemacht wurden, und das Fürsorge- bzw. Wohlfahrtswesen unter der Vorherrschaft der Nationalsozialisten vereinheitlicht bzw. im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie instrumentalisiert wurde.“ (Puch 10.04.2011, www.pantucek.de S.19)
Um das Thema zu diskutieren, wie sich Soziale Arbeit (SA) in den Jahren des Nationalsozialismus (die Zeit der Diktatur der Nationalsozialisten unter Hitler von 1933 bis 1945) entwickelt hat, müssen zunächst einige Begrifflichkeiten geklärt werden. Was ist SA und wie definiert sie sich? Laut der International Federation of Social Workers (IFSW) soll die heutige Profession Soziale Arbeit
sozialen Wandel, Problemlösungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und Befreiung von Menschen zur Verbesserung ihres Wohlbefindens fördern. Gestützt auf wissenschaftliche Kenntnisse über menschliches Verhalten und soziale Systeme greift SA überall dort ein, wo
Menschen und ihre Umwelt aufeinander einwirken. Grundlage der SA sind die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit. (vgl. Schilling 2007, S.208). Betrachtet man diese Definition, wirkt die anfängliche erläuterte Thematik – grade in diesem Kontext – schlicht provokant. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird jedoch eine „neue Fürsorge“ definiert, die primär dem Nutzen der „Volksgemeinschaft“ und des „Volkskörpers“ zu dienen hat.(vgl. Engelke u.a. 2009, S.296). Im Folgenden wird dies am Beispiel einzelner Handlungsfelder dargestellt und auf die Entwicklung sozialer Berufe während der Diktatur eingegangen. Um den
Sachverhalt möglichst komplex darzustellen, sind sowohl der geschichtliche Hintergrund, als auch Widerstände im Bereich der Sozialen Arbeit Inhalt dieser Hausarbeit. Begriffe und Redewendungen, die der diskriminierenden und ausgrenzenden „Sprache des Dritten Reiches“ (Lingua tertii imperii)1 entstammen oder in dem Zusammenhang eine andere Bedeutunghaben, werden übernommen und in Anführungszeichen gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung mit Begriffsklärung
- 2. Geschichtlicher Hintergrund
- 3. Von der Fürsorge zur Volkspflege
- 4. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
- 5. Handlungsfelder Sozialer Arbeit
- 5.1 Der Umgang mit „Asozialen“
- 5.2 Behinderte und psychisch kranke Menschen
- 5.3 Die Jugendwohlfahrt
- 5.4 Hitlerjugend (HJ) und Bund Deutscher Mädel (BDM)
- 5.5 Das Jugendstrafrecht
- 6. Die Entwicklung sozialer Berufe
- 7. Widerstände
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus (1933-1945). Sie beleuchtet die Transformation des Fürsorgewesens unter der nationalsozialistischen Ideologie und die Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit zum Nutzen der „Volksgemeinschaft“. Die Arbeit analysiert die Veränderungen in den Handlungsfeldern und die Entwicklung sozialer Berufe während dieser Zeit.
- Transformation des Fürsorgewesens unter nationalsozialistischer Herrschaft
- Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus
- Der Umgang mit „Asozialen“, Behinderten und psychisch Kranken
- Entwicklung der Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe
- Entwicklung sozialer Berufe im Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Klärung zentraler Begriffe wie Soziale Arbeit und deren Definition im Kontext des Nationalsozialismus im Gegensatz zur heutigen Definition. Kapitel 2: Beschreibung der sozialen und wirtschaftlichen Situation in Deutschland um 1930, inklusive des bestehenden Sozialversicherungssystems und der freien Wohlfahrtspflege. Kapitel 3: Darstellung der Transformation der Fürsorge zur „Volkspflege“ und die damit verbundene Ausgrenzung und Liquidierung von „gemeinschaftsschädlichen“ Menschen.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Nationalsozialismus, Fürsorge, Volkspflege, „Asoziale“, Behinderte, psychisch Kranke, Jugendwohlfahrt, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Jugendstrafrecht, Rassenhygiene, Volksgemeinschaft, „Volkskörper“, Zwangssterilisation.
- Arbeit zitieren
- Nadine Schaper (Autor:in), 2011, Soziale Arbeit im Nationalsozialismus - die Handlungsfelder und die Entwicklung der Fürsorge zwischen 1933 und 1945, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183248