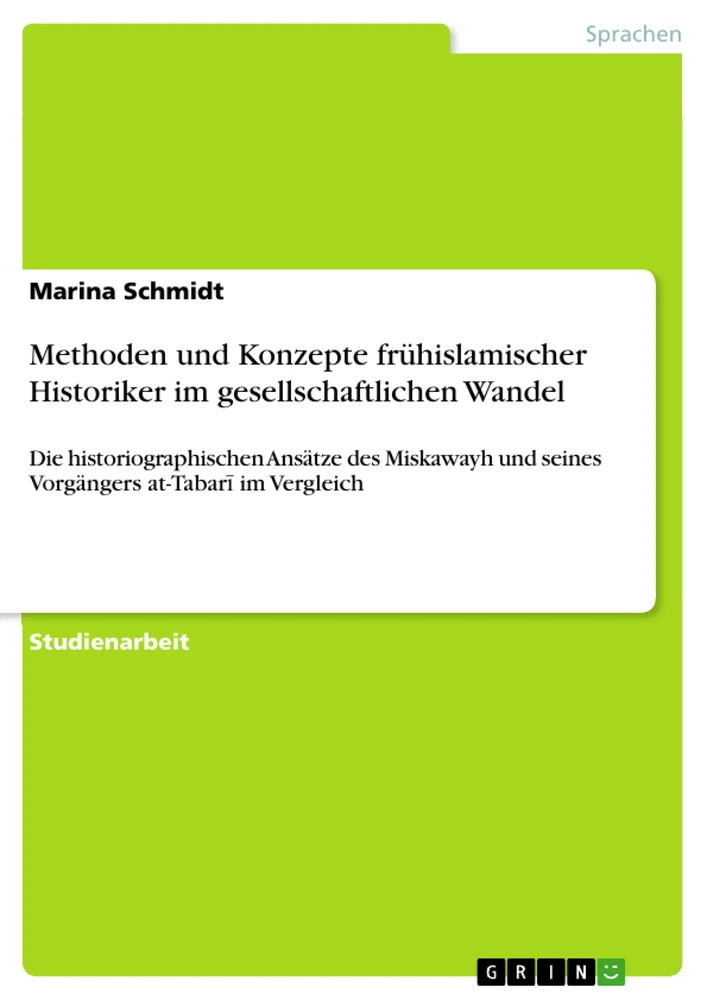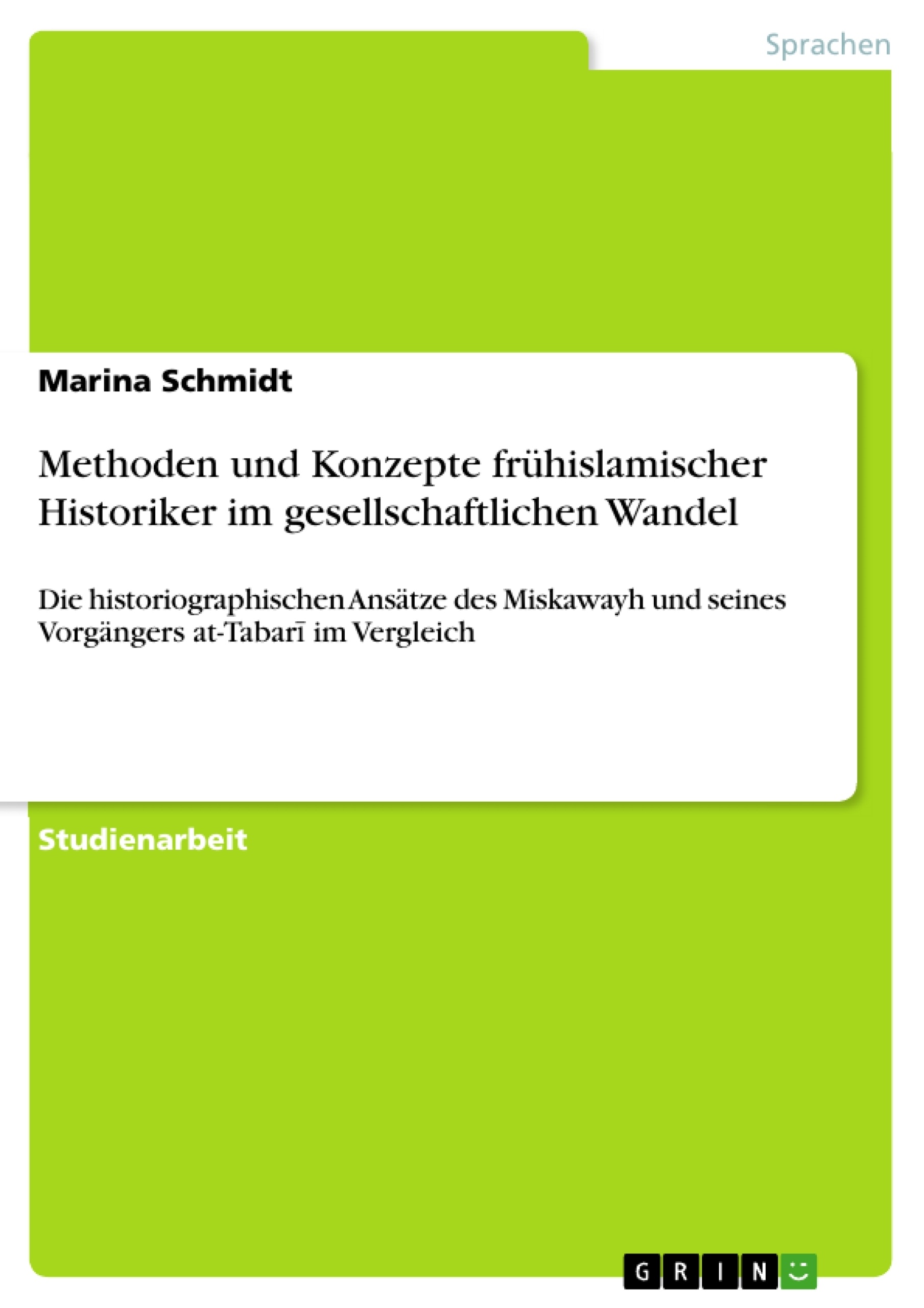Das Forschungsfeld der frühislamischen Historiographie gilt vielen IslamwissenschaftlerInnen als eine Disziplin, deren Quellenlage so umstritten ist,dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Dokumenten, die aus der Zeit ab ca. dem 8./9. Jh. n.Chr. stammen, nur von vergleichsweise wenigen Wissenschaftlern in Angriff genommen wurde.
Dabei erschließt die Beschäftigung mit frühislamischen
Geschichtsbänden und besonders deren Verfassern weit tiefer greifende
Zusammenhänge als lediglich historische Ereignisse längst vergangener Zeiten – sie
zeichnet auch den Fortgang der islamischen Geistesgeschichte nach und gibt über die
Entwicklung wichtiger Felder wie Philosophie, Literatur und Politik Aufschluss. Um diese Wertigkeit soll es in dieser Arbeit gehen.
Um einen
tieferen Einblick in die beginnende Geschichtsschreibung und das intellektuelle
Milieu dieser Zeit zu erlangen, möchte ich mich nach einer zusammenfassenden
Einführung in die Entwicklung der frühislamischen Geschichtsschreibung mit zwei
Historikern dieser Zeit befassen: Auf der einen Seite soll es um Abū Ğ‘afar
Muhammad b. Ğarīr b. Yazīd at-Tabarī gehen, dessen unumstritten als herausragend
anerkanntes Werk ebenso wie eine kurze Biografie vorgestellt werden sollen.
Zweitens werde ich mich mit dem etwas weniger bekannten Abū ‘Alī Ahmad b.
Muhammad b. Ya‘qūb Miskawayh befassen, den ich, ebenso wie seinen Vorgänger
at-Tabarī, anhand seines Werkes und einer Biografie vorstellen werde. Anschließend
möchte ich die Konzeption der beiden Historiker vergleichen.
Geprüft werden soll in dieser Untersuchung auch die Ansicht, dass der
heilsgeschichtliche Ansatz das wissenschaftliche Interesse an Geschichte und der
Sammlung und Aufbereitung historischer Informationen in der frühislamischen Zeit
überwog.
Des Weiteren ist die europäische Wissenschaft größtenteils
sehr darum bemüht, islamische Historiographie in Kategorien wie „modern“,
„fortschrittlich“ oder „rückständig“ einzuordnen. Um nicht in das Muster dieses
Ansatzes zu verfallen, soll die vorliegende Arbeit auch einen Blick in die
Originalwerke der vorgestellten Autoren selbst werfen, statt sich gänzlich auf die
Kommentierung durch die zur Verfügung stehenden Standardwerke zu verlassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung: Die frühislamische Historiographie
- Anfänge der frühislamischen Historiographie bis zum 11. Jh. n.Chr.
- Leben und Wirken des at-Tabarī
- Leben und Wirken des Miskawayh
- Gesellschaftliche Verortung beider Autoren
- Quellenarbeit: Strukturen frühislamischer Geschichtswerke
- Miskawayhs Vorwort zu Tağārib al-umam
- Miskawayhs Methodik
- At-Tabarīs Vorwort zu Ta'rīh al-rusul wa'l-mulūk wa'l-hulafā'
- At-Tabarīs Methodik
- Schlussfolgerungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der frühen islamischen Historiographie und analysiert die Ansätze von zwei prominenten Historikern, at-Tabarī und Miskawayh. Sie untersucht die Motive und Konzepte dieser Autoren im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und beleuchtet die Entwicklung der islamischen Geistesgeschichte.
- Entwicklung der frühislamischen Historiographie
- Biographie und Werke von at-Tabarī und Miskawayh
- Vergleich der historiographischen Ansätze beider Autoren
- Einfluss des heilsgeschichtlichen Ansatzes auf die frühislamische Historiographie
- Rezeption der islamischen Historiographie in der europäischen Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Forschungsfeld der frühislamischen Historiographie vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Geschichtswerken dieser Zeit für die islamische Geistesgeschichte. Sie skizziert die Zielsetzung und Methodik der Arbeit, wobei insbesondere auf die Analyse der Werke von at-Tabarī und Miskawayh fokussiert wird.
- Einführung: Die frühislamische Historiographie: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der islamischen Historiographie bis zum 11. Jh. n.Chr. und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Genres. Dabei werden die soziologischen Ursachen, die zur Entstehung einer historiographischen Tradition führten, sowie die Bedeutung der mündlichen Überlieferung und die zunehmende Bedeutung schriftlicher Chroniken in der islamischen Gemeinde diskutiert.
- Quellenarbeit: Strukturen frühislamischer Geschichtswerke: Dieses Kapitel untersucht die Strukturen der Geschichtswerke von at-Tabarī und Miskawayh und analysiert die Vorworte und Methodik beider Autoren. Es wird gezeigt, wie die Autoren mit Quellen umgehen und wie ihre Ansätze zur Geschichtsschreibung geprägt sind.
Schlüsselwörter
Frühislamische Historiographie, at-Tabarī, Miskawayh, Ta'rīh al-rusul wa'l-mulūk wa'l-hulafā', Tağārib al-umam, heilsgeschichtlicher Ansatz, islamische Geistesgeschichte, gesellschaftlicher Wandel, Quellenkritik, Methodik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war at-Tabarī?
Ein herausragender frühislamischer Historiker des 9./10. Jahrhunderts, bekannt für sein monumentales Werk "Geschichte der Propheten und Könige".
Worin unterscheidet sich Miskawayh von at-Tabarī?
Während at-Tabarī stark heilsgeschichtlich und chronistisch arbeitete, verfolgte Miskawayh einen eher philosophischen und pragmatischen Ansatz in seinem Werk "Die Erfahrungen der Völker".
Was ist ein "heilsgeschichtlicher Ansatz"?
Ein Ansatz, der historische Ereignisse primär als Wirken Gottes und Teil eines göttlichen Plans zur Rettung der Menschheit interpretiert.
Warum ist die Quellenlage der frühislamischen Zeit umstritten?
Viele Berichte basieren auf mündlichen Überlieferungen (Hadithen), deren Authentizität von der modernen Wissenschaft kritisch hinterfragt wird.
Welchen Wert hat die frühislamische Historiographie heute?
Sie gibt Aufschluss über die Entwicklung von Philosophie, Politik und Literatur und zeichnet den Fortgang der islamischen Geistesgeschichte nach.
- Quote paper
- Marina Schmidt (Author), 2010, Methoden und Konzepte frühislamischer Historiker im gesellschaftlichen Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183253