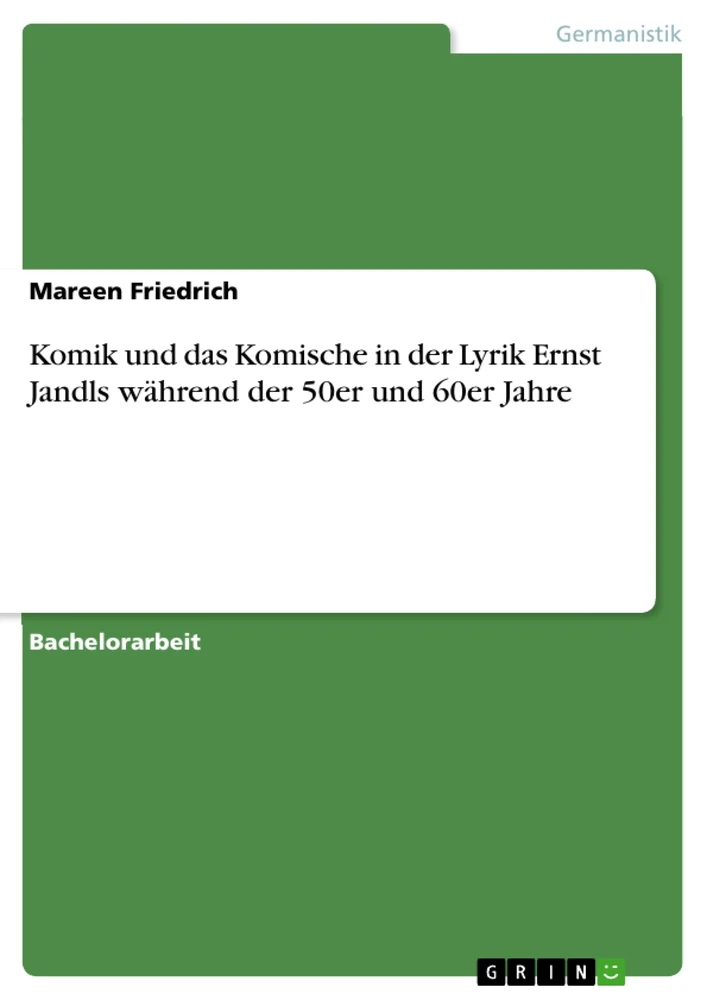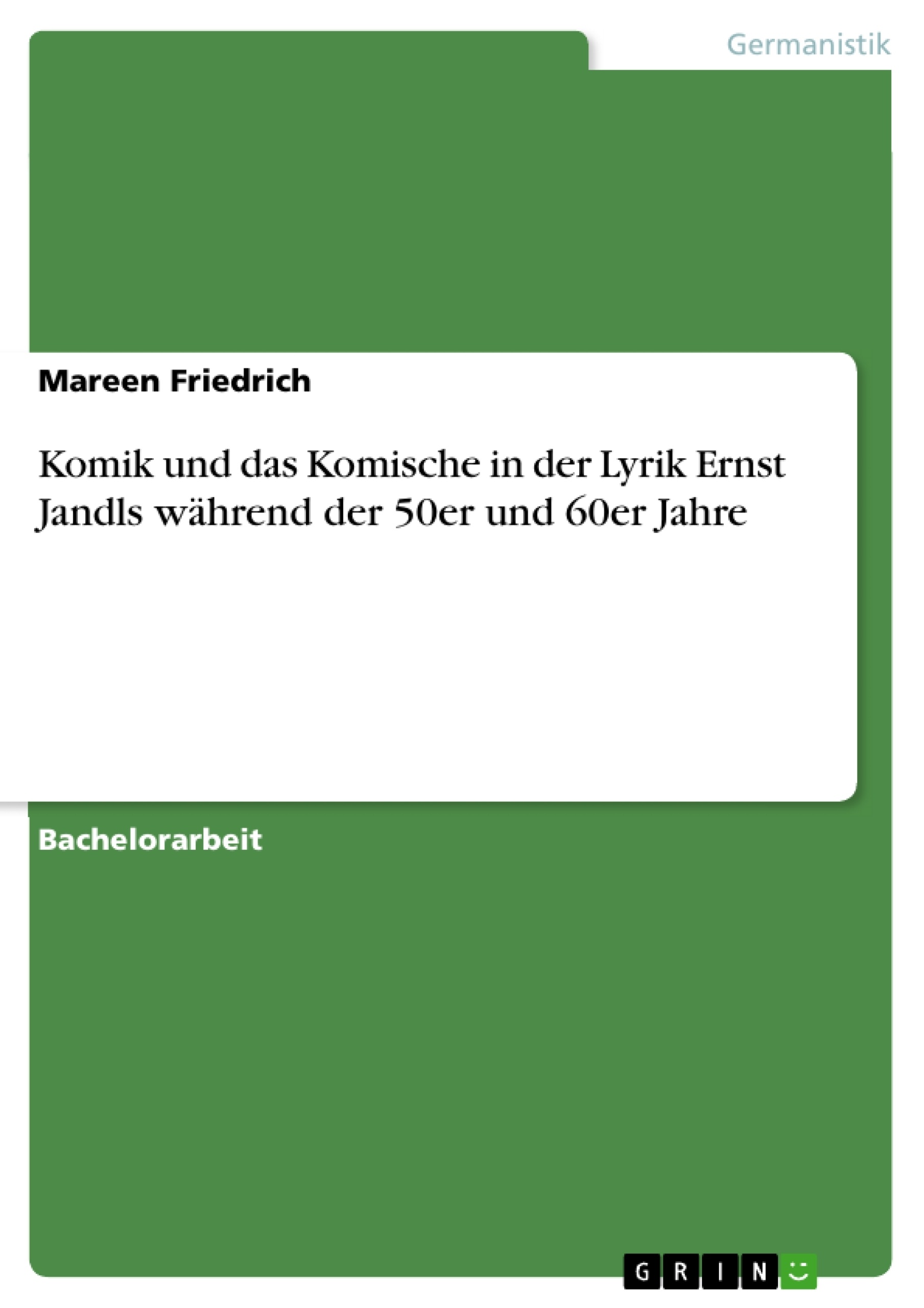Der aus Wien stammende Dichter Ernst Jandl (1925 – 2000) ist bekannt für ein experimentelles Spiel mit Form und Sprache, womit er das Publikum überraschte und sowohl vom Schweigen zum Lachen als auch vom Lachen zum Schweigen brachte.
Diese Arbeit zeigt, welche Rolle die Komik in der Lyrik Ernst Jandls spielt, wie sie eingesetzt wird und welche Reaktionen sie erzielt. Wann wird bei uns lachen ausgelöst, wenn wir Gedichte Jandls lesen? Welche Formen des Komischen werden eingesetzt oder verknüpft, um den Rezipienten zu erreichen?
Nach einem notwendigen Überblick über die Geschichte und den Gegenstand des Komischen in der Sprache werden an ausgewählten Beispielen die Formen des Komischen nachgewiesen. Dazu bieten sich Jandls Gedichte aus den 50er und 60er Jahren an.
Die Gedichte "falamaleikum" (1958), "wien : heldenplatz" (1963), "fünfter sein" (1968) und "loch" (1964)werden dabei genauer betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- him hanfang war das wort: Einleitung
- tohuwabohu: Methoden das Komische zu erforschen
- toobaba: Ein theoretischer Überblick
- tohuwaababa: Jandl mit und über Komik
- wo bleibb da: Formen der Komik am Beispiel
- hummoooa: Ironie, Satire, Zynismus und das Naive
- famalaleikum (1958)
- wien: heldenplatz (1962)
- hummmoooooa: Sinn, Unsinn, Assoziation, obszöner Witz
- fünfter sein (1968)
- loch (1964)
- hummoooa: Ironie, Satire, Zynismus und das Naive
- luslustigtig: Verflechtung des Komischen in Jandls Sprache
- k uns t: Formebene
- vünv vrösche: Wortschöpfung und Grammatik
- lieber tee: Semantik
- krims krams: Rezeption des Komischen
- ssso: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der Komik in der Lyrik Ernst Jandls, analysiert deren Einsatz und die damit verbundenen Reaktionen. Im Zentrum stehen die Frage, welche Formen des Komischen in seinen Gedichten vorkommen und wie diese den Leser erreichen.
- Analyse der Formen des Komischen in Jandls Lyrik
- Untersuchung der Wirkung der Komik auf den Rezipienten
- Erläuterung der sprachlichen Mittel, die Jandl zur Erzeugung des Komischen einsetzt
- Bedeutung der Komik im Kontext der 50er und 60er Jahre
- Rezeption des Komischen in Jandls Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Komik in Jandls Werk und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 führt in die Theorie des Komischen ein und gibt einen Überblick über verschiedene Theorien und Definitionen. Das dritte Kapitel untersucht verschiedene Formen des Komischen anhand ausgewählter Gedichte aus den 50er und 60er Jahren. Kapitel 4 konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel, die Jandl zur Erzeugung des Komischen einsetzt. Der Fokus liegt dabei auf der Formebene, Wortschöpfung und Grammatik sowie der Semantik. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rezeption des Komischen in Jandls Werk.
Schlüsselwörter
Komik, Humor, Ironie, Satire, Zynismus, Sprache, Lyrik, Ernst Jandl, Laut und Luise, Sprechblasen, Sprachspiel, Rezeption, 50er Jahre, 60er Jahre.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Lyrik von Ernst Jandl aus?
Jandl ist bekannt für seine experimentelle Lautpoesie, Sprachspiele und den kreativen Umgang mit Grammatik und Wortschöpfungen.
Welche Formen der Komik nutzt Jandl in seinen Gedichten?
Er verwendet Ironie, Satire, Zynismus, das Naive sowie das Spiel mit Sinn und Unsinn und assoziative Witze.
Was ist das Besondere am Gedicht „wien : heldenplatz“?
In diesem Gedicht nutzt Jandl lautmalerische Mittel und Sprachzertrümmerung, um die Atmosphäre und die historische Last des Ortes satirisch und kritisch darzustellen.
Wie reagiert das Publikum auf Jandls komische Lyrik?
Die Reaktionen reichen von befreiendem Lachen über Überraschung bis hin zu nachdenklichem Schweigen, da die Komik oft einen ernsten oder gesellschaftskritischen Kern hat.
Welche sprachlichen Mittel setzt Jandl zur Erzeugung von Humor ein?
Dazu gehören die bewusste Falschschreibung, Lautmalerei (Onomatopoesie), die semantische Verschiebung und das Spiel mit der visuellen Form der Gedichte.
- Quote paper
- B.A. Mareen Friedrich (Author), 2011, Komik und das Komische in der Lyrik Ernst Jandls während der 50er und 60er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183255