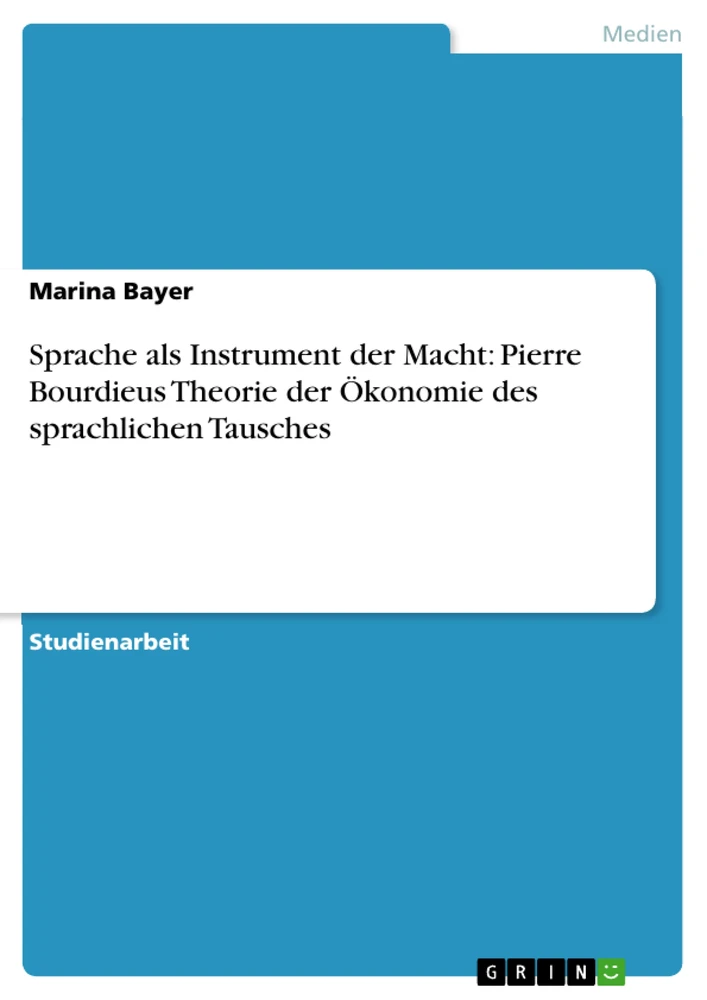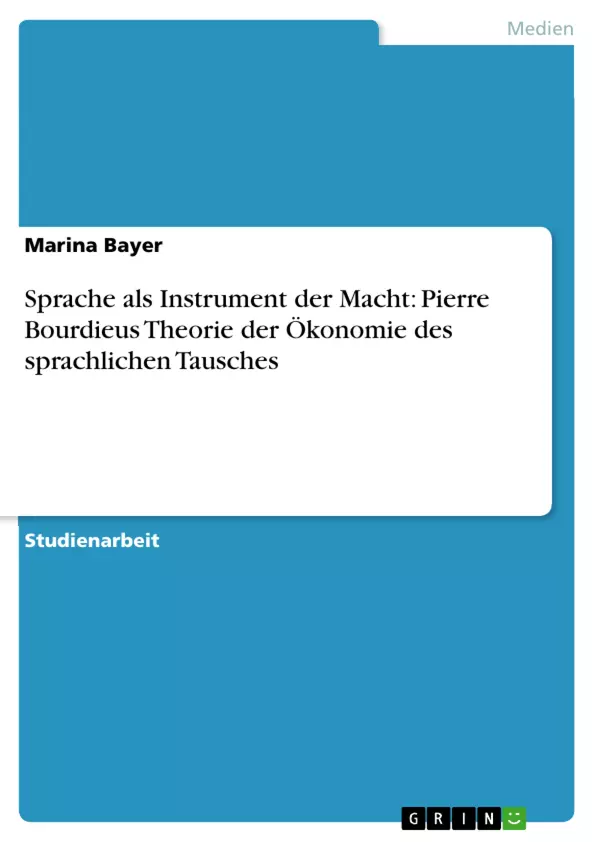Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Theorie der „Ökonomie des Sprachlichen
Tausches“ des Soziologen Pierre Bourdieu. In seinen Aufsätzen und Schriften zu diesem
Thema stellt der Wissenschaftler heraus, dass Sprache nicht bloß ein Mittel zu
Kommunikation sei, wenn sie es denn überhaupt sei, sondern vielmehr Instrument sozialen
Handelns, sowie Mittel zu Herrschaft. Er interessiert sich dabei besonders für die Frage,
woraus die Wirkung von Sprache resultiert und wie und warum es einzelnen Akteuren in der
nächsten Instanz somit möglich ist, die soziale Welt direkt zu beeinflussen und reale
Wirkungen hervorzubringen. Die Zauberei, die darin liegt, mit Sprache soziale Praxis direkt
zu gestalten, nennt Bourdieu in Anlehnung an den durch Austin geprägten Begriff;
performative Magie. Mit seiner Analyse performativer Magie wendet Bourdieus sich dabei
gegen jene Sprachanalytikern, welche die Wirkung von Sprache in einer innersprachlichen
Logik zu finden glauben. Bourdieu stellt in seinen Analysen dem hingegen heraus, dass die
Macht von Sprache in den sozialen Bedingungen ihrer Produktion und Reproduktion,
verborgen liege. In der klassenspezifischen Verteilung von Kenntnis und Anerkenntnis der
legitimen Sprache.
Im Zentrum der Theorie steht dabei Bourdieus so genanntes Habituskonzept. Für ein
Verständnis des bourdieuschen Performativitätskonzeptes ist es daher notwendig, die für
dieses Konzept relevanten Begrifflichkeiten einzuführen; sozialer Raum, Habitus, sowie die
verschiedenen Kapitalformen, die von den Akteuren zur Machtdurchsetzung genutzt werden.
Im zweiten Teil soll sodann die Ökonomie des Sprachlichen Tausches dargestellt werden,
beginnend mit der Kritik Bourdieus an der strukturalen Sprachwissenschaft, und endend mit
der Antwort Bourdieus, nach der Macht von Sprache. Sie sei letztlich nur im Glauben der
sozialen Akteure begründet; auf deren Anerkennung autorisierter Sprache und Diskurse sowie
der Kompetenz der Sprechenden als legitim. Die performative Kraft der Wörter sei nicht in
einer innersprachlichen Logik zu finden, sondern liege in der Anerkennung der Macht der
Institution und der solchermaßen Sprechenden, durch jene die sich dieser ausgeliefert
glauben. Im Schlusskapitel werden sodann die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln
zusammengeführt und der Frage auf den Grund gegangen, worin Bourdieus Beitrag zur
Kommunikationswissenschaft liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der soziologischen Theorie Pierre Bourdieus
- Der Akteur im sozialen Raum
- Der Habitus-Begriff
- Formen des Kapitals
- Alltägliche Machtkämpfe um das herrschende Herrschaftsprinzip
- Von der Illusion der Chancengleichheit
- Sprache: Ausdruck von Macht und Mittel zur Machtdurchsetzung
- Bourdieus Abgrenzung von der strukturalistischen Sprachwissenschaft
- Vom sprachlichen Habitus und sprachlichen Markt
- Erwerbsbedingungen
- Anwendungsbedingungen
- Über offizielle Märkte, legitime Sprache und die Macht des Wortes
- Sprache und symbolische Macht
- Performative Macht und die Macht der Institution
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Pierre Bourdieus Theorie der „Ökonomie des Sprachlichen Tausches“. Dabei wird herausgestellt, dass Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern auch ein Instrument sozialen Handelns und der Herrschaft. Die Arbeit untersucht, wie Sprache soziale Wirkungen hervorbringt und wie soziale Akteure die soziale Welt durch Sprache beeinflussen können.
- Bourdieus Habitus-Konzept und dessen Bedeutung für die Analyse der Sprache
- Die Rolle des sozialen Raums und der verschiedenen Kapitalformen bei der Machtausübung durch Sprache
- Kritik an der strukturalistischen Sprachwissenschaft und Bourdieus alternative Sichtweise auf die Macht der Sprache
- Die Bedeutung der performativen Magie der Sprache und die Anerkennung von Autorität und Kompetenz
- Bourdieus Beitrag zur Kommunikationswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die zentrale Thematik der „Ökonomie des Sprachlichen Tausches“ dar. Sie erläutert Bourdieus Interesse an der Wirkung von Sprache im sozialen Kontext und an der performativen Magie, die Sprache ermöglicht. Der Fokus liegt auf der Frage, wie soziale Akteure durch Sprache soziale Praktiken gestalten können.
Der zweite Teil widmet sich den Grundlagen der soziologischen Theorie Pierre Bourdieus. Es werden wichtige Konzepte wie sozialer Raum, Habitus und Kapitalformen eingeführt und deren Bedeutung für die Analyse der Sprache erläutert.
Der dritte Teil befasst sich mit der Ökonomie des Sprachlichen Tausches. Bourdieus Kritik an der strukturalistischen Sprachwissenschaft und seine alternative Sichtweise auf die Macht der Sprache werden dargestellt. Es wird betont, dass die Macht der Sprache in der Anerkennung von Autorität und Kompetenz durch die sozialen Akteure liegt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Pierre Bourdieu, Ökonomie des Sprachlichen Tausches, Habitus, sozialer Raum, Kapitalformen, sprachlicher Markt, performative Magie, symbolische Macht, Institution, Legitimität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Bourdieus „Ökonomie des sprachlichen Tausches“?
Sie beschreibt Sprache nicht nur als Kommunikation, sondern als Instrument sozialen Handelns und Mittel zur Durchsetzung von Herrschaft.
Was versteht Bourdieu unter dem Begriff „Habitus“?
Der Habitus ist ein System von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, das durch die soziale Herkunft geprägt wird und das sprachliche Verhalten bestimmt.
Was ist „performative Magie“ in der Sprache?
Die Fähigkeit, durch Worte soziale Realität direkt zu gestalten, sofern der Sprecher durch eine Institution autorisiert ist und Anerkennung findet.
Wodurch wird die Macht der Sprache legitimiert?
Nicht durch innersprachliche Logik, sondern durch die sozialen Bedingungen und den Glauben der Akteure an die Autorität des Sprechenden.
Wie grenzt sich Bourdieu von der strukturalistischen Sprachwissenschaft ab?
Er kritisiert Ansätze, die Sprache isoliert von sozialen Machtverhältnissen und den Bedingungen ihrer Produktion analysieren.
Welche Rolle spielen Kapitalformen in Bourdieus Theorie?
Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital bestimmen die Position im sozialen Raum und damit die Durchsetzungskraft der eigenen Sprache.
- Quote paper
- Marina Bayer (Author), 2008, Sprache als Instrument der Macht: Pierre Bourdieus Theorie der Ökonomie des sprachlichen Tausches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183435