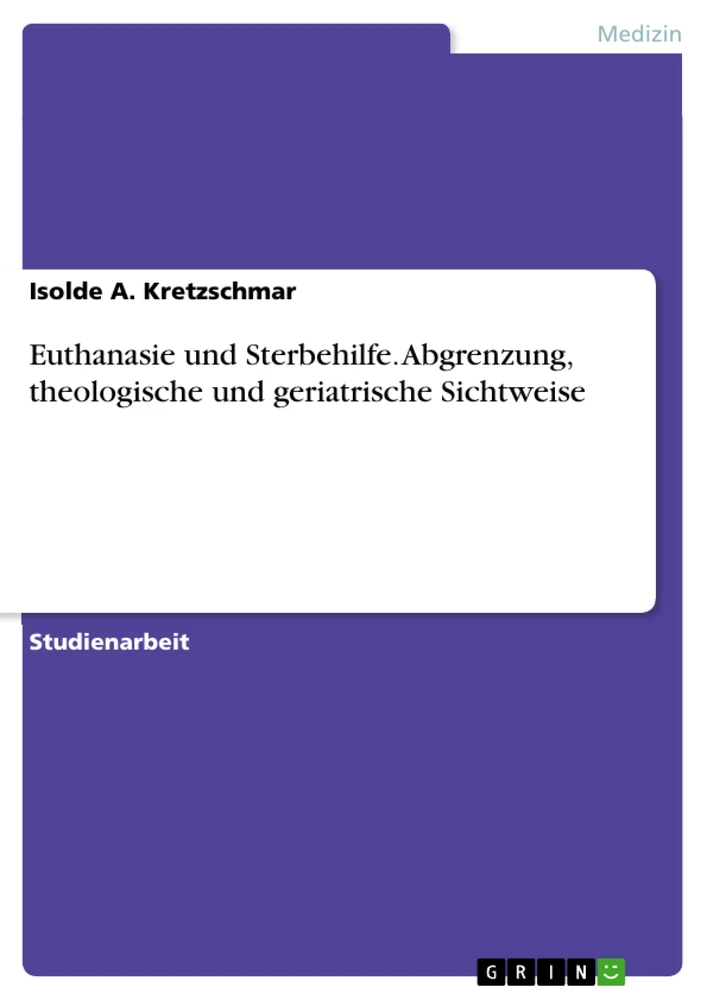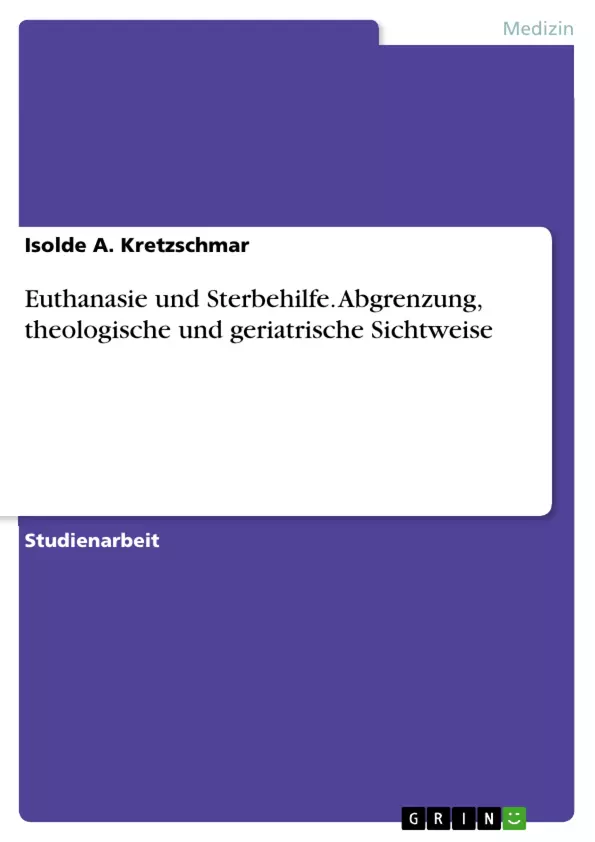Euthanasie beziehungsweise Sterbehilfe sollte ein aktuelles Thema unserer Gesellschaft sein. Auch auf Grund der demografischen Entwicklung. Der Riss zwischen den Generationen müsste zudem Anlass geben, sich mit zwei Sichtweisen - der theologischen sowie geriatrischen - auseinander zu setzen.
Als Erstes will ich die beiden Begriffe Euthanasie und Sterbehilfe gegenseitig abgrenzen und damit auch begründen, warum Euthanasie im gegenwärtigen Sprachgebrauch weniger verwendet wird. Im darauffolgenden Abschnitt werde ich die Formen der Sterbehilfe erklären und die rechtlichen Konsequenzen beschreiben. Da bei der rechtlichen Beurteilung von Sterbefällen entscheidend ist, wann nun der Todeszeitpunkt war, finde ich es wichtig auch den Todesbegriff zu definieren.
Die gesetzlichen Regelungen sind in diesem Zusammenhang nicht so eindeutig klar, so dass ich die Definitionen ausführlicher behandelte. Wie die einzelnen Bereiche der Todesbegriffe abgegrenzt wurden, beschreibe ich in der theologischen Sichtweise in Bezug auf die Sterbehilfe. In diesem Abschnitt gehe ich von der Würde des menschlichen Lebens aus und leite zum menschenwürdigen Sterben über. Als letzten wichtigen Punkt gehe ich auch auf die mögliche Folgen durch die etwaige Legalisierung der Euthanasie ein. Bei der geriatrischen Sichtweise fange ich mit den Kriterien für den Sterbebeistand an. Als Nächstes wird dann die Arzt-Patient-Beziehung beschrieben und das Recht des Patienten erläutert. Zum Abschluss der Arbeit will ich dann die wesentlichen Punkte zusammenfassen und die unterschiedliche Argumentationsweise beider Sichtweisen verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Gedanken zum Thema
- Aufbau der Arbeit
- Begriffsbestimmung
- Euthanasie
- Sterbehilfe
- Formen der Sterbehilfe
- Echte Sterbehilfe
- Indirekte Sterbehilfe
- Direkte Sterbehilfe
- Aktive Sterbehilfe
- Passive Sterbehilfe
- Gesetzliche Regelungen
- Ende des Menschenlebens
- Deutsches Recht
- Todesbegriff
- Klassische Definition
- Hirntod
- Sterbehilfe
- aus theologischer Sicht
- Würde des menschlichen Lebens
- Menschenwürdiges Sterben
- Folgen durch die Legalisierung der Euthanasie
- aus geriatrischer Sicht
- Kriterien für den Sterbebeistand
- Arzt-Patient-Beziehung
- Recht des Patienten
- Gegenüberstellung der Argumentationsweise beider Sichtweisen
- Menschenwürde
- Wertordnung der Gesellschaft
- Schlussgedanke: Patientenautonomie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der ethisch und rechtlich komplexen Frage der Sterbehilfe, die insbesondere im Kontext der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft zunehmend an Relevanz gewinnt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema aus theologischer und geriatrischer Sicht zu beleuchten und so ein umfassendes Verständnis der Argumentationslinien zu entwickeln.
- Begriffliche Abgrenzung von Euthanasie und Sterbehilfe
- Analyse verschiedener Formen der Sterbehilfe
- Rechtliche Rahmenbedingungen und der Todesbegriff
- Theologische und geriatrische Perspektiven auf Sterbehilfe
- Gegenüberstellung der Argumentationslinien beider Sichtweisen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema Euthanasie und Sterbehilfe als aktuelles gesellschaftliches Problem vor und erläutert die Motivation und den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsbestimmung: Die Begriffe Euthanasie und Sterbehilfe werden im Kontext ihrer historischen Entwicklung und des aktuellen Sprachgebrauchs abgegrenzt.
- Formen der Sterbehilfe: Es werden verschiedene Formen der Sterbehilfe, wie echte, indirekte und direkte Sterbehilfe, sowie aktive und passive Sterbehilfe, definiert und erklärt.
- Gesetzliche Regelungen: Die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Definition des Todesbegriffs und die relevanten Paragraphen des Strafgesetzbuches, werden beleuchtet.
- Sterbehilfe aus theologischer Sicht: Die theologische Perspektive auf Sterbehilfe wird aus den Aspekten der Würde des menschlichen Lebens, des menschenwürdigen Sterbens und den möglichen Folgen einer Legalisierung der Euthanasie betrachtet.
- Sterbehilfe aus geriatrischer Sicht: Der geriatrische Blickwinkel auf Sterbehilfe wird im Kontext der Kriterien für den Sterbebeistand, der Arzt-Patient-Beziehung und dem Recht des Patienten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Euthanasie, Todesbegriff, Theologie, Geriatrie, Menschenwürde, Patientenautonomie, Recht, Ethik, Gesellschaft, demografische Entwicklung, Arzt-Patient-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Euthanasie und Sterbehilfe?
Der Begriff Euthanasie ist historisch belastet (NS-Zeit) und wird daher heute seltener verwendet. Sterbehilfe ist der modernere Begriff, der verschiedene Formen der Unterstützung im Sterbeprozess umfasst.
Was versteht man unter aktiver und passiver Sterbehilfe?
Aktive Sterbehilfe bedeutet die gezielte Beendigung des Lebens durch Medikamente. Passive Sterbehilfe ist der Verzicht auf oder der Abbruch von lebensverlängernden Maßnahmen.
Wie wird der Todeszeitpunkt rechtlich definiert?
In der modernen Medizin und Rechtsprechung gilt meist der Hirntod als der entscheidende Zeitpunkt für das Ende des menschlichen Lebens, im Gegensatz zur klassischen Definition des Herz-Kreislauf-Stillstands.
Welche Rolle spielt die Menschenwürde in der theologischen Sicht?
Theologisch wird die Würde des Lebens als gottgegeben betrachtet, was oft zu einer Ablehnung der aktiven Sterbehilfe führt, während ein "menschenwürdiges Sterben" ohne unnötiges Leid befürwortet wird.
Was ist Patientenautonomie?
Patientenautonomie bezeichnet das Recht des Patienten, selbst über medizinische Behandlungen und das eigene Lebensende zu entscheiden, oft festgehalten in einer Patientenverfügung.
- Quote paper
- M. A. ; Dipl. (postgrad.) Isolde A. Kretzschmar (Author), 2005, Euthanasie und Sterbehilfe. Abgrenzung, theologische und geriatrische Sichtweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183471