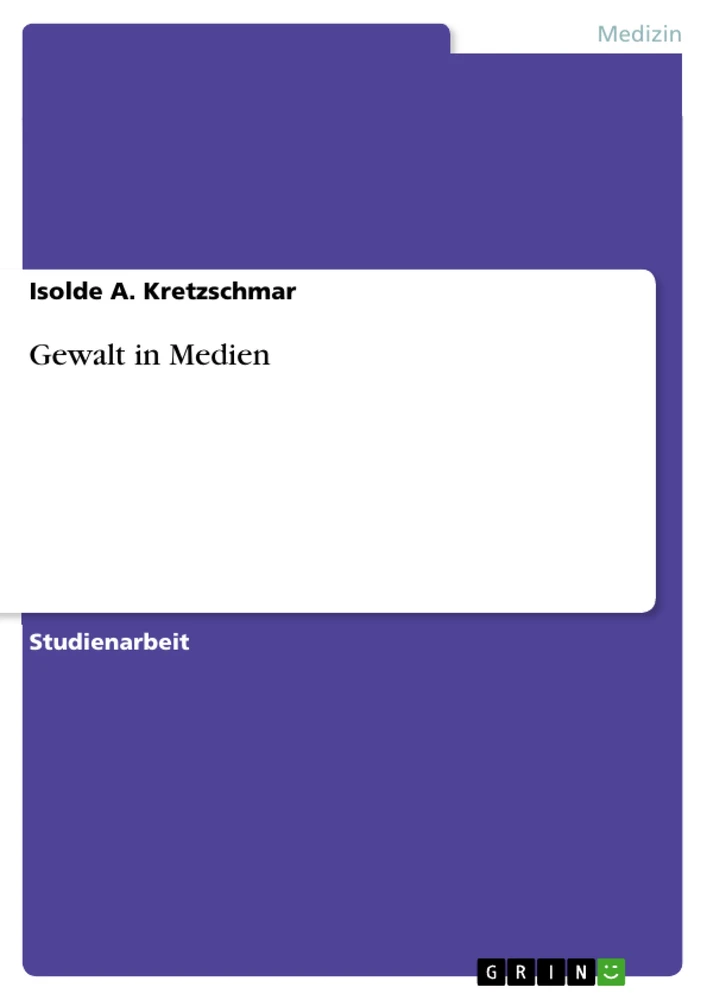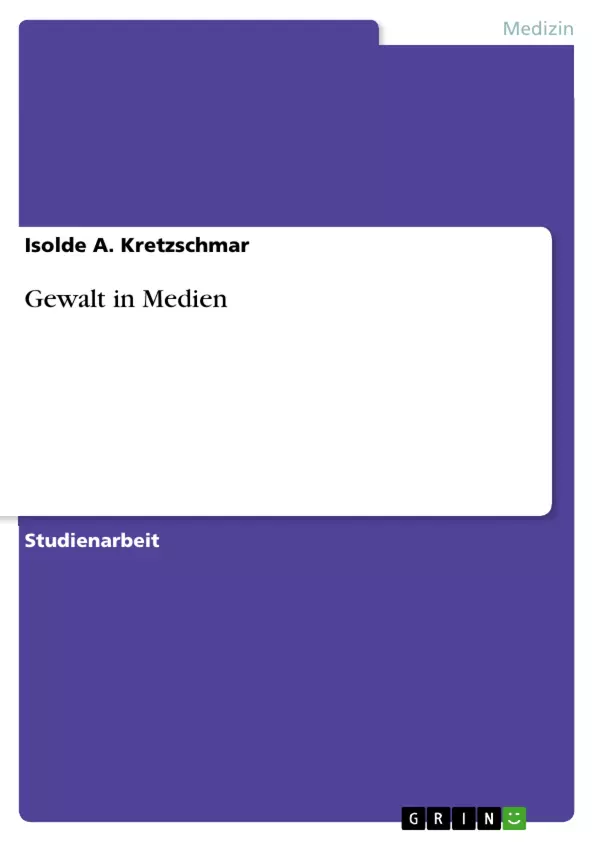Gegenwärtig wird eine Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft festgestellt, die im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit gestiegen sein soll. Aber so ist zu hinterfragen, ob die Qualität oder Quantität der Gewalt damit gemeint ist. Über aggressive Handlungen wurde bis 1950 eher nicht in den Medien bildhaft berichtet. Vor der Erfindung des Fernsehens wurden die Radio, Nachrichten durch Neuigkeiten per Zeitung oder mündlicher Mitteilung weitergeleitet. So wurden auch Berichte über kriminelle Handlungen gar nicht so stark verbreitet. Meistens blieben solche Nachrichten auf die nähere Region beschränkt. So nimmt die Berichterstattung mit Hilfe des Fernsehens einen ganz anderen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft als damals ein. Nun ist auch zu bemerken, wann situativ Gewalt angewendet wird. So kann Gewalt eingesetzt werden, um Konflikte auf schnelle und scheinbar unkomplizierte Art und Weise zu lösen. Aber es ist nun zu hinterfragen, wie die Voraussetzung ist, dass jemand zur vermeintlichen Konfliktlösung in zwischenmenschlichen Beziehungen eine aggressive Handlung wählt. Es gibt ja auch schließlich andere Wege, um eine schwierige Situation zu bewältigen oder bei einer Auseinandersetzung seine eigene Meinung durchzusetzen oder zumindest Kompromisse zu finden. Allerdings liefert das visuelle Angebot und der Medienkonsum in den letzten Jahren auch einen wesentlichen Beitrag zur Gewaltbereitschaft. So ist nun die Aufgabe dieser Hausarbeit Modelle und Thesen über den Zusammenhang von Medienwirkungen der Gewaltpräsentation auf eine durch Zuschauer real nachfolgende aggressive Handlung hin zu erörtern. Wie wirken Gewaltdarstellungen auf den Fernsehkonsumenten? Gibt es weitere Faktoren, die bei der steigenden Rate der aggressiven Handlungen im realen Umfeld eine wesentliche Rolle spielen, zu berücksichtigen? Welche psychologischen Modelle sowie aufgestellte Thesen über die Medienwirkung sind bei der Beantwortung dieser oben gestellten Fragen aussagekräftig?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation zum Thema
- Aufbau der Arbeit
- Gewalt und Aggression
- Gewalt
- Aggression
- Medienwirkungen
- Vier Annahmen
- Wirkungsmodelle
- Stimulus-Response-Modell (Kanonentheorie)
- Payne Fund Studies
- Kritik
- Trimodales transklassisches Wirkungsmodell
- Lernen am Modell
- Wirkung von Mediengewalt
- Katharsisthese
- Stimulationsthese
- Kultivierungsthese
- These der Wirkungslosigkeit
- These der Ambivalenz
- Persönlichkeitsmodell
- Sehr stark gefährdete Persönlichkeit
- Weniger stark gefährdete Persönlichkeit
- Definition und Abgrenzung von Gewalt und Aggression
- Analyse verschiedener Medienwirkungsmodelle
- Bewertung der Thesen zur Wirkung von Mediengewalt
- Einbezug des Persönlichkeitsmodells im Kontext von Medienwirkung und Aggression
- Zusammenfassende Darstellung wichtiger Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Gewalt in den Medien auf die aggressive Handlungsbereitschaft von Zuschauern. Ziel ist es, die Beziehung zwischen medialer Gewaltpräsentation und realer Gewalt zu untersuchen und zu erörtern, inwiefern Medienwirkungen eine Rolle bei der Entstehung von Aggression spielen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Motivation für die Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Gewalt und Aggression definiert und voneinander abgegrenzt. Das dritte Kapitel widmet sich den Medienwirkungen und stellt verschiedene Wirkungsmodelle vor, darunter das Stimulus-Response-Modell und das Lernen am Modell. Zudem werden die Thesen zur Wirkung von Mediengewalt wie die Katharsisthese, die Stimulationsthese und die Kultivierungsthese beleuchtet. Schließlich wird im vierten Kapitel das Persönlichkeitsmodell in Bezug auf Medienwirkung und Aggression betrachtet.
Schlüsselwörter
Gewalt, Aggression, Medienwirkungen, Stimulus-Response-Modell, Lernen am Modell, Katharsisthese, Stimulationsthese, Kultivierungsthese, Persönlichkeitsmodell.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Mediengewalt die reale Aggression?
Verschiedene Theorien untersuchen diesen Zusammenhang, wobei Modelle wie das "Lernen am Modell" nahelegen, dass gezeigte Gewalt das Verhalten von Zuschauern prägen kann.
Was besagt die Katharsisthese?
Die Katharsisthese nimmt an, dass das Betrachten von Gewalt zu einem Abbau eigener Aggressionen führt – eine Annahme, die heute wissenschaftlich stark umstritten ist.
Was ist die Kultivierungsthese?
Diese These besagt, dass langfristiger Medienkonsum das Weltbild des Zuschauers prägt, sodass dieser die reale Welt als gewalttätiger wahrnimmt, als sie tatsächlich ist.
Welche Rolle spielt die Persönlichkeit bei der Medienwirkung?
Nicht jeder reagiert gleich; Persönlichkeitsmodelle unterscheiden zwischen stark gefährdeten und weniger gefährdeten Personen im Hinblick auf die Übernahme medialer Gewaltmuster.
Was ist das Stimulus-Response-Modell?
Auch als Kanonentheorie bekannt, geht dieses Modell von einer direkten und unmittelbaren Wirkung von Medienreizen auf den Empfänger aus.
- Arbeit zitieren
- M. A. ; Dipl. (postgrad.) Isolde A. Kretzschmar (Autor:in), 2006, Gewalt in Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183473