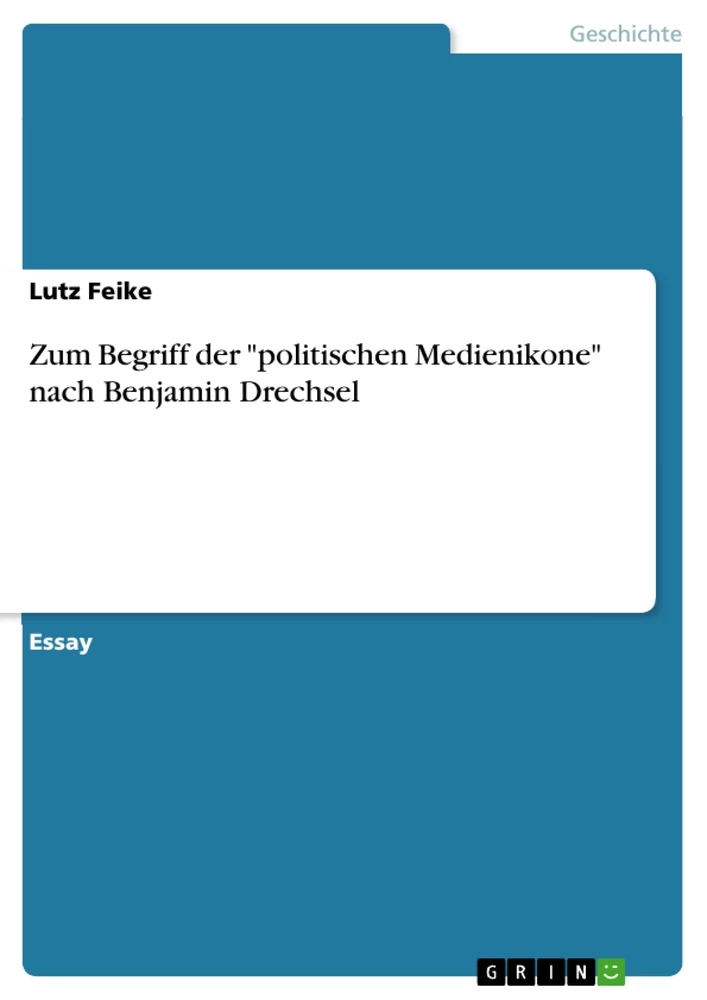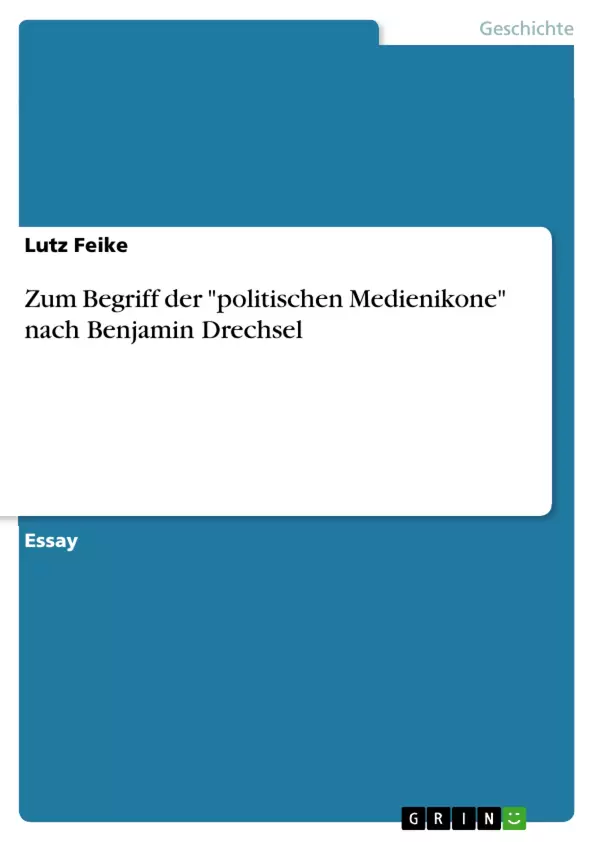Während die Menschen im Mittelalter nur sehr selten Bilder zu Gesicht bekamen, werden wir tagtäglich von Bildermassen geradezu überflutet. Doch sind es nur ganz bestimmte Bilder, die aus dem massenmedialen Alltag herausragen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen: die sogenannten Medienikonen. Um diese von den übrigen Bildern unterscheidbar zu machen, gibt es von wissenschaftlicher Seite Versuche, den Begriff der Medienikone zu definieren.
Benjamin Drechsel schlägt vor, den Begriff der politischen Medienikone einzuführen. Drechsel entwickelt in seinem Aufsatz „The Berlin Wall from a visual perspective: comments on the construction of a political media icon” ein Modell für die politische Medienikone anhand der Berliner Mauer. Der vorliegende Essay setzt sich mit der Frage auseinander, ob es sinnvoll ist, von politischen Medienikonen zu sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff der politischen Medienikone nach Benjamin Drechsel
- Heterogene Verwendung des Ikonenbegriffs
- Eigenschaften politischer Medienikonen nach Drechsel
- Transmediality
- Öffentliche Sichtbarkeit
- Enhancement/Kanonisierung
- Politisierung
- Politische Kanonisierung als elementarer Prozess
- Problem des Politikbegriffs
- Drechsels Politikbegriff: Staatliche Machtpolitik
- Ausgeweitetes Politikverständnis
- Weitere Beispiele: Marilyn Monroe, Josephine Baker
- Vielseitigkeit und Vagheit des Politikbegriffs
- Fazit: Grenzen des Konzepts der politischen Medienikone
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Eignung des von Benjamin Drechsel vorgeschlagenen Konzepts der „politischen Medienikone“. Es wird analysiert, ob die Unterscheidung zwischen Medienikonen und politischen Medienikonen sinnvoll und trennscharf ist.
- Heterogene Verwendung des Begriffs „Medienikone“
- Kennzeichen politischer Medienikonen nach Drechsel
- Kritik am Politikbegriff im Kontext des Konzepts
- Analyse von Beispielen (Berliner Mauer, Marilyn Monroe, Josephine Baker)
- Grenzen und Schwächen des Konzepts der politischen Medienikone
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einführung in den Begriff der Medienikone und der Problematik seiner vielschichtigen Verwendung. Anschließend werden Drechsels Kriterien für politische Medienikonen (Transmedialität, öffentliche Sichtbarkeit, Kanonisierung, Politisierung) vorgestellt und diskutiert. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem von Drechsel verwendeten Politikbegriff, der im Essay als zu eng kritisiert wird. Anhand von Beispielen wie der Berliner Mauer, Marilyn Monroe und Josephine Baker werden die Grenzen des Konzepts verdeutlicht. Die Diskussion zeigt die Ambivalenz des Begriffs „politisch“ im Kontext von Medienikonen auf.
Schlüsselwörter
Medienikone, politische Medienikone, Benjamin Drechsel, Politisierung, Transmedialität, Kanonisierung, Politikbegriff, Berliner Mauer, Marilyn Monroe, Josephine Baker, Machtpolitik, Bilder im 20. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „politische Medienikone“ nach Benjamin Drechsel?
Es ist ein Bild, das über verschiedene Medien hinweg (Transmedialität) eine hohe öffentliche Sichtbarkeit erlangt und durch politische Kanonisierung eine feste Bedeutung im kollektiven Gedächtnis einnimmt.
Welche Kriterien muss ein Bild erfüllen, um als Medienikone zu gelten?
Zu den Kernmerkmalen gehören Transmedialität, dauerhafte öffentliche Sichtbarkeit, Kanonisierung (Aufnahme in einen Bildkanon) und eine starke Politisierung.
Warum wird die Berliner Mauer als Beispiel herangezogen?
Die Berliner Mauer ist ein Paradebeispiel für ein visuelles Motiv, das weltweit als Symbol für den Kalten Krieg und politische Teilung kanonisiert wurde.
Welche Kritik gibt es an Drechsels Politikbegriff?
Kritiker bemängeln, dass Drechsels Fokus primär auf staatlicher Machtpolitik liegt und ein erweitertes Politikverständnis (z. B. gesellschaftliche Symbole wie Marilyn Monroe) vernachlässigt.
Können auch Personen wie Marilyn Monroe politische Medienikonen sein?
Die Arbeit diskutiert, dass auch solche Ikonen durch ihre gesellschaftliche Wirkung politisiert werden können, was die Trennschärfe von Drechsels Konzept in Frage stellt.
- Citar trabajo
- B.A. Lutz Feike (Autor), 2011, Zum Begriff der "politischen Medienikone" nach Benjamin Drechsel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183481