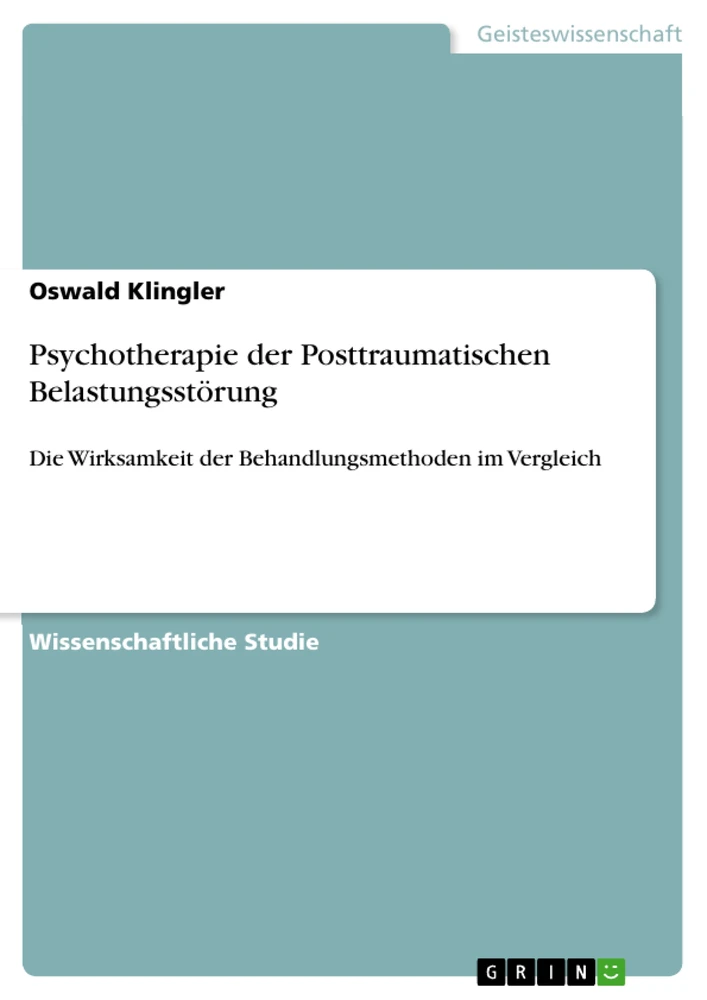Hintergrund: Untersuchungen zur Wirksamkeit von psychotherapeutischen Verfahren in der Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) liefern nicht immer konsistente Ergebnisse und keine ausreichenden Grundlagen für Behandlungsentscheidungen. Fragestellung: Welche Entscheidungs-grundlagen liefert ein „entscheidungsorientiertes Modell der besten Vergleiche“, nach dem nur jene direkten Vergleiche zwischen aktiven Behandlungsverfahren berücksichtigt werden, die besonderen methodischen Kriterien entsprechen? Methoden: Zusammenfassende Auswertung von randomisierten Vergleichen zwischen psychotherapeutischen Verfahren zur Behandlung der PTSD bezüglich der Zielvariablen Remissionen, Schweregrad der Symptomatik, allgemeines Wohlbefinden und Completer. Ergebnisse: Im Einzelsetting sollten als therapeutische Standardverfahren ein Emotions-fokussierendes Schreiben über das Trauma, eine Kombination von Exposition und kognitiver Therapie, eine Kombination von Exposition und „Imagery Rescripting“ und ein hypno-therapeutisches Verfahren eher bevorzugt und ein rational-beurteilendes Schreiben über das Trauma, eine eher allgemeine schriftliche Konfrontation, eine unspezifische supportive Behandlung, Entspannung, die Klientenzentrierte Psychotherapie und eine Selbsthilfe-Broschüre eher vermieden werden. Im Gruppensetting wären eine supportive Behandlung und Psychoedukation zu bevorzugen, hingegen Exposition, Selbstmanagement, ein Imaginationstraining und eine interpersonale Behandlung eher zu vermeiden. Schlussfolgerungen: Das entscheidungsorientierte Modell der besten Vergleiche liefert differenzierte Ergebnisse, die als vorläufige Grundlage für therapeutische Entscheidungen gelten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. HINTERGRUND
- 2. FRAGESTELLUNG
- 3. METHODEN
- 3.1 RECHERCHE
- 3.2 PRIMÄRE SELEKTIONSKRITERIEN
- 3.3 GRUPPIERUNG DER BEHANDLUNGSMETHODEN
- 3.4 BEURTEILUNGSKRITERIEN
- 3.5 SEKUNDÄRE SELEKTIONSKRITERIEN
- 3.6 ZUSAMMENFASSUNGEN, SUBGRUPPENBILDUNGEN
- 3.7 ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN
- 4. ERGEBNISSE
- 4.1 STUDIEN UND BEHANDLUNGSVERGLEICHE
- 4.2 ERGEBNISSE DER „BESTEN“ VERGLEICHE
- 4.3 ZUR \"NÜTZLICHKEIT“ IM VERGLEICH
- 5. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
- 7. ABSTRACT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wirksamkeit von verschiedenen psychotherapeutischen Behandlungsmethoden bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD). Ziel ist es, durch einen systematischen Vergleich von Studien, die unterschiedliche Behandlungsformen direkt miteinander kontrastieren, Erkenntnisse über die relative Effektivität der einzelnen Methoden zu gewinnen.
- Systematische Reviews und Meta-Analysen zur Wirksamkeit von PTSD-Therapien
- Verhaltenstherapeutische Exposition und EMDR als gängige Behandlungsformen
- Direkte randomisierte Vergleiche zwischen verschiedenen Therapiemethoden
- Entwicklung eines „entscheidungsorientierten Modells“ für die Auswahl von Studien
- Bewertung der methodischen Qualität von Studien und die Relevanz von Qualitätskriterien
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. HINTERGRUND: Dieses Kapitel stellt die Problematik der PTSD und die Notwendigkeit eines systematischen Vergleichs von Behandlungsmethoden vor. Es beleuchtet die wachsende Anzahl von systematischen Reviews und Meta-Analysen und diskutiert die Ergebnisse, die insbesondere für die Verhaltenstherapeutische Exposition und EMDR gefunden wurden.
- 2. FRAGESTELLUNG: Dieses Kapitel definiert die Forschungsfrage, die diese Arbeit beantworten will, nämlich den Vergleich der Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmethoden bei PTSD.
- 3. METHODEN: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Arbeit. Dazu gehören die Recherche-Strategie, die Selektionskriterien für die Studien und die Beurteilungskriterien für die Qualität der Studien. Die verschiedenen Gruppen von Behandlungsmethoden, die in der Analyse berücksichtigt werden, sowie die Entscheidungsregeln für die Auswahl der Studien werden ebenfalls vorgestellt.
- 4. ERGEBNISSE: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die wichtigsten Ergebnisse aus den ausgewählten Studien zusammengefasst und die Studienergebnisse im Kontext von "besten Vergleichen" interpretiert. Die Effektivität verschiedener Behandlungsmethoden wird anhand von direkten Vergleichen und anhand von "Nützlichkeit" im Vergleich betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Bereiche Psychotherapie, Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD), Behandlungswirksamkeit, Verhaltenstherapie, Exposition, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), systematische Reviews, Meta-Analysen, randomisierte kontrollierte Studien, „Gold-Standard“ Kriterien, methodische Qualität von Studien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Therapiemethoden sind bei PTSD im Einzelsetting am wirksamsten?
Bevorzugt werden sollten Emotions-fokussierendes Schreiben, Kombinationen aus Exposition und kognitiver Therapie oder Imagery Rescripting sowie hypnotherapeutische Verfahren.
Welche Verfahren sollten im Gruppensetting bei PTSD bevorzugt werden?
Im Gruppensetting zeigen supportive Behandlung und Psychoedukation bessere Ergebnisse, während reine Exposition oder Imaginationstraining eher vermieden werden sollten.
Was ist das „Modell der besten Vergleiche“?
Es ist ein methodischer Ansatz, der nur jene direkten Vergleiche zwischen aktiven Behandlungsverfahren berücksichtigt, die strengen Qualitätskriterien entsprechen.
Sind Entspannungsverfahren zur Behandlung von PTSD geeignet?
Laut der Auswertung sollten Entspannung, Klientenzentrierte Psychotherapie und rein supportive Behandlungen im Einzelsetting eher vermieden werden, da sie weniger wirksam sind als spezifische Traumatherapien.
Welche Zielvariablen wurden in der Studie untersucht?
Untersucht wurden Remissionsraten, der Schweregrad der Symptomatik, das allgemeine Wohlbefinden und die Abbruchquoten (Completer).
- Arbeit zitieren
- Dr. Oswald Klingler (Autor:in), 2011, Psychotherapie der Posttraumatischen Belastungsstörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183487