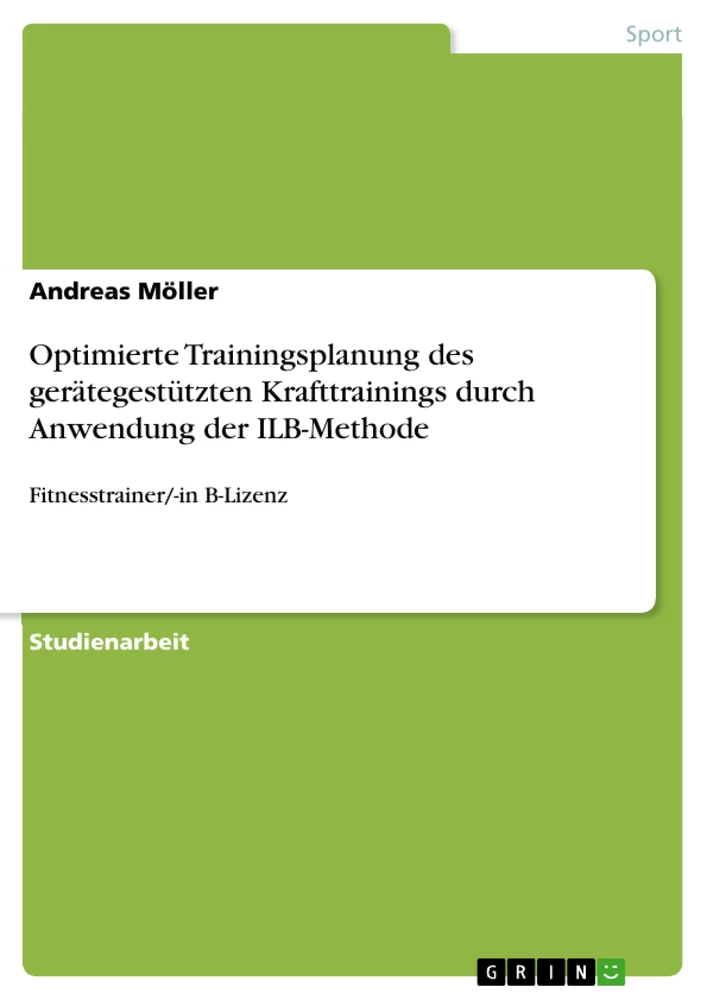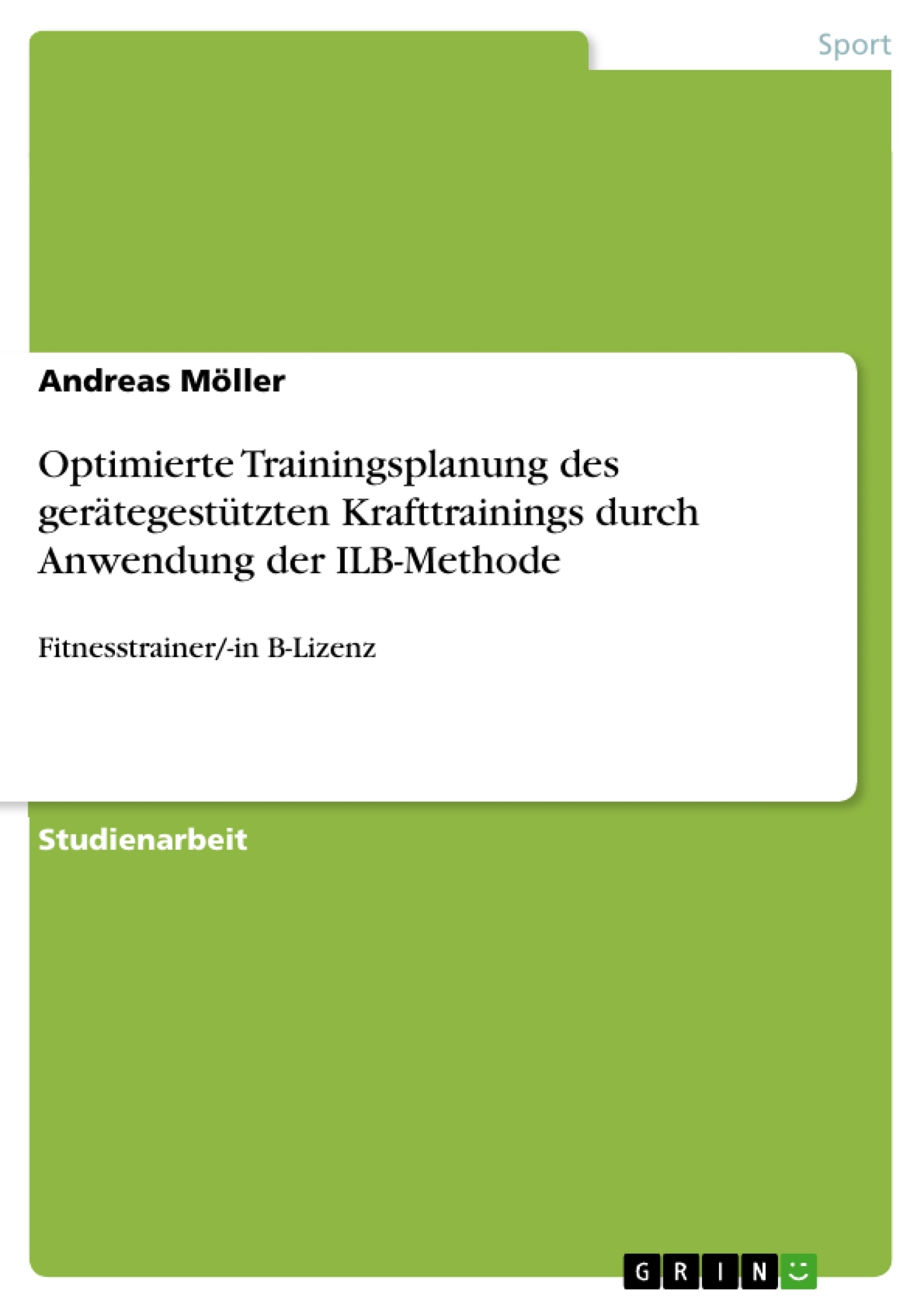Die ILB-Methode stellt eine wirksame Trainingsmethode sowohl im Bereich des Krafttrainings als auch im Bodybuilding dar. Sie wird von den klassischen Trainingsprinzipien der Sportwissenschaft hergeleitet, und verhilft nahezu jedem Athleten, ob Einsteiger oder Fortgeschrittenen, zu einer stetigen Weiterentwicklung seiner Leistungsfähigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Diagnose
- 2.1 Dokumentation Kundendaten
- 2.2 Bewertung biometrischer Daten
- 2.2.1 Body-Mass-Index (BMI)
- 2.2.2 Ruhepuls
- 2.3 Gesundheitszustand
- 2.4 Trainingsmotive/ Trainingswünsche
- 2.5 Zeitbudget
- 3 Zielsetzung
- 3.1 Trainingsziele
- 3.1.1 Trainingsziel Muskelaufbau
- 3.1.2 Trainingsziel: Verbesserung der Kraftleistung
- 3.1.3 Trainingsziel Senkung des Blutdrucks
- 3.2 Realistische Trainingsziele
- 4 Trainingsplanung
- 4.1 Makrozyklus
- 4.1.1 Erläuterung zum Aufbau des Makrozyklus
- 4.1.2 ILB-Methode
- 4.1.3 Durchführung ILB-Methodik
- 4.1.4 Geplanter Makrozyklus
- 4.1.5 Zugrundeliegende Trainingsprinzipien der ILB-Methode
- 4.2 Mesozyklus
- 4.2.1 Methodik des Aufwärmens
- 4.2.2 Aufbau des Mesozyklus
- 4.2.3 Methodik des Abwärmens (Cool-down)
- 5 Trainingsdurchführung
- 5.1 Wadenheben sitzend
- 5.2 Beinstrecken
- 6 Analyse / Re-Test
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit erstellt einen individuellen Trainingsplan für einen Fitnesskunden über einen Zeitraum von 6 Monaten, basierend auf der ILB-Methode (Individuelles Leistungsbild). Der Fokus liegt auf der Anwendung der fünf Stufen der Trainingssteuerung: Diagnose, Zielsetzung, Trainingsplanung, Trainingsdurchführung und Analyse/Re-Test.
- Erstellung eines individuellen Krafttrainingsplans mit der ILB-Methode
- Anwendung der fünf Stufen der Trainingssteuerung
- Detaillierte Beschreibung der Makro- und Mesozyklusplanung
- Definition realistischer Trainingsziele
- Beschreibung der Trainingsdurchführung ausgewählter Übungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und die Methodik der Hausarbeit. Beschreibung des Trainingszeitraums und des gewählten Trainingsansatzes (ILB-Methode).
Kapitel 2 (Diagnose): Dokumentation der Kundendaten, Bewertung biometrischer Daten (BMI, Ruhepuls), Erfassung des Gesundheitszustandes, der Trainingsmotive und des verfügbaren Zeitbudgets.
Kapitel 3 (Zielsetzung): Definition der Trainingsziele (Muskelaufbau, Verbesserung der Kraftleistung, Senkung des Blutdrucks) und Formulierung realistischer Ziele, abgestimmt auf die Diagnose.
Kapitel 4 (Trainingsplanung): Detaillierte Erläuterung des Makrozyklus und des Mesozyklus unter Berücksichtigung der ILB-Methode, inklusive Methodik des Aufwärmens und Abwärmens.
Kapitel 5 (Trainingsdurchführung): Beschreibung der Durchführung ausgewählter Übungen (Wadenheben sitzend, Beinstrecken).
Schlüsselwörter
ILB-Methode, Krafttraining, Trainingsplanung, Makrozyklus, Mesozyklus, Muskelaufbau, Kraftleistung, Blutdruck, Fitness, individuelle Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die ILB-Methode im Krafttraining?
Die ILB-Methode (Individuelles Leistungsbild) ist ein Trainingsansatz, bei dem die Intensität basierend auf einem individuellen Test für eine bestimmte Wiederholungszahl festgelegt wird, anstatt auf dem Maximalkrafttest (1-RM).
Wie ist ein Makrozyklus in der Trainingsplanung aufgebaut?
Ein Makrozyklus umfasst meist einen Zeitraum von mehreren Monaten (hier 6 Monate) und unterteilt das Training in verschiedene Phasen wie Kraftausdauer, Muskelaufbau und Maximalkraft.
Warum ist die Diagnose am Anfang des Trainings wichtig?
Die Diagnose erfasst biometrische Daten (BMI, Ruhepuls) und den Gesundheitszustand, um realistische Ziele zu setzen und Überlastungen zu vermeiden.
Was sind typische Ziele eines ILB-Trainingsplans?
Zu den Zielen gehören Muskelaufbau (Hypertrophie), die Verbesserung der allgemeinen Kraftleistung und gesundheitliche Aspekte wie die Senkung des Blutdrucks.
Welche Rolle spielt der Re-Test in der Trainingssteuerung?
Der Re-Test dient der Analyse des Fortschritts nach einem Mesozyklus, um die Trainingsgewichte für den nächsten Zyklus optimal anzupassen.
- Quote paper
- B.A. Andreas Möller (Author), 2011, Optimierte Trainingsplanung des gerätegestützten Krafttrainings durch Anwendung der ILB-Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183584