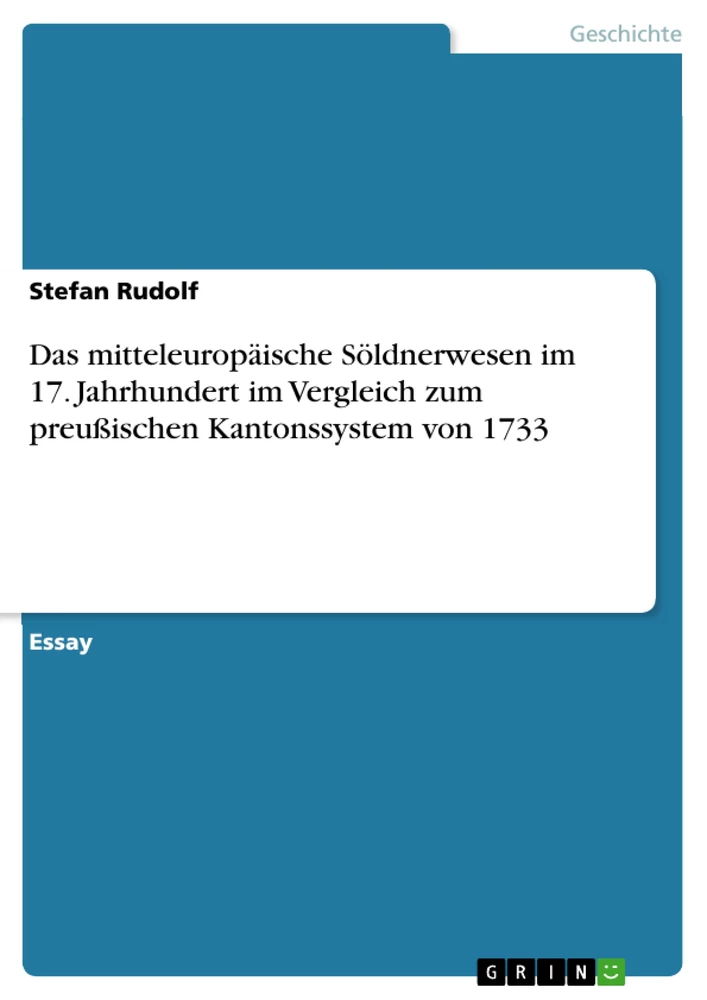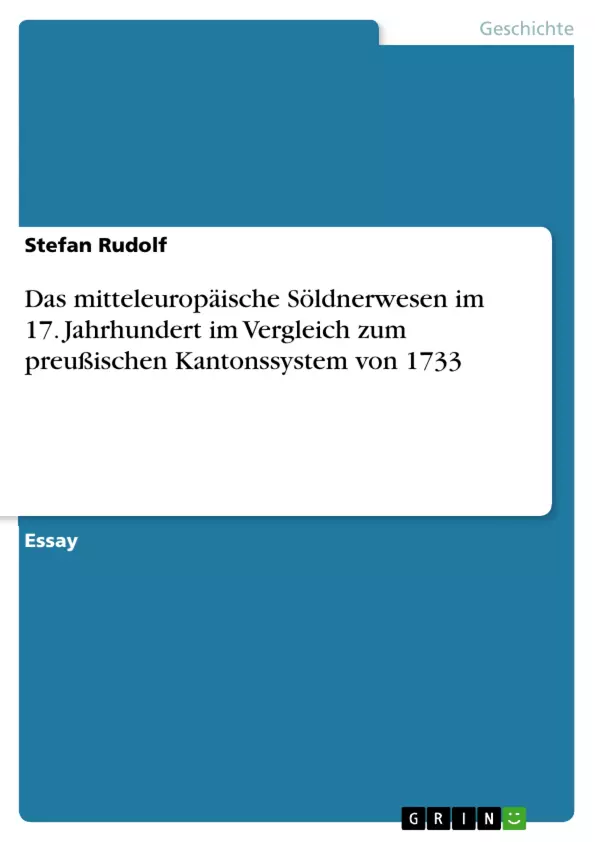Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges wandelte sich der Landsknecht des 16. in den Söldner des 17. Jahrhunderts. Nach dieser sehr langen, militärischen Konfrontation vollzog sich ein einschneidender Wandel im europäischen Heerwesen. Die Großmächte jener Zeit gingen von der Söldnerwerbung im Kriegsfall zur Haltung stehender Heere über, was im Falle Brandenburgs durch Kurfürst Friedrich Wilhelm etabliert wurde. 1733 legalisierte Friedrich Wilhelm I. mit dem Kantonsreglement offiziell die bereits bestehende Praxis der Rekrutierung von Kantonisten und sanktionierte damit ein bis dato völlig neuartiges System zur Rekrutengestellung. Diese Wandlung im Militärwesen leistete eine solide Rekrutierungsgrundlage und ermöglichte die Aufstellung großer Heereskontingente, womit sich auch ein bedeutender gesellschaftlicher Wandel in den Preußischen Landen vollzog.
In der folgenden Arbeit soll die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden des Söldnerwesens des 17. Jahrhunderts und der Heeresverfassung zur Zeit des „Solda-tenkönigs“ erörtert werden, die eine Vorstufe der allgemeinen Wehrpflicht darstellte.
Besonderes Interesse sei hierbei auf Themenfelder wie das soziale Milieu und die Mobi-lität, das Sozialprestige, die Rolle des Offizierskorps und der Umfang der Dienstzeit, die Funktion des Adels in der Armee, die Bindung an den Dienstherrn, die Rekrutierungsform und die Finanzierung des Heeres gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Das mitteleuropäische Söldnerwesen im 17. Jahrhundert im Vergleich zum preußischen Kantonssystem von 1733
- Die Söldner der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
- Soziales Milieu und Mobilität
- Sozialprestige
- Rolle des Offizierkorps und Dienstzeit
- Funktion des Adels in der Armee
- Bindung an den Dienstherrn
- Rekrutierungsform und Finanzierung des Heeres
- Das Kantonsreglement von 1733
- Preußische Rekrutierung
- Kompromiss zwischen Zivilwirtschaft und stehendem Heer
- Soziale Auswirkungen
- Bindung an den Dienstherrn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem mitteleuropäischen Söldnerwesen des 17. Jahrhunderts und dem preußischen Kantonssystem von 1733. Es wird analysiert, inwiefern das Kantonssystem eine Vorstufe der allgemeinen Wehrpflicht darstellte.
- Soziales Milieu und Mobilität der Soldaten beider Systeme
- Sozialprestige und gesellschaftliche Wahrnehmung von Söldnern und Kantonisten
- Rolle des Offizierkorps und die Organisation der Armeen
- Bindung der Soldaten an den Dienstherrn und die Auswirkungen auf die Loyalität
- Rekrutierung und Finanzierung der jeweiligen Heeresstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Thematik des Wandels vom Landsknecht zum Söldner und der Etablierung stehender Heere. Anschließend wird das soziale Milieu der Söldner des 17. Jahrhunderts beschrieben, mit Fokus auf ihre soziale Mobilität, ihr geringes Sozialprestige und die scharfe soziale Schichtung innerhalb des Heeres. Die Rolle des Adels und die Organisation des Offizierkorps werden ebenfalls beleuchtet, wobei der Mangel an Korpsgeist und die wirtschaftlichen Interessen der Offiziere hervorgehoben werden. Im weiteren Verlauf wird das preußische Kantonssystem von 1733 vorgestellt, mit Beschreibung der Rekrutierungsmethoden und der Auswirkung auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Es werden die Unterschiede zur Söldnerzeit in Bezug auf soziale Zusammensetzung, Bindung an den Dienstherrn und das Sozialprestige der Soldaten herausgestellt. Die Rolle des Adels im preußischen Offizierskorps und die veränderte Bindung zum Staat werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Söldnerwesen, Kantonssystem, Preußische Armee, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, soziale Mobilität, Sozialprestige, Offizierkorps, Rekrutierung, Finanzierung, Bindung an den Dienstherrn, Friedrich Wilhelm I., Soldatenkönig, Wehrpflicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Vergleich dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht das mitteleuropäische Söldnerwesen des 17. Jahrhunderts mit dem preußischen Kantonssystem von 1733, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Heeresverfassung aufzuzeigen.
Was war das Kantonsreglement von 1733?
Es war ein von Friedrich Wilhelm I. legalisiertes System zur Rekrutierung von sogenannten Kantonisten, das eine solide Grundlage für die Aufstellung großer Heereskontingente in Preußen schuf.
Wie unterschied sich das Sozialprestige von Söldnern und Kantonisten?
Söldner des 17. Jahrhunderts hatten oft ein geringes Sozialprestige und eine hohe Mobilität, während das Kantonssystem zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Wandel und einer stärkeren Bindung an den Staat führte.
Welche Rolle spielte der Adel in diesen Militärsystemen?
Die Arbeit untersucht die Funktion des Adels im Offizierskorps, wobei im 17. Jahrhundert oft wirtschaftliche Interessen dominierten, während im preußischen System die Bindung zum Staat im Vordergrund stand.
Gilt das Kantonssystem als Vorläufer der Wehrpflicht?
Ja, die Untersuchung erörtert das preußische Kantonssystem als eine frühe Vorstufe der allgemeinen Wehrpflicht.
- Quote paper
- Stefan Rudolf (Author), 2008, Das mitteleuropäische Söldnerwesen im 17. Jahrhundert im Vergleich zum preußischen Kantonssystem von 1733, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183709