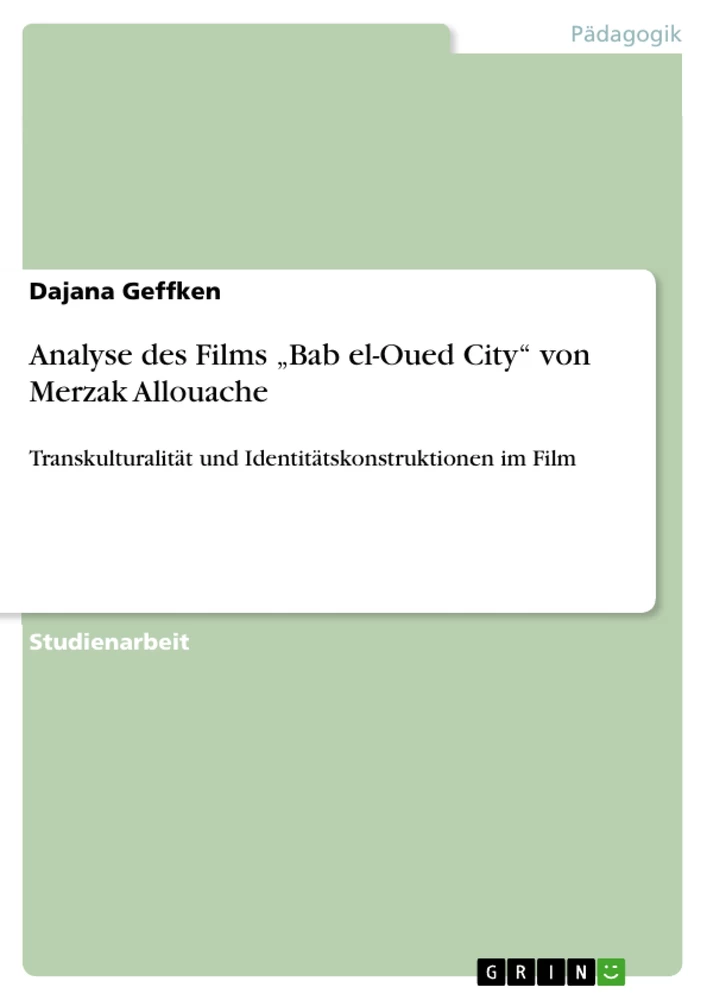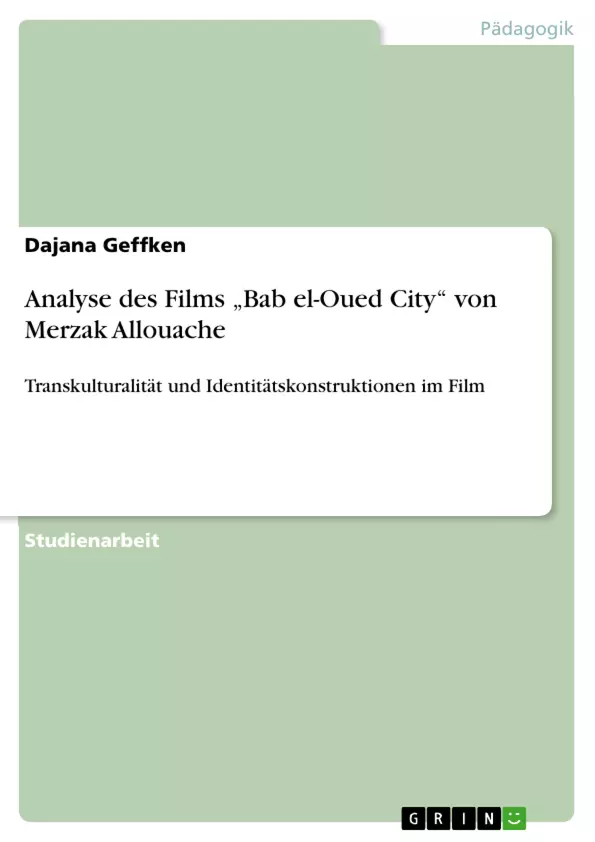Am Beispiel von „Bab el-Oued City“, einem dokumentarischen Werk des algerischen Regisseurs Merzak Allouache, befasst sich diese Hausarbeit mit Transkulturalität im Film.
Die Handlung des Films „Bab el-Oued City“ geht auf das Frühjahr 1989 zurück, eine Zeit, als die Menschen in Algier von den blutigen Auseinandersetzungen in 1988 geprägt waren. [...] In dieser Arbeit soll zunächst auf die schwierige Situation in Algerien in Bezug auf die politischen Hintergründe des Films „Bab el-Oued City“ eingegangen werden. Im Anschluss daran wird der Regisseur des Films, Merzak Allouache, vorgestellt. Im Weiteren werde ich
die Struktur- und Handlungsebenen und die Charaktere des Films analysieren. Zum Schluss werden die Geschehnisse in „Bab el-Oued City“ kurz diskutiert. Vor dem Fazit gehe ich auf
Irmhild Schraders Schrift „Vom Blick auf den anderen zum anderen Blick ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Algerien im Überblick
- Politik und Wirtschaft
- Algeriens Kolonialisierung
- Kampf um Unabhängigkeit
- Machtkämpfe
- Der islamische Fundamentalismus
- Gemäßigter Islam
- FIS – Front Islamique du Salut
- FLN - die Nationale Befreiungsfront
- GSPC und GIA
- Merzak Allouache: „Bab el-Oued City“
- Biografie
- Analyse des Films
- Struktur und Handlung des Films
- Analyse der Charaktere
- Einordnung der filmischen Hauptcharaktere in den gesellschaftspolitischen Kontext
- Einordnung der islamischen-fundamentalistischen Kräfte
- Irmhild Schrader
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Film „Bab el-Oued City“ von Merzak Allouache im Kontext der Transkulturalität und Identitätskonstruktionen im Film. Die Arbeit untersucht die politischen und sozialen Hintergründe des Films, die in der Geschichte Algeriens verwurzelt sind, und analysiert die Struktur, Handlung und Charaktere des Films. Ziel ist es, die Darstellung von Transkulturalität und Identitätskonstruktionen im Film zu beleuchten und die Bedeutung des Films für das Verständnis der algerischen Gesellschaft zu erforschen.
- Die Geschichte Algeriens und die Folgen der Kolonialisierung
- Der Einfluss des islamischen Fundamentalismus auf die algerische Gesellschaft
- Die Darstellung von Transkulturalität und Identitätskonstruktionen im Film
- Die Rolle des Films als Spiegelbild der algerischen Gesellschaft
- Die Bedeutung des Films für das Verständnis der algerischen Geschichte und Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Film „Bab el-Oued City“ als Beispiel für die Darstellung von Transkulturalität im Film vor. Die Handlung des Films wird in den Kontext der politischen und sozialen Situation Algeriens im Frühjahr 1989 eingebettet.
Das Kapitel „Algerien im Überblick“ bietet einen umfassenden Überblick über die politische und wirtschaftliche Situation Algeriens. Es beleuchtet die Geschichte der Kolonialisierung, den Kampf um die Unabhängigkeit und die Machtkämpfe, die das Land seit der Unabhängigkeit prägen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss des islamischen Fundamentalismus auf die algerische Gesellschaft.
Das Kapitel „Merzak Allouache: „Bab el-Oued City““ stellt den Regisseur des Films, Merzak Allouache, vor und analysiert den Film in Bezug auf seine Struktur, Handlung und Charaktere. Die Analyse beleuchtet die Darstellung von Transkulturalität und Identitätskonstruktionen im Film und ordnet die filmischen Hauptcharaktere in den gesellschaftspolitischen Kontext ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Transkulturalität, Identitätskonstruktionen, Film, Algerien, Kolonialisierung, Islamischer Fundamentalismus, Bab el-Oued City, Merzak Allouache, Politik, Gesellschaft, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Film 'Bab el-Oued City'?
Der Film des Regisseurs Merzak Allouache thematisiert die gesellschaftliche Situation in Algier im Jahr 1989, geprägt von politischen Unruhen und dem Aufstieg des islamischen Fundamentalismus.
Was bedeutet Transkulturalität im Kontext dieses Films?
Es beschreibt die Vermischung und das Aufeinandertreffen verschiedener kultureller Einflüsse und Identitätskonstruktionen innerhalb der algerischen Gesellschaft.
Welche Rolle spielt der islamische Fundamentalismus im Film?
Der Film zeigt den Einfluss radikaler Kräfte wie der FIS und wie diese das tägliche Leben und die Identität der Bewohner beeinflussen.
Wer ist Merzak Allouache?
Ein bedeutender algerischer Regisseur, der für seine dokumentarisch geprägten Werke bekannt ist, die sich kritisch mit der algerischen Geschichte und Gegenwart auseinandersetzen.
Welche historischen Ereignisse bilden den Hintergrund?
Die Folgen der Kolonialisierung, der Unabhängigkeitskampf und die blutigen Auseinandersetzungen von 1988 in Algerien.
- Arbeit zitieren
- Dajana Geffken (Autor:in), 2011, Analyse des Films „Bab el-Oued City“ von Merzak Allouache , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183730