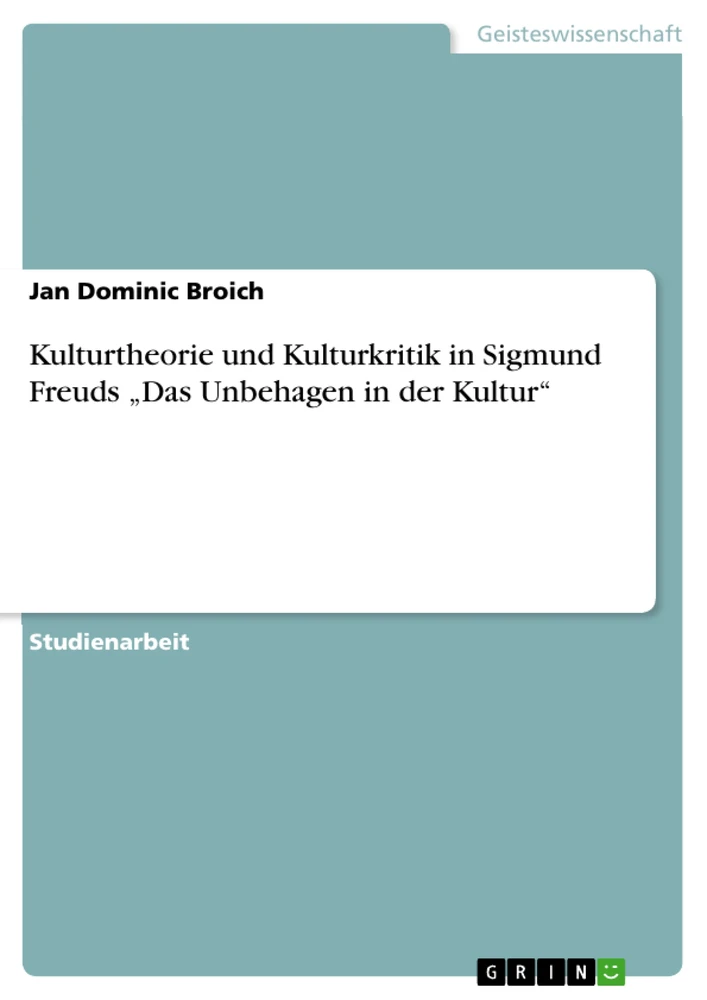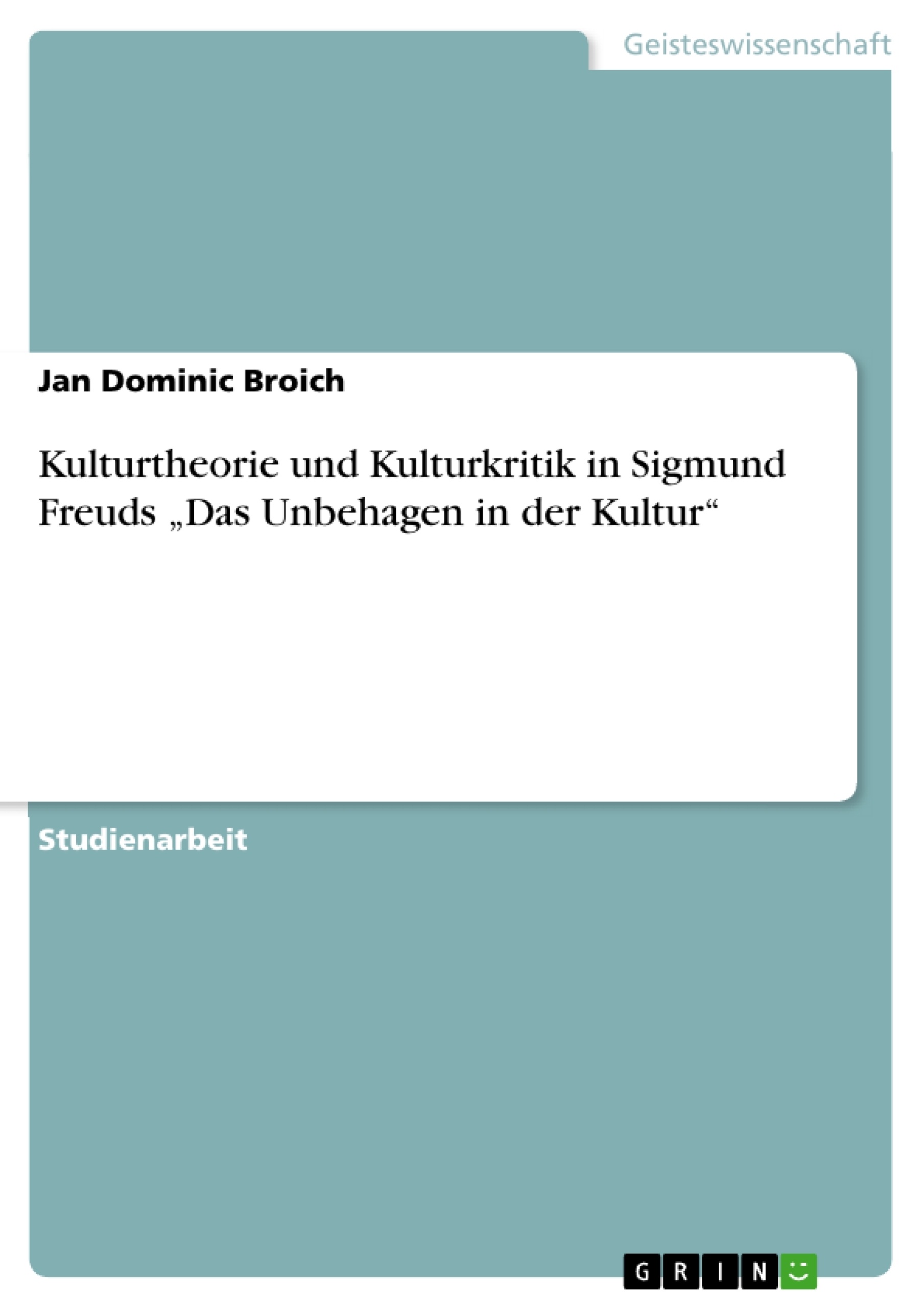Ziel dieser Arbeit ist es, die Argumentation der Kulturtheorie Freuds und damit auch die Grundlagen seiner Kulturkritik nachvollziehbar zu machen. Angesichts der Fülle an wissenschaftlichen Überlegungen Freuds selber und derer die an seine anknüpfen, sei nicht der Anspruch an diese Arbeit gestellt, weltbewegend Neues aufzuzeigen. Der Anspruch kann nur darin bestehen, die Gedanken Freuds, die dem Autor besonders interessant erscheinen und die wichtig für die Entwicklung seiner Kulturtheorie sind, aufzugreifen und anhand derer eigene Überlegungen anzustellen. Es ist ein besonderes Merkmal unserer heutigen Kultur, dass alles in irgendeiner Form schon mal dagewesen ist. Doch neu ist das, was für einen selber neu ist. Freud selbst macht in seiner kulturtheoretischen Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“ aus dem Jahre 1930 deutlich: „Ich habe bei keiner Arbeit so stark die Empfindung gehabt wie diesmal, daß ich allgemein Bekanntes darstelle, Papier und Tinte, in weiterer Folge Setzerarbeit und Druckerschwärze aufbiete, um eigentlich selbstverständliche Dinge zu erzählen.“ Und trotzdem werden selbst 80 Jahre nach dem Erscheinen dieser Schrift, dem einen oder anderen die in ihr enthaltenen Gedanken zu unserer Kultur neu sein. Die eigentliche Selbstverständlichkeit haftet nämlich nicht dem Wesen der Kultur an, sondern der Art und Weise, wie der Mensch ihr gegenübersteht: Als sei sie selbstverständlich. Das macht es dem Einzelnen insofern einfach, als dass es keines Versuches seinerseits bedarf, sie sich verständlich zu machen. Doch wer diesen Versuch wagt, und mit Freud in die Untiefen kulturtheoretischer Überlegungen eindringt, der wird erkennen, dass die selbstverständlichen Dinge, von denen Freud spricht, unserer alltäglichen Auffassung von Kultur fern liegen. Nichts ist gefährlicher für die Kultur, als dass sie für selbstverständlich genommen wird, denn das macht sie über jede Kritik erhaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes Vorwort
- Kulturtheoretische Überlegungen von und anhand von Freud
- Kultur als menschliche Überlebenstaktik
- Funktionen der Kultur
- Moral als Grundlage der Kultur?
- Der Tausch: flüchtiges Glück gegen langfristige Sicherheit
- Merkmale des Hochstandes einer Kultur
- Der sublimierte Trieb
- Todes- vs. Lebenstrieb
- Moral als notwendige Erfindung der Kultur
- Von der Tabuisierung zur Sublimierung
- Kulturkritische Überlegungen von und anhand von Freud
- Das Unbehagen in der Kultur
- Legitimation der Kultur
- Eigene Überlegungen zu Geist, Kultur und Natur
- Abschließendes Wort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Argumentation der Kulturtheorie Freuds und damit auch die Grundlagen seiner Kulturkritik nachvollziehbar zu machen. Die Arbeit konzentriert sich auf Freuds Gedanken, die für die Entwicklung seiner Kulturtheorie wichtig sind, und stellt eigene Überlegungen anhand derer an.
- Freuds Kulturtheorie und seine Kulturkritik
- Die Rolle von Kultur als menschliche Überlebenstaktik
- Die Funktionen von Kultur und die Bedeutung von Moral
- Die Sublimierung des Triebes und seine Auswirkungen auf die Kultur
- Das Unbehagen in der Kultur und die Legitimation von Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das einleitende Vorwort beschreibt die Ziele und den Ansatz der Arbeit. Das zweite Kapitel analysiert Freuds kulturtheoretische Überlegungen. Es beleuchtet den Begriff der Kultur als Überlebenstaktik, untersucht die Funktionen der Kultur und die Rolle der Moral, und betrachtet die Balance zwischen kurzfristigem Glück und langfristiger Sicherheit.
Kapitel III beschäftigt sich mit dem sublimierten Trieb. Es stellt die Konzepte des Todes- und Lebenstriebes gegenüber, beleuchtet die Notwendigkeit von Moral in der Kultur und untersucht die Entwicklung von Tabuisierung zu Sublimierung.
Das vierte Kapitel widmet sich kulturkritischen Überlegungen, die auf Freuds Theorie basieren. Es analysiert das Unbehagen in der Kultur, beleuchtet die Legitimation von Kultur und führt eigene Überlegungen zu Geist, Kultur und Natur an.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Kulturtheorie, Kulturkritik, Sigmund Freud, Überlebenstaktik, Moral, Trieb, Sublimierung, Unbehagen, Legitimation, Geist, Natur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“?
Freud argumentiert, dass Kultur dem Menschen zwar Sicherheit bietet, ihn aber durch die Unterdrückung seiner Triebe unglücklich macht, was zu einem dauerhaften Unbehagen führt.
Welche Rolle spielt die Sublimierung in Freuds Kulturtheorie?
Sublimierung ist der Prozess, bei dem triebhafte Energie in kulturell wertvolle Leistungen (wie Kunst oder Wissenschaft) umgewandelt wird, was eine Voraussetzung für die Zivilisation ist.
Was ist der Unterschied zwischen Lebens- und Todestrieb?
Der Lebenstrieb (Eros) strebt nach Bindung und Aufbau, während der Todestrieb (Thanatos) nach Auflösung und Aggression strebt; Kultur muss beide Kräfte bändigen.
Warum ist Moral laut Freud eine notwendige Erfindung?
Moral dient als Kontrollmechanismus, um das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen und die destruktiven Triebe des Einzelnen durch ein kollektives Gewissen einzuschränken.
Warum wird Kultur oft als „Überlebenstaktik“ bezeichnet?
Kultur schützt den Menschen vor den Gefahren der Natur und vor der Aggressivität seiner Mitmenschen, indem sie feste Regeln und Strukturen vorgibt.
- Citation du texte
- Jan Dominic Broich (Auteur), 2009, Kulturtheorie und Kulturkritik in Sigmund Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183749