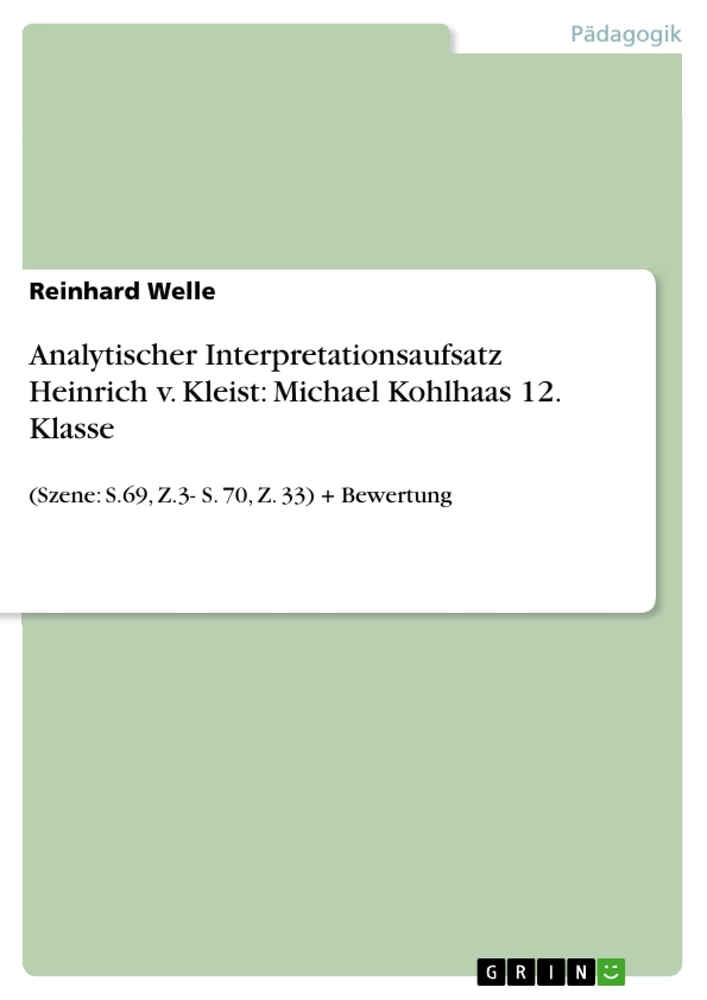Heinrich von Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“, aus dem Jahr 1810, handelt von einem Rosshändler, dessen Streben nach Gerechtigkeit und Prinzipientreue auf ein scheinbar nichtiges Unrecht, eine Vielzahl schrecklicher und tragischer Ereignisse folgen lässt. Michael Kohlhaas ist ein angesehener und wohlhabender Rosshändler, dem eines Tages ein unumstrittenes Unrecht auf der Tronkenburg von Seiten des Junkers Wenzel von Tronka widerfährt....
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Der Anfang des Unrechts
- Kapitel 2: Die missglückte Rechtsfindung
- Kapitel 3: Kohlhaas' erste Wandlung
- Kapitel 4: Der Rachefeldzug
- Kapitel 5: Die Intervention Luthers
- Kapitel 6: Der Prozess und die Amnestie
- Kapitel 7: Die Krisis auf dem Marktplatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ und untersucht die Ursachen und Folgen von Kohlhaas' Kampf für Gerechtigkeit. Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung des Protagonisten, seine Motivationen und die Darstellung gesellschaftlicher und politischer Strukturen im frühen 19. Jahrhundert.
- Der Kampf um Gerechtigkeit und das Scheitern des Rechtssystems
- Die Entwicklung von Kohlhaas von einem Rechtschaffenen zu einem Racheengel
- Die Darstellung von Adel und Volk sowie deren Konfliktpotential
- Die Rolle von Prinzipientreue und Kompromisslosigkeit
- Die Bedeutung des Symbols der Rappen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1-3: Die Novelle beginnt mit dem Unrecht, das Michael Kohlhaas widerfährt, und seiner vergeblichen Suche nach Gerechtigkeit durch die bestehenden Institutionen. Der Tod seiner Frau führt zu einer entscheidenden Veränderung in Kohlhaas' Handeln und Denken, er beginnt seinen Rachefeldzug.
Kapitel 4: Kohlhaas' Aktionen eskalieren, er gewinnt Anhänger und richtet erheblichen Schaden an. Das Volk steht ambivalent zu seinem Vorgehen.
Kapitel 5: Martin Luther interveniert und versucht, eine friedliche Lösung zu erreichen.
Kapitel 6: Kohlhaas erhält Amnestie und scheint seinen Prozess zu gewinnen.
Kapitel 7: Die Zusammenfassung dieses Kapitels wurde ausgelassen um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Michael Kohlhaas, Gerechtigkeit, Rechtssystem, Rache, Adel, Volk, Prinzipientreue, Kompromisslosigkeit, Fehderecht, Martin Luther, Vetternwirtschaft, Dingsymbol, Amnestie, Krisis, Konflikt, Aufklärung, Kant, Rousseau, Hobbes.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“?
Es geht um einen Rosshändler, der wegen eines erlittenen Unrechts und des Versagens des Rechtssystems einen gewaltsamen Rachefeldzug beginnt.
Was ist der Auslöser für Kohlhaas' Handeln?
Der Junker Wenzel von Tronka behält unrechtmäßig zwei Rappen von Kohlhaas zurück und lässt sie verkommen, was eine Kette tragischer Ereignisse auslöst.
Welche Rolle spielt Martin Luther in der Erzählung?
Luther tritt als moralische Instanz auf, die Kohlhaas zur Besinnung bringen will und ihm schließlich eine Amnestie für einen rechtmäßigen Prozess vermittelt.
Was symbolisieren die Rappen?
Die Rappen sind das zentrale Dingsymbol für das erlittene Unrecht und den unbedingten Rechtsanspruch des Protagonisten.
Warum scheitert die Rechtsfindung für Kohlhaas anfangs?
Wegen Korruption und Vetternwirtschaft innerhalb des Adels und der Justiz, die den Junker von Tronka schützen.
- Arbeit zitieren
- Reinhard Welle (Autor:in), 2011, Analytischer Interpretationsaufsatz Heinrich v. Kleist: Michael Kohlhaas 12. Klasse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183783