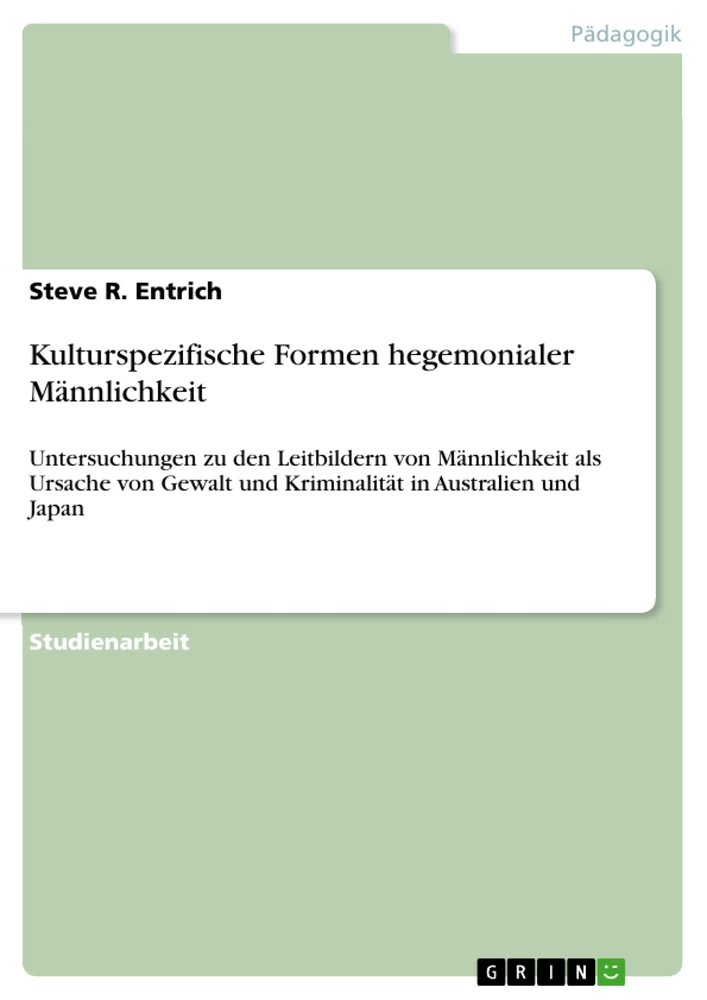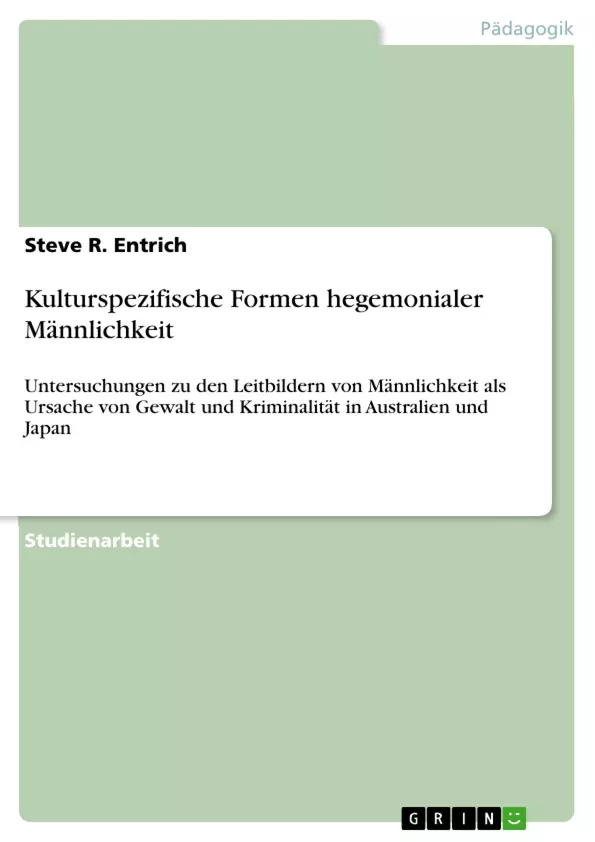Gewaltverbrechen sind heutzutage in allen Industrienationen noch immer an der Tagesordnung. Auffällig ist dabei stets, dass laut vorliegender Kriminalitäts- und Viktimisierungsdaten vor allem Vertreter des männlichen Geschlechts das Gewaltmonopol auf ihrer Seite haben. Gewalt ist dabei nicht nur gegenüber Frauen, welche somit zu Opfern hegemonialer Männlichkeit werden, auffällig, sie dient Männern auch zur Kontrolle anderer Männer. Geschlecht, Kriminalität und die Kontrolle derselben sollten hierbei nicht im traditionellen Verständnis einer männlichen Geschlechtsrolle oder der männlichen Sozialisation aufgefasst werden, schließlich gibt es bei weitem nicht nur die eine Dimension von „Geschlecht“, sondern derer viele verschiedenartige und nicht selten widersprüchliche Formen. Daher erscheint es wichtig, unterschiedliche kulturelle Traditionen miteinander zu vergleichen, in denen Männlichkeit ihren Ausdruck in Form von Gewalt verschiedenster Art findet.
Die vorliegende Arbeit werden existierende Formen hegemonialer Männlichkeit mit Hinblick auf die Männlichkeitsdarstellungen und Leitbilder von Männlichkeit verschiedener Kulturen im Hinblick auf deren Beeinflussung von Kriminalität und Gewalt, vor allem gegenüber dem weiblichen Geschlecht, untersucht. Dabei werden, von Deutschland ausgehend, Japan und Australien als Kulturbeispiele dienen, um der grundlegenden Frage ob und inwiefern Gewalt und Kriminalität in verschiedenen Gesellschaften durch die kulturspezifischen Darstellungen von Männlichkeit beeinflusst bzw. hervorgerufen werden. Dazu werden zunächst die historischen Grundlagen für die Männlichkeitsbilder der beiden Vergleichsländer untersucht, bevor vor allem das japanische Geschlechterverhältnis näher betrachtet und damit in Verbindung stehende, weit verbreitete Fehleinschätzungen aus Sicht der westlichen Welt offengelegt werden. Anschließend sollen Kriminalität und Gewalt, besonders sexueller Natur, näher betrachtet werden, um der Beantwortung der anfangs gestellten Frage näher zu kommen. Ein besonderes Exempel für gewalttätige Männergemeinschaften in heutigen Gesellschaften sollen hierbei Jugendgangs bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Kulturspezifische Entwicklung der Leitbilder von Männlichkeit
- I. Das australische Verständnis von Männlichkeit
- a) Die Schaffung eines Männlichkeitsideals auf Grundlage des bushman
- b) Der Australier der Zukunft, der Coming Man
- II. Männlichkeit und Geschlechterverhältnis in Japan
- a) Die andere Grundlage für Männlichkeit: Der tugendhafte samurai
- b) Das japanische Geschlechterverhältnis aus westlicher Sicht
- I. Das australische Verständnis von Männlichkeit
- B. Kriminalität und Gewalt im Kulturvergleich
- I. Sexuelle Gewalt vor dem Hintergrund kulturspezifischer Leitbilder von Männlichkeit
- II. Kriminalität in Jugendgangs
- Zusammenfassung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die kulturspezifischen Formen hegemonialer Männlichkeit in Australien und Japan und deren Einfluss auf Kriminalität und Gewalt, insbesondere gegenüber Frauen. Die Arbeit analysiert die historischen Grundlagen der Männlichkeitsbilder in beiden Ländern und beleuchtet das japanische Geschlechterverhältnis aus westlicher Sicht. Darüber hinaus werden Kriminalität und Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, im Kontext der kulturspezifischen Leitbilder von Männlichkeit betrachtet. Jugendgangs dienen als Beispiel für gewalttätige Männergemeinschaften in heutigen Gesellschaften.
- Kulturspezifische Entwicklung der Leitbilder von Männlichkeit in Australien und Japan
- Einfluss von Männlichkeitsbildern auf Kriminalität und Gewalt
- Das japanische Geschlechterverhältnis aus westlicher Sicht
- Sexuelle Gewalt im Kontext von Männlichkeitsbildern
- Jugendgangs als Beispiel für gewalttätige Männergemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Gewaltverbrechen im Kontext hegemonialer Männlichkeit dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit, unterschiedliche kulturelle Traditionen zu vergleichen, um die vielfältigen Formen von Männlichkeit und deren Einfluss auf Gewalt zu verstehen.
Kapitel A untersucht die kulturspezifische Entwicklung der Leitbilder von Männlichkeit in Australien und Japan. In Australien wird die Entstehung des Männlichkeitsideals auf Grundlage des bushman, des im Outback lebenden Ex-Sträflings, beleuchtet. Der bushman repräsentiert ein Bild des freien, unabhängigen und ungebundenen Mannes, das durch seine Sträflingsherkunft und seine nomadisierende Existenz in einer Männergemeinschaft geprägt ist. In Japan wird die andere Grundlage für Männlichkeit, der tugendhafte samurai, betrachtet. Der samurai verkörpert ein Ideal von Tapferkeit, Loyalität und Selbstdisziplin, das tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist.
Kapitel B befasst sich mit Kriminalität und Gewalt im Kulturvergleich. Es wird untersucht, wie die kulturspezifischen Leitbilder von Männlichkeit sexuelle Gewalt beeinflussen. Darüber hinaus werden Jugendgangs als Beispiel für gewalttätige Männergemeinschaften in heutigen Gesellschaften betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen hegemoniale Männlichkeit, kulturspezifische Leitbilder, Gewalt, Kriminalität, Australien, Japan, Geschlechterverhältnis, sexuelle Gewalt, Jugendgangs, bushman, samurai.
Häufig gestellte Fragen zu hegemonialer Männlichkeit
Was ist hegemoniale Männlichkeit?
Es beschreibt eine Form von Männlichkeit, die eine dominante Position in der Gesellschaft einnimmt und Gewalt oft als Mittel zur Kontrolle von Frauen und anderen Männern nutzt.
Was prägt das australische Männlichkeitsideal?
Die Grundlage bildet der "bushman" aus dem Outback – ein Bild des freien, unabhängigen und ungebundenen Mannes, geprägt durch Sträflingsherkunft und Männergemeinschaften.
Welches Ideal dominiert die japanische Männlichkeit?
Historisch ist das Bild des tugendhaften Samurai zentral, das Werte wie Tapferkeit, Loyalität und Selbstdisziplin verkörpert.
Wie beeinflussen diese Leitbilder die Kriminalität?
Die Arbeit untersucht, wie kulturspezifische Männlichkeitsdarstellungen Gewalt und Kriminalität, insbesondere sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, hervorrufen oder begünstigen können.
Warum werden Jugendgangs in der Arbeit thematisiert?
Jugendgangs dienen als Exempel für gewalttätige Männergemeinschaften in modernen Gesellschaften, in denen Männlichkeit durch Gewalt demonstriert wird.
- Quote paper
- Magister Artium Steve R. Entrich (Author), 2008, Kulturspezifische Formen hegemonialer Männlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183910