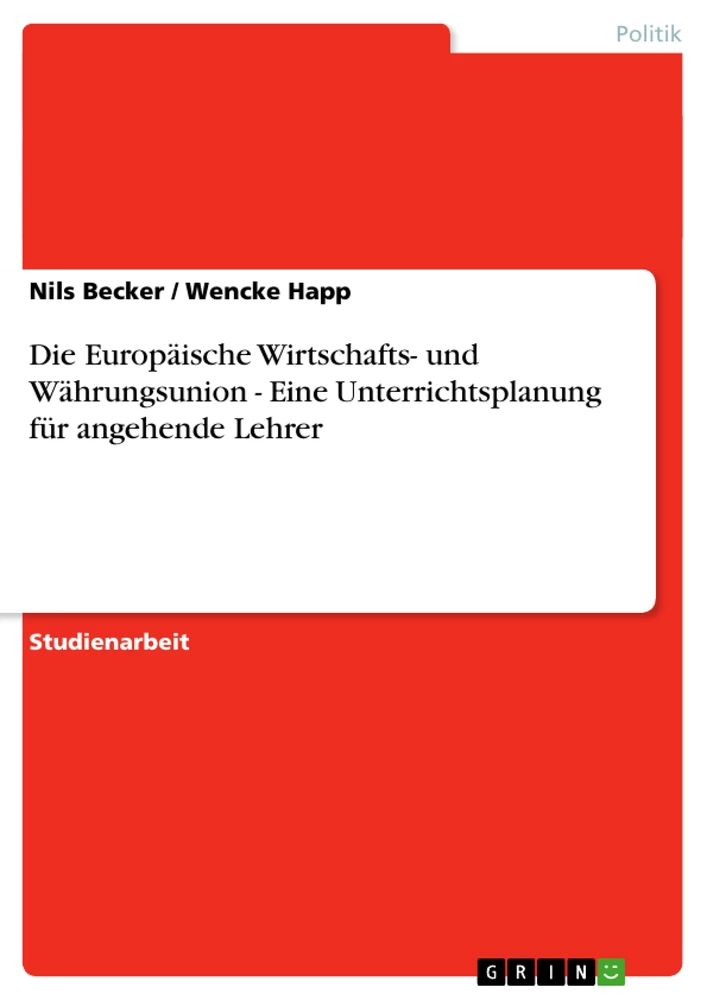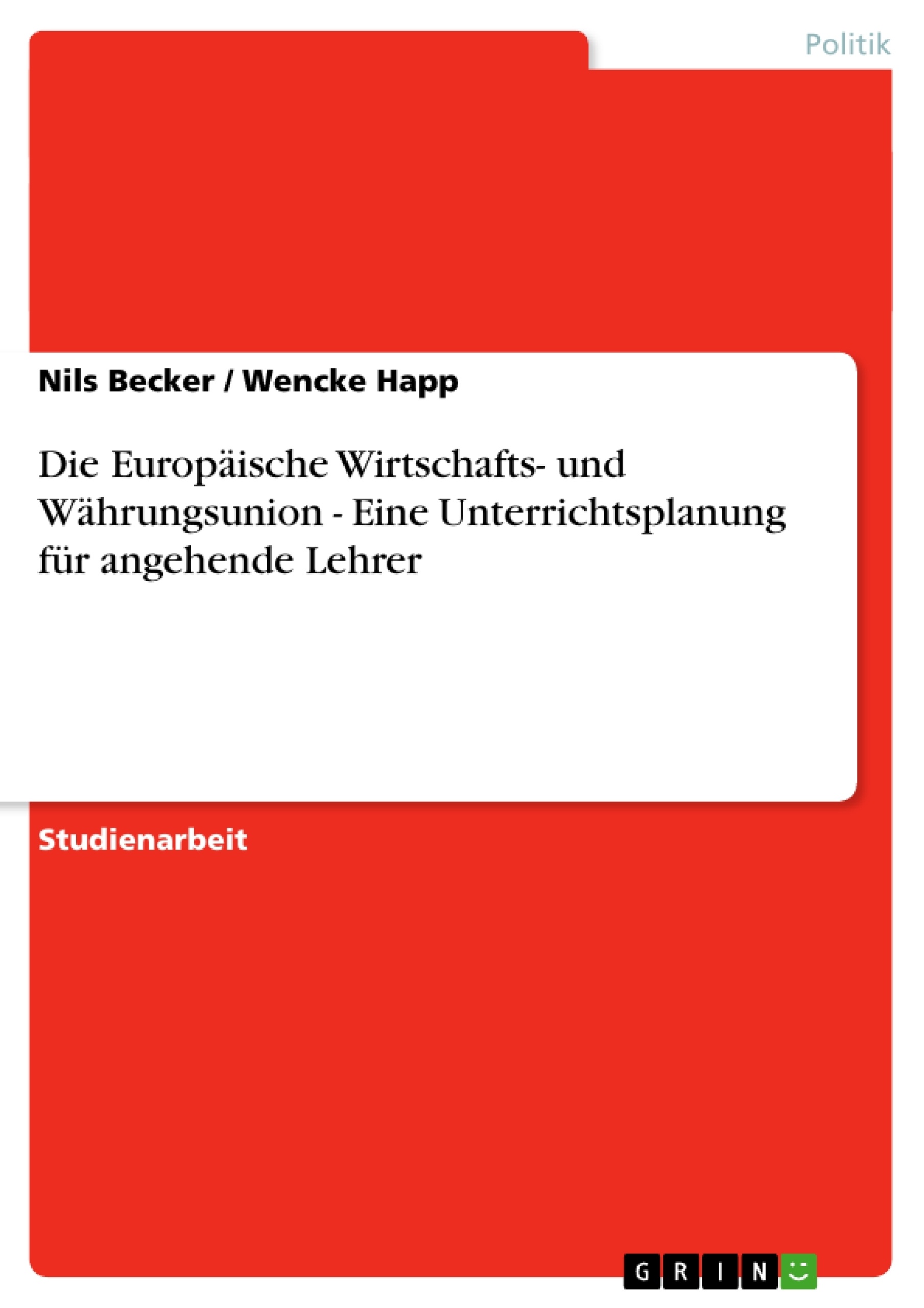Welche zentrale Verantwortung trägt der Lehrer oder die Lehrerin im
Unterricht? Diese Frage sollten wir uns beantworten, bevor wir daran denken zu
unterrichten. Was bezwecken wir mit unserem Unterricht? Unterrichten wir
wirklich oder Indoktrinieren wir? An dieser Stelle möchte ich die Aussagen von
Jean - Francois Revel1 aufgreifen. Revel ist der Meinung, daß die Lehrer
diejenigen sind, welche das Wissen vermitteln, oder das, was als Wissen gilt. Die
Lehrer und Lehrerinnen sind diejenigen, die die Kultur an ihrem Ursprung prägen
und den Schlüssel zum Buch der Weisheit in ihren Händen halten. Sie sind es, die
jeder Generation den Zugang zu ihrer Weltanschauung öffnen. Vom
Grundschullehrer bis hin zum Universitätsprofessor sind sie alle an diesem
Prozess mehr oder weniger stark beteiligt. Die größte Verantwortung liegt in der
Hand jener Gruppe von Lehrern, die Kinder im Alter von zehn bis achtzehn
Jahren erziehen. Sie sind es, die wahrscheinlich für die Weltanschauung der
Gesellschaft am bedeutendsten sind. Sie rekonstruieren das Bild der
unterschiedlichen Kulturen und setzen es kinder- und jugendgerecht wieder neu
zusammen. Sie üben damit die Funktion eines Dolmetschers aus und geben jeder
Generation in komprimierter Form den neusten Stand von Wissen und Werten
mit. Und in dieser Funktion des Dolmetschers liegt auch die größte Gefahr.
Jeder Übersetzer kann dem Orginaltext untreu werden, hierfür gibt es in der
menschlichen Geschichte nur allzuviele Beispiele. Der Dolmetscher kann den
Text je nach belieben manipulieren, sofern die Schüler und Schülerinnen nicht
die Möglichkeit haben, dieses auch zu überprüfen. Deshalb ist es auch
angeraten, im Unterricht zu allen Texten Quellenangaben anzugeben. Allein um
den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, das gelernte Wissen
auch zu überprüfen. Der Lehrer oder die Lehrerin hat also die Möglichkeit zu
unterrichten oder zu indoktrinieren. [...]
1 Jean Francois Revel, geboren 1924 in Marsaille, war Professor der Philosophie in Mexiko, Florenz, Lille und
Paris, ehe er zum Journalismus wechselte. Im France-Observateur und L`Express leitete er die
Literaturredaktion, 1978 wurde er Direktor des L`Express. In mehr als 20 Büchern hat er sich mit Problemen
der Philosophie, der Kultur und der Welt von heute ausführlich und nonkonformistisch auseinander gesetzt.
Seine Bücher lösen immer heftige Reaktionen aus, zuletzt in deutscher Sprache So enden die Demokratien
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorbemerkung
- 1. Vorbereitung des Unterrichtsvorhabens
- 1.1 Studien im Arbeitsvorhaben
- 1.2 Politikdidaktische Studien
- 2. Strukturierung des geplanten Unterrichtsvorhabens
- 2.1 Politikdidaktische Vorüberlegungen
- 2.2 Was kann man vermitteln?
- 2.3 Politikdidaktische Perspektivbildung
- 2.3.1 Welche Bedeutsamkeit hat der Lerngegenstand für die Lerngruppe aus der Sicht des Lehrenden?
- 2.3.2 Legitimation des Gegenstands im Kontext der Intention schulischer politischer Bildung
- 2.3.3 Politikdidaktische Perspektive des Vorhabens
- 3. Themen des Unterrichts
- 3.1 Ein geschichtlicher Überblick der WWU
- 3.1.1 Vorläufer der Wirtschafts- und Währungsunion
- 3.1.2 Der Binnenmarkt
- 3.1.2.1 Der Weg zum Binnenmarkt
- 3.1.2.2 Die vier Grundfeiheiten des Binnenmarktes
- 3.1.2.3 Stand der Verwirklichung
- 3.1.3 Die Regelung des Maastrichter Vertrages
- 3.1.3.1 Die Vorgeschichte
- 3.1.3.2 Die Vertragsinhalte
- 3.1.3.3 Reformbilanz
- 3.2 Das Europäische Währungssystem
- 3.2.1 Die ECU (European Currency Unit)
- 3.2.2 Das Europäische Wechselkurs- und Interventionssystem
- 3.2.2.1 Licht und Schatten fester und freier Wechselkurse
- 3.2.3 Die Kredtimechanismen
- 3.2.4 Ausblick
- 3.3 Die Konvergenzkriterien, der Stabilitätspakt und die Mitgliedstaaten
- 3.3.1 Die Konvergenzkriterien
- 3.3.2 Die Mitgliedstaaten - die elf Euro-Länder
- 3.3.3 Der Stabilitätspakt
- 3.3.3.1 Die rechtlichen Konstruktionsmerkmale
- 3.3.3.2 Auslösung des Verfahrens
- 3.3.3.3 Die Sanktionen
- 3.3.3.4 Offene Fragen
- 3.3.3.5 Gesamtwertung
- 3.4 Das Europäische Währungsinstitut
- 3.4.1 Die Geschichte und politische Bedeutung des EWI
- 3.5 Die Europäische Zentralbank
- 3.5.1 Die Struktur
- 3.5.2 Die Aufgaben der EZB
- 3.5.3 Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank
- 3.5.4 Geldpolitische Strategie
- 3.5.5 Das geldpolitische Instrumentarium
- 3.5.6 Stabilitätsorientierung vor Nationalität
- 3.6 Die Ziele und Instrumente der WWU
- 3.6.1 Die Währungsunion
- 3.6.2 Die Wirtschaftspolitik
- 3.7 Vorteile und Risiken einer einheitlichen Währung
- 3.7.1 Die Vorteile einer einheitlichen Währung
- 3.7.2 Die Risiken einer einheitlichen Währung
- 3.8 Der Euro
- 3.9 Die Währungsunion - Einiger Europas
- 3.1 Ein geschichtlicher Überblick der WWU
- Die Geschichte und die Entstehung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
- Die verschiedenen Institutionen der WWU und ihre Aufgaben
- Die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der WWU
- Die Vorteile und Risiken einer einheitlichen Währung
- Die Bedeutung der WWU für die europäische Integration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Unterrichtsplanung für angehende Lehrer zum Thema "Die Wirtschafts- und Währungsunion". Ziel ist es, den Teilnehmern ein fundiertes Verständnis der europäischen Integrationsprozesse und der damit verbundenen Herausforderungen zu vermitteln. Die Planung soll Methoden und didaktische Ansätze vorstellen, die eine effektive und ansprechende Vermittlung des komplexen Themas im Schulunterricht ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Vorbemerkung, die die zentrale Rolle des Lehrers im Unterricht und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit Wissen und Werten beleuchtet. Im ersten Kapitel wird die Vorbereitung des Unterrichtsvorhabens erläutert, wobei die relevanten Studien und politikdidaktischen Überlegungen im Fokus stehen. Das zweite Kapitel widmet sich der Strukturierung des Unterrichtsvorhabens und beleuchtet die politikdidaktischen Perspektiven sowie die Legitimation des Themas im Kontext der schulischen politischen Bildung.
Im dritten Kapitel folgt eine umfassende Darstellung der Themen des Unterrichts, die einen historischen Überblick über die WWU bietet, den Binnenmarkt und die Regelung des Maastrichter Vertrages behandelt. Weiterhin werden das Europäische Währungssystem, die Konvergenzkriterien und der Stabilitätspakt, das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Zentralbank sowie die Ziele und Instrumente der WWU beleuchtet. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Risiken einer einheitlichen Währung thematisiert, um den Schülern ein umfassendes Verständnis der Thematik zu vermitteln. Abschließend wird der Euro als Symbol der europäischen Integration betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, der europäischen Integration, dem Binnenmarkt, dem Maastrichter Vertrag, dem Europäischen Währungssystem, der Europäischen Zentralbank, den Konvergenzkriterien, dem Stabilitätspakt, dem Euro und der Unterrichtsplanung. Die Analyse fokussiert auf die Herausforderungen und Chancen einer einheitlichen Währung sowie die Rolle des Lehrers bei der Vermittlung dieser komplexen Themen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)?
Die WWU ist ein Integrationsprojekt der EU, das die Koordinierung der Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie eine gemeinsame Währung (den Euro) umfasst.
Was sind die Konvergenzkriterien?
Dies sind wirtschaftliche Bedingungen (z. B. Preisstabilität, Haushaltsdisziplin), die EU-Mitgliedstaaten erfüllen müssen, um der Eurozone beitreten zu können.
Welche Aufgaben hat die Europäische Zentralbank (EZB)?
Die Hauptaufgabe der EZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität in der Eurozone sowie die Verwaltung der Geldpolitik.
Was sind Vorteile und Risiken des Euro?
Vorteile sind der Wegfall von Wechselkursrisiken und Preistransparenz; Risiken umfassen den Verlust einer eigenständigen nationalen Geldpolitik.
Was bedeutet der Stabilitätspakt?
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll sicherstellen, dass die Euro-Länder auch nach Einführung der Währung eine solide Haushaltspolitik führen.
- Quote paper
- Nils Becker (Author), Wencke Happ (Author), 1999, Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion - Eine Unterrichtsplanung für angehende Lehrer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18396