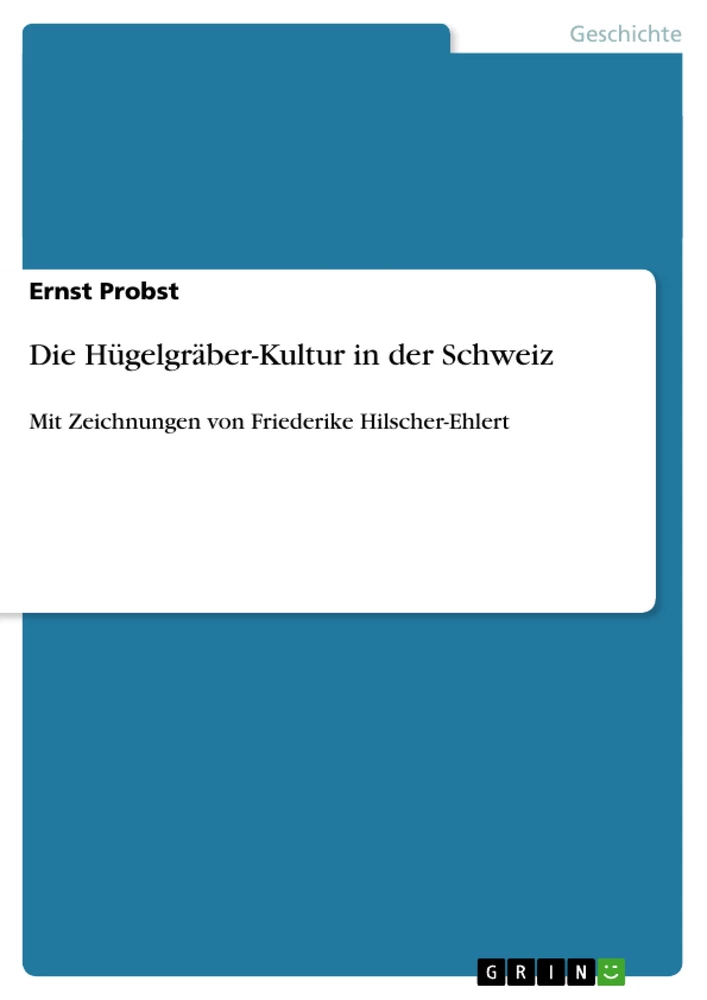Rund 400 Jahre Urgeschichte von etwa 1600 bis 1300/1200 v. Chr. passieren in dem Taschenbuch »Die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz« in Wort und Bild Revue. Geschildert werden die Anatomie der damaligen Ackerbauern, Viehzüchter und Bronzegießer, ihre Siedlungen, Kleidung, ihr Schmuck, ihre Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, ihr Verkehrswesen, Handel und ihre Religion. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz« ist Dr. Gretel Gallay (heute Callesen), Dr. Albert Hafner und Dr. Jürg Rageth gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei seinem Buch »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) unterstützt haben. Es enthält Lebensbilder der wissenschaftlichen Graphikerin Friederike Hilscher-Ehlert aus Königswinter.
Inhaltsverzeichnis
- Die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz
- Einleitung
- Die Hügelgräber
- Die Entstehung der Hügelgräber
- Die Bauweise der Hügelgräber
- Die Bestattungsrituale
- Die Funde in den Hügelgräbern
- Waffen
- Schmuck
- Werkzeuge
- Keramik
- Die Gesellschaft der Hügelgräber-Kultur
- Die soziale Organisation
- Die Religion
- Die Wirtschaft
- Die Bedeutung der Hügelgräber-Kultur
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch befasst sich mit der Hügelgräber-Kultur in der Schweiz während der Bronzezeit. Es untersucht die Entstehung, die Bauweise und die Bestattungsrituale der Hügelgräber sowie die Funde, die in ihnen gemacht wurden. Darüber hinaus werden die soziale Organisation, die Religion und die Wirtschaft der damaligen Gesellschaft beleuchtet. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Hügelgräber-Kultur in der Schweiz zu zeichnen und ihre Bedeutung für die Geschichte der Bronzezeit zu erforschen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Hügelgräber-Kultur in der Schweiz
- Die Bestattungsrituale und die Bedeutung der Hügelgräber
- Die Funde in den Hügelgräbern und ihre Interpretation
- Die soziale Organisation und die Lebensweise der Menschen der Hügelgräber-Kultur
- Die Bedeutung der Hügelgräber-Kultur für die Geschichte der Bronzezeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Hügelgräber-Kultur in der Schweiz. Es werden die historischen und kulturellen Hintergründe beleuchtet, die zur Entwicklung dieser Kultur führten. Das zweite Kapitel widmet sich den Hügelgräbern selbst. Es werden die verschiedenen Bauweisen, die Bestattungsrituale und die Bedeutung der Hügelgräber für die Menschen der Bronzezeit untersucht. Das dritte Kapitel analysiert die Funde, die in den Hügelgräbern gemacht wurden. Es werden Waffen, Schmuck, Werkzeuge und Keramik betrachtet und ihre Bedeutung für die Interpretation der Lebensweise der Menschen der Hügelgräber-Kultur erörtert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Gesellschaft der Hügelgräber-Kultur. Es werden die soziale Organisation, die Religion und die Wirtschaft der damaligen Zeit untersucht. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Hügelgräber-Kultur für die Geschichte der Bronzezeit. Es werden die Auswirkungen der Hügelgräber-Kultur auf die Entwicklung der Kultur und Gesellschaft der Bronzezeit in der Schweiz und darüber hinaus betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Hügelgräber-Kultur, die Bronzezeit, die Schweiz, die Bestattungsrituale, die Funde, die soziale Organisation, die Religion, die Wirtschaft und die Bedeutung der Hügelgräber-Kultur für die Geschichte der Bronzezeit.
Häufig gestellte Fragen
Wann existierte die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz?
Die Hügelgräber-Kultur wird auf den Zeitraum der Bronzezeit zwischen etwa 1600 und 1300/1200 v. Chr. datiert.
Was sind die typischen Merkmale dieser Kultur?
Kennzeichnend sind die Bestattung der Toten unter Erdhügeln sowie eine Gesellschaft, die aus Ackerbauern, Viehzüchtern und Bronzegießern bestand.
Welche Funde wurden in den Schweizer Hügelgräbern gemacht?
Archäologen fanden in den Gräbern Waffen, Schmuck, Werkzeuge, Keramik und Hinweise auf die damalige Kleidung und Haustiere.
Wer ist der Autor des Buches „Die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz“?
Verfasser ist der Wissenschaftsautor Ernst Probst, bekannt für seine Werke zur Ur- und Steinzeit in Deutschland.
Welche Themen zur Lebensweise werden im Buch behandelt?
Das Buch beleuchtet Siedlungen, Verkehrswesen, Handel, soziale Organisation und die religiösen Vorstellungen der Menschen dieser Zeit.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2011, Die Hügelgräber-Kultur in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183971