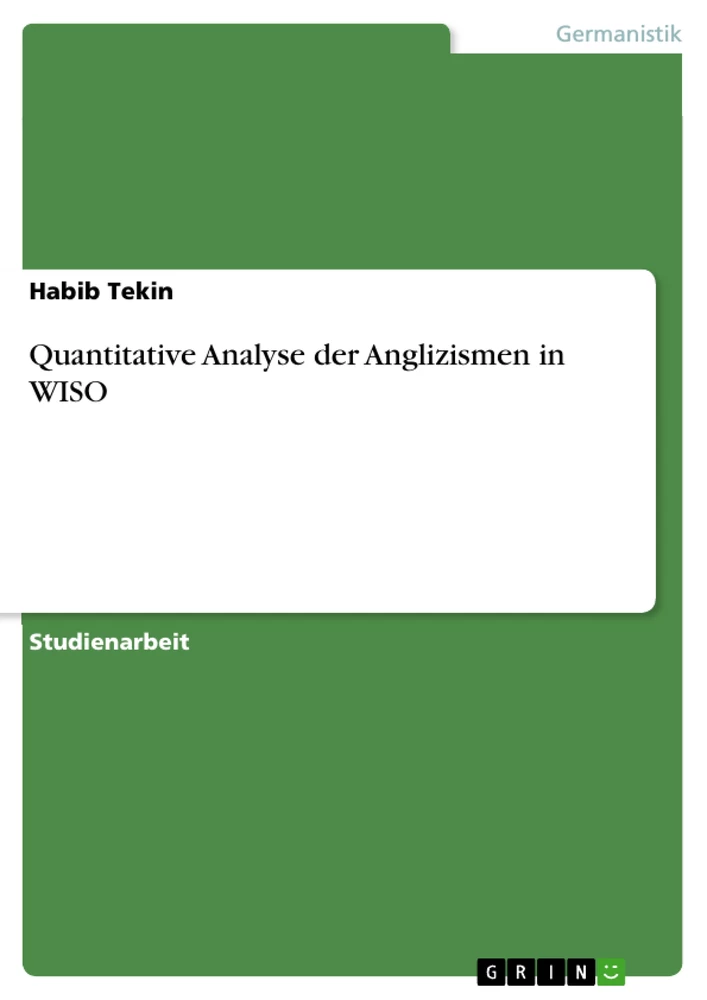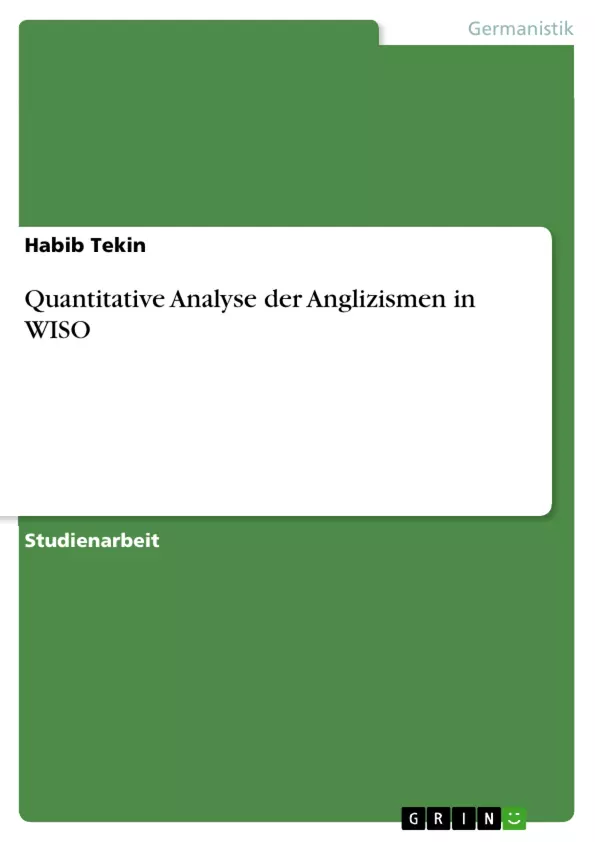In der vorliegenden Hausarbeit werden drei Anglizismen ausgewählt und im Korpus analysiert. Demzufolge ist es äußerst sinnvoll die Definition von Anglizismen nach dem deutschen Duden aufzugreifen:
[Anglizismus ist eine] Übertragung einer für das britische Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache. (Duden 2000, S.163)
Solche Anglizismen weisen vor allem nach dem zweiten Weltkrieg einen enormen Zuwachs im deutschen Sprachgebrauch – insbesondere im Digitalbereich, wie etwa in der Computersprache, in der Technologie, aber auch in Modebranchen (…) – auf. Dementsprechend sollen Anglizismen in verschiedenen Korpora untersucht und quantitativ analysiert werden.
Die untersuchten Suchlexeme sind – pimpen, tunen und stylen – Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Hausarbeit. Der Zusammenhang der oben genannten Lexeme liegt darin, dass alle drei Verben sind, die eine Veränderung verursachen. Beispielsweise pimpt oder tunt man ein Auto, damit es am Ende – je nach Betrachter – schöner aussieht oder man stylt die Haare. Das Resultat der Veränderungen sind für die oben genannten Lexeme positiv konnotiert und resultieren demnach etwas Schönes.
In einem speziell ausgewählten Korpus, genauer gesagt, in einer expliziten Zeitung, sollen die Lexeme ausgewählt und untersucht werden. Dabei sollen Anglizismen und die damit verbundenen Schwierigkeiten im Deutschen erforscht werden; beispielsweise die Problematik in der Orthographie, Semantik und Morphologie. Werden die Schreibformen der englischen Wörter einfach im Deutschen aufgenommen oder müssen diese Änderungen vornehmen?
Aber auch das Wachstum – falls es eines gibt – soll dargestellt werden. Wenn man nachweisen kann, dass Anglizismen nur für einen bestimmten Zeitraum im deutschen Sprachgebrauch existieren und dann wieder verschwinden, dann kann man davon ausgehen, dass die Veränderung bzw. der Einfluss auf die deutsche Sprache sehr schwer ist und dass es sich hierbei nur um einen Trend oder eine Sprachmode handelt. Wenn auch einige Bereiche wie etwa die Computersprache uns es nicht ermöglichen, das oben genannte zu beweisen, sollten dennoch andere Bereiche der Anglizismen analysiert werden, wo es möglicherweise doch der Fall sein könnte. Dafür kann man sich die Jugendsprache bzw. die Sprache in den Chats, der Mode, etc. vorstellen.
[...]
Welche Veränderungen, Schwierigkeiten und Häufigkeiten weisen Anglizismen in den letzten fünf Jahren im deutschen Sprachgebrauch auf?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- QUANTITATIVE KORPUSANALYSE
- ETYMOLOGISCHE Aspekte DER SUCHLEXEME
- Stylen
- Tunen
- Pimpen
- DATENAUFBEREITUNG UND -ANALYSE IN WISO.
- ETYMOLOGISCHE Aspekte DER SUCHLEXEME
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der quantitativen Analyse von Anglizismen im Korpus WISO. Ziel ist es, die etymologischen Aspekte der ausgewählten Anglizismen "stylen", "tunen" und "pimpen" zu untersuchen und deren Verwendungshäufigkeit im Korpus WISO zu analysieren.
- Etymologie und Bedeutung der Anglizismen
- Quantitative Analyse der Anglizismen im Korpus WISO
- Veränderungen und Schwierigkeiten im deutschen Sprachgebrauch
- Häufigkeit und Entwicklung der Anglizismen in den letzten fünf Jahren
- Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und definiert den Begriff "Anglizismus". Sie erläutert die Auswahl der Suchlexeme "stylen", "tunen" und "pimpen" und deren Bedeutung im Kontext von Veränderungen und Verbesserungen.
Das Kapitel "Quantitative Korpusanalyse" befasst sich mit der etymologischen Herleitung der Suchlexeme. Es werden die Ursprünge und Bedeutungsentwicklungen der Wörter "stylen", "tunen" und "pimpen" im Englischen und Deutschen beleuchtet.
Das Kapitel "Datenaufbereitung und -analyse in WISO" behandelt die quantitative Analyse der Suchlexeme im Korpus WISO. Es werden die Ergebnisse der Analyse präsentiert und die Häufigkeit der Anglizismen im Korpus untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Anglizismen, quantitative Korpusanalyse, Etymologie, "stylen", "tunen", "pimpen", WISO-Korpus, Datenanalyse, Sprachwandel, Sprachgebrauch, Häufigkeit, Veränderungen, Schwierigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Anglizismus?
Ein Anglizismus ist die Übertragung einer für das Englische charakteristischen sprachlichen Erscheinung in die deutsche Sprache.
Welche Anglizismen werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Verben "stylen", "tunen" und "pimpen", die alle eine (positive) Veränderung oder Aufwertung beschreiben.
Was ist das Ziel der quantitativen Korpusanalyse?
Es wird untersucht, wie häufig diese Begriffe im WISO-Korpus vorkommen und ob es sich um dauerhafte Sprachveränderungen oder kurzfristige Trends handelt.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich durch Anglizismen im Deutschen?
Es entstehen oft Probleme in der Orthographie (Schreibweise), Semantik (Bedeutung) und Morphologie (Beugung der Wörter im Satz).
In welchen Bereichen nehmen Anglizismen besonders zu?
Besonders stark ist der Zuwachs in der Computersprache, Technologie, Modebranche sowie in der Jugend- und Chatsprache.
- Quote paper
- Habib Tekin (Author), 2011, Quantitative Analyse der Anglizismen in WISO, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184011