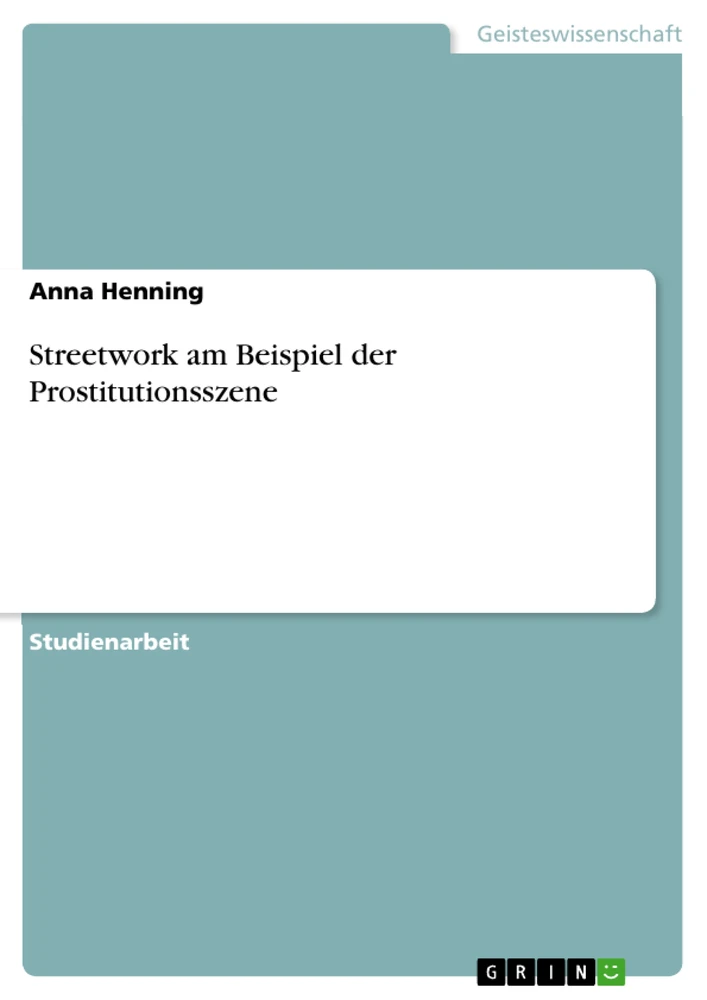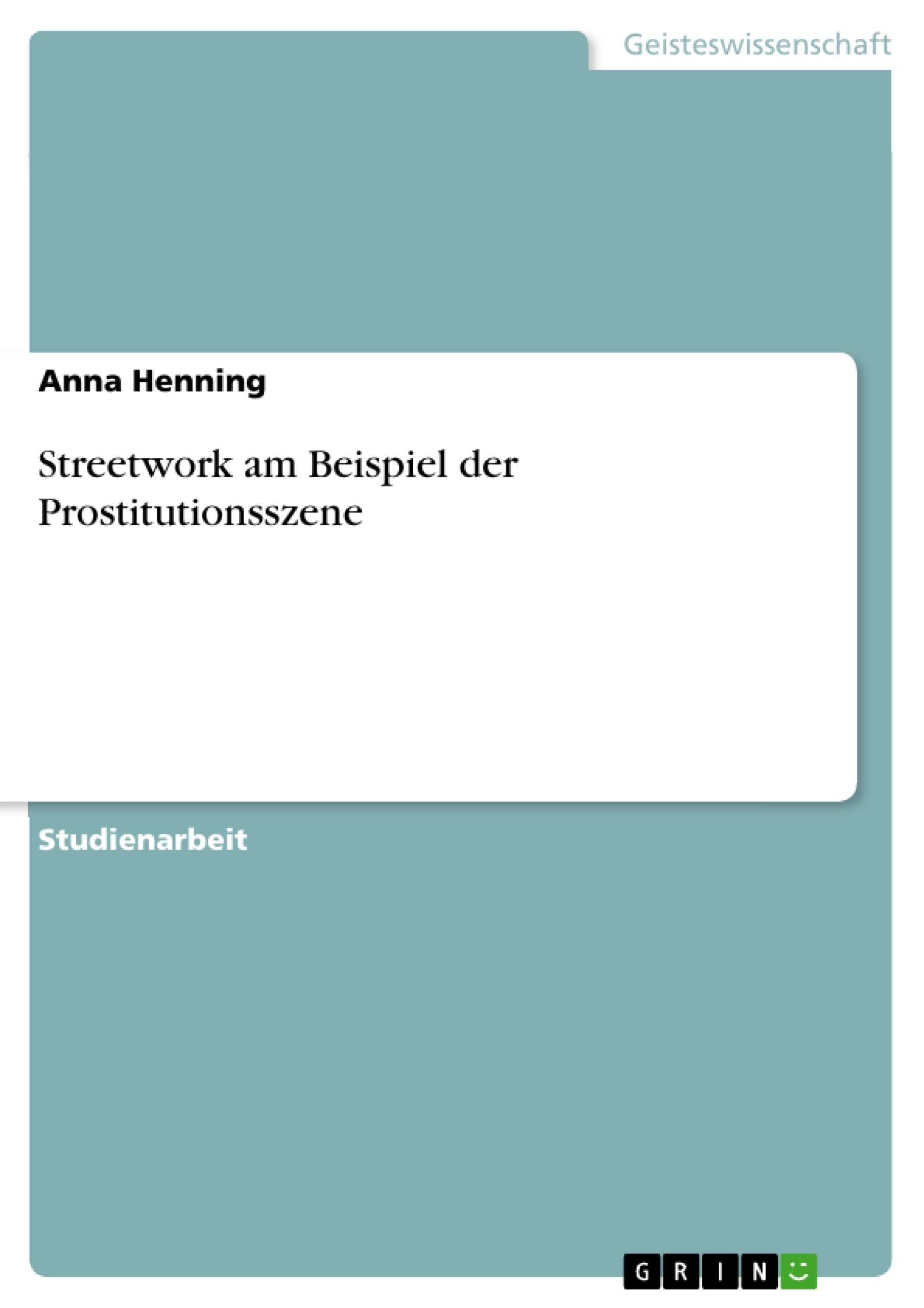Alle Menschen haben besonders eine Sache gemeinsam- sie sind in ihrer Umwelt positiven aber auch negativen Einflüssen ausgesetzt. Der Unterschied zwischen ihnen ist, dass sie je nach individueller Lebenssituation, Charaktereigenschaft und Hintergrund ganz unterschiedlich damit umgehen. Vor allem junge Menschen müssen sich in der Pubertät vielen Herausforderungen stellen und geraten dadurch manchmal in Probleme, aus denen es nicht so einfach ist, wieder herauszukommen. Wenn ich in meiner Heimatstadt Stuttgart unterwegs bin, sehe ich immer wieder Punks, sich exzessiv betrinkende Jugendliche oder Obdachlose auf der Straße. Zusätzlich hör ich oft von Kriminalität, Gewalt und rechtsextremen Übergriffen im Fernsehen.
Viele Menschen empfinden bei solchen Nachrichten immer Wut, Hass oder Unverständnis, doch diese Taten passieren nicht einfach so. Denn hinter jedem abweichenden Verhalten stecken große Probleme, Sorgen oder emotionale Schwierigkeiten. Deswegen ist es wichtig, dass man einen Weg findet, auch diese Menschen zu erreichen. Jedoch ist das nicht immer einfach. Denn bereits während meines Freiwilligen Sozialen Jahres im Jugendhaus ist mir aufgefallen, dass wir selbst mit unseren vielfältigen Angeboten nicht alle Jugendlichen erreichen konnten, weil sie sich von diesen nicht angesprochen fühlten oder einfach weil sie nicht zur Zielgruppe der Einrichtung gehörten. Deswegen ist meiner Meinung nach das Berufsfeld Streetwork auch sehr wichtig, da es Möglichkeiten hat, die Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld zu gewinnen und ihnen zu helfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Streetwork
- Geschichte
- Tätigkeitsbereiche
- Konzeptionelle Orientierungen
- Rahmenbedingungen
- Professionelles Handeln
- Begriffsdefinition
- Kontaktaufnahme
- Grundsätze
- Formen
- Recht auf der Straße
- Probleme und Herausforderungen
- Streetwork in der Prostitutionsszene
- Prostitution und Soziale Arbeit
- Aufgaben
- Aufsuchende Arbeit für Frauen in der Prostitution
- Notwendigkeit
- Der Nachtbus am Straßenstrich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Berufsfeld Streetwork und beleuchtet die methodische Arbeitsweise. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, denen sich Sozialarbeiter in diesem Arbeitsfeld stellen müssen, sowie auf den Strategien, um mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen, ohne sie zu vertreiben oder sich aufzudrängen. Darüber hinaus wird das Thema Streetwork in der Prostitutionsszene näher betrachtet. Die Arbeit untersucht die Bedeutung sozialer Arbeit in diesem sensiblen Bereich und beleuchtet die spezifischen Aufgaben eines Streetworkers, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Frauen in der Prostitution.
- Methodische Arbeitsweise von Streetwork
- Herausforderungen im Berufsfeld Streetwork
- Kontaktaufnahme mit Menschen auf der Straße
- Streetwork in der Prostitutionsszene
- Aufgaben eines Streetworkers in der Prostitutionsszene
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Studienarbeit ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund des Autors. Sie stellt die Relevanz des Themas Streetwork heraus und erläutert die Motivation, sich mit der Methode und ihren Herausforderungen auseinanderzusetzen. Darüber hinaus wird der Fokus auf das Unterthema „Streetwork in der Prostitutionsszene“ gelegt und dessen Relevanz im Kontext der Gesellschaft beleuchtet.
- Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff Streetwork und erläutert die Grundprinzipien dieser Arbeitsweise. Es wird dargestellt, wie Streetwork als ein eigenständiges Arbeitsfeld und eine Methode der sozialen Arbeit verstanden wird. Darüber hinaus werden die Konzepte der lebensweltorientierten Sozialarbeit und der aufsuchenden Arbeit erläutert.
- Streetwork: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Streetworks, beginnend mit den Anfängen in Amerika und den Entwicklungen in Deutschland. Es werden wichtige Meilensteine und die Herausforderungen beleuchtet, die zur Etablierung und Weiterentwicklung des Streetworks führten.
- Professionelles Handeln: Dieses Kapitel befasst sich mit dem professionellen Handeln im Streetwork. Es wird die Bedeutung der Kontaktaufnahme mit Klienten, die zugrunde liegenden Grundsätze und die verschiedenen Formen der Kontaktaufnahme beleuchtet. Zudem wird das Recht auf der Straße als ein wichtiger Aspekt des professionellen Handelns im Streetwork behandelt.
- Probleme und Herausforderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, denen sich Sozialarbeiter im Streetwork gegenübersehen. Es werden die spezifischen Schwierigkeiten bei der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen und die komplexen Lebensumstände der Klienten beleuchtet.
- Streetwork in der Prostitutionsszene: Dieses Kapitel widmet sich dem Unterthema Streetwork in der Prostitutionsszene. Es behandelt die Bedeutung sozialer Arbeit in diesem Bereich und beleuchtet die spezifischen Aufgaben eines Streetworkers, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Frauen in der Prostitution.
Schlüsselwörter
Die Studie beschäftigt sich mit dem Themenfeld Streetwork, einem eigenständigen Arbeitsfeld und einer Methode der sozialen Arbeit, die sich durch die Lebensweltorientierung und die aufsuchende Arbeit auszeichnet. Wichtige Aspekte sind das professionelle Handeln, die Kontaktaufnahme mit Klienten, das Recht auf der Straße sowie die Herausforderungen und Probleme im Arbeitsfeld. Darüber hinaus werden die Bedeutung sozialer Arbeit in der Prostitutionsszene und die spezifischen Aufgaben eines Streetworkers in diesem Kontext beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Streetwork?
Streetwork zielt darauf ab, Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu erreichen, denen herkömmliche soziale Angebote nicht gerecht werden.
Welche Rolle spielt Streetwork in der Prostitutionsszene?
Sie bietet Unterstützung und Beratung für Frauen in der Prostitution an, oft durch aufsuchende Arbeit wie den Einsatz eines Nachtbusses.
Was sind die Grundsätze der professionellen Kontaktaufnahme?
Wichtige Grundsätze sind Freiwilligkeit, Akzeptanz und das Vermeiden von Aufdrängen oder Vertreibung der Klienten.
Was wird unter "Recht auf der Straße" verstanden?
Es bezeichnet die rechtlichen Rahmenbedingungen und Befugnisse, innerhalb derer Streetworker und Klienten im öffentlichen Raum agieren.
Welche Herausforderungen gibt es in diesem Berufsfeld?
Sozialarbeiter sind mit komplexen Lebensumständen, Suchtproblematiken und der Schwierigkeit konfrontiert, Vertrauen zu schwer erreichbaren Zielgruppen aufzubauen.
- Arbeit zitieren
- Anna Henning (Autor:in), 2011, Streetwork am Beispiel der Prostitutionsszene, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184039