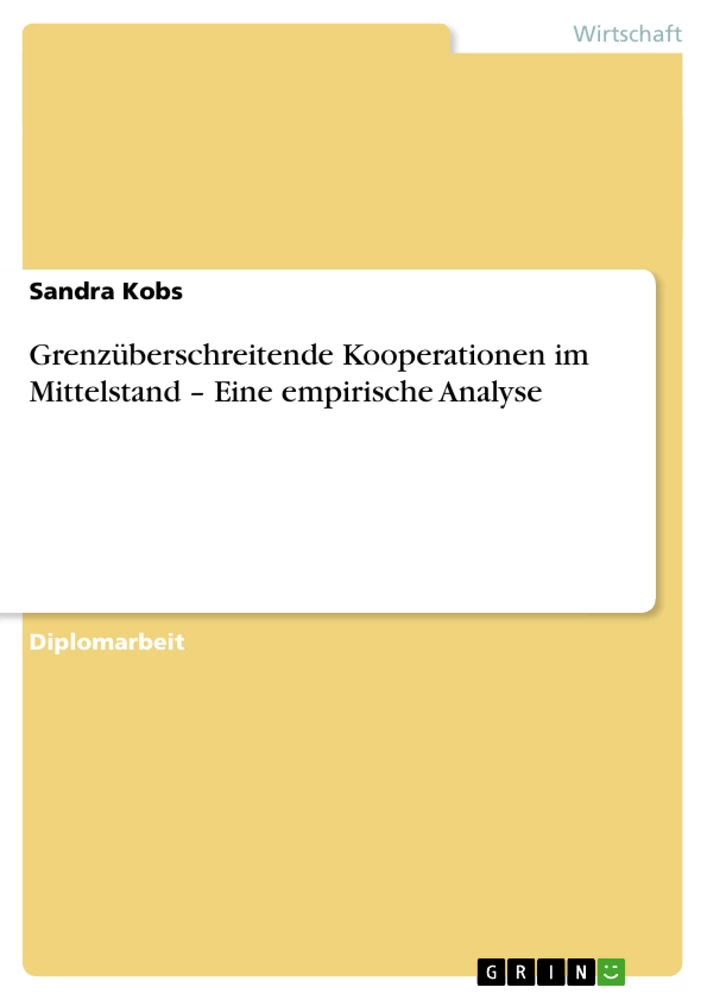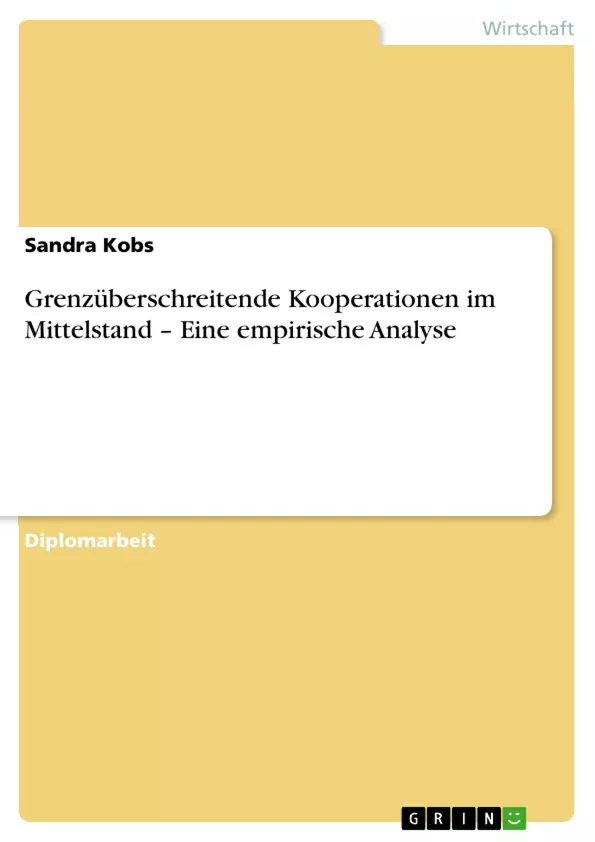Die deutsche Wirtschaft wird von mittelständischen Unternehmen dominiert: 99,7 % aller Unternehmen sind mittelständisch geprägt und über 70 % aller Beschäftigten sind in mittelständischen Unternehmen tätig (vgl. IfM, 2008). Sie erwirtschaften knapp die Hälfte der Bruttowertschöpfung und sind maßgebliche Treiber von Innovationen (vgl. Haussmann, Holtbrügge, Rygl & Schillo, 2006, S. 1).
So enorm ihre Bedeutung für den heimischen Markt auch ist, international spielen deutsche mittelständische Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Geringe Eigenkapitalquoten, unzureichende Management- und Personalkapazitäten und fehlendes Internationalisierungs-Know-how erschweren mittelständischen Unternehmen den Eintritt in ausländische Märkte (vgl. Backes-Gellner & Huhn, 2000, S. 186 f.; Haussmann et al., 2006, S. 1). War jedoch eine rein nationale Ausrichtung in den achtziger und neunziger Jahren noch vertretbar, ist die wirtschaftliche Existenz mittelständischer Unternehmen heutzutage durch die fortschreitende Globalisierung der Märkte und dem damit verbundenen erhöhten Wettbewerbsdruck vehement gefährdet (vgl. Bassen, Behnam & Gilbert 2001, S. 416; Rautenstrauch, Generotzky & Bigalke, 2003, S. 3). Mittelständische Unternehmen sind daher gezwungen, vorhandene Wettbewerbsvorteile zu sichern und sukzessive zu erweitern (vgl. Cutura & Kraus, 2005, S. 1). Grenzüberschreitende Kooperationen bieten mittelständischen Unternehmen in Anbetracht dieser veränderten Anforderungen Flexibilitäts- und Größenvorteile sowie die Möglichkeit, Auslandsmärkte und damit Wissen und Ressourcen mit einem, im Vergleich zu marktlichen bzw. hierarchischen Formen, geringen Ressourcenaufwand zu erschließen (vgl. Belzer, 1993, S. 13 ff.; Inkpen, 2001, S. 409; Liepmann, Bonkamp & Gohs, 2006, S. 19; Lubritz, 1998, S. 34 f.). Grenzüberschreitende Kooperationen sind daher für viele mittelständische Unternehmen die einzige Möglichkeit, fremde Märkte zu erschließen (vgl. Lubritz, 1998, S. 34 f.), jedoch werden diese noch immer selten von mittelständischen Unternehmen eingegangen (vgl. Blankenburg Holm, Eriksson & Johanson, 1996, S. 1033 ff.; Henke, 2002, S. 7; Zentes & Swoboda, 1999, S. 44 ff.). Für die Nutzung von grenzüberschreitenden Kooperationen ist neben der Kooperationsfähigkeit die Kooperationsbereitschaft von grundlegender Bedeutung (vgl. Buse, 1997. S. 444).
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Mittelständische Unternehmen
- Quantitative Definition
- Qualitative Definition
- Grenzüberschreitende Kooperation
- Begriffsbestimmung
- Kooperationsformen
- Abgrenzung der Koordinationsformen
- Internationalisierung mittelständischer Unternehmen
- Ressourcenorientierte Ansätze
- Der Ressourcenansatz
- Der Ressourcenabhängigkeitsansatz
- Motive und Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen
- Motive grenzüberschreitender Kooperationen
- Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen
- Hypothesenbildung und Untersuchungsmodell
- Stand der Forschung
- Ableitung der Hypothesen und Untersuchungsmodell
- Weitere Untersuchungsaspekte
- Methodologie
- Untersuchungssample und Methoden der Datensammlung
- Fragebogenkonzeption und Operationalisierung der Variablen
- Fragebogenkonzeption
- Operationalisierung der Variablen
- Methoden der Datenaufbereitung und -auswertung
- Stichprobenstruktur
- Zentrale Ergebnisse
- Hypothesenüberprüfung
- Ergebnisinterpretation der Regressionsanalyse
- Ergebnisse der weiteren Untersuchungsaspekte
- Unternehmensgröße
- Internationalisierung
- Motive grenzüberschreitender Kooperationen
- Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen
- Zukünftiges Verhalten
- Zusammenfassung, Schlussfolgerung und Restriktionen
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema grenzüberschreitender Kooperationen im Mittelstand. Ziel ist es, die Motive und Hemmnisse dieser Kooperationen zu untersuchen und deren Einfluss auf die Bereitschaft von Unternehmen, grenzüberschreitende Kooperationen einzugehen, zu analysieren. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die mittels eines Fragebogens durchgeführt wurde.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der grenzüberschreitenden Kooperation
- Analyse der Motive und Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen
- Entwicklung eines empirischen Modells zur Erklärung der Bereitschaft von Unternehmen, grenzüberschreitende Kooperationen einzugehen
- Untersuchung des Einflusses von Unternehmensgröße und Internationalisierungsgrad auf die Bereitschaft für grenzüberschreitende Kooperationen
- Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problemstellung, die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar. Es wird die Relevanz des Themas grenzüberschreitender Kooperationen im Mittelstand erläutert und die Forschungslücke, die die Arbeit schließen soll, aufgezeigt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden die Begriffe des Mittelstands und der grenzüberschreitenden Kooperation definiert und verschiedene Kooperationsformen sowie die Abgrenzung der Koordinationsformen vorgestellt.
Das dritte Kapitel behandelt ressourcenorientierte Ansätze, die zur Erklärung von grenzüberschreitenden Kooperationen herangezogen werden können. Es werden der Ressourcenansatz und der Ressourcenabhängigkeitsansatz vorgestellt und deren Relevanz für die Untersuchung von grenzüberschreitenden Kooperationen im Mittelstand erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert die Motive und Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen. Es werden verschiedene Motive, wie z. B. Marktzugang, Kostensenkung und Know-how-Erwerb, sowie Hemmnisse, wie z. B. kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und mangelndes Vertrauen, vorgestellt und diskutiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Hypothesenbildung und dem Untersuchungsmodell. Es wird der Stand der Forschung zum Thema grenzüberschreitender Kooperationen im Mittelstand zusammengefasst und auf dieser Grundlage ein empirisches Modell entwickelt, das die Bereitschaft von Unternehmen, grenzüberschreitende Kooperationen einzugehen, erklären soll.
Das sechste Kapitel beschreibt die Methodologie der Arbeit. Es werden das Untersuchungssample, die Methoden der Datensammlung, die Fragebogenkonzeption, die Operationalisierung der Variablen sowie die Methoden der Datenaufbereitung und -auswertung vorgestellt.
Das siebte Kapitel präsentiert die zentralen Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Hypothesen überprüft, die Ergebnisse der Regressionsanalyse interpretiert und die Ergebnisse der weiteren Untersuchungsaspekte, wie z. B. Unternehmensgröße, Internationalisierung, Motive und Hemmnisse grenzüberschreitender Kooperationen sowie das zukünftige Verhalten der Unternehmen, dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen grenzüberschreitende Kooperationen, Mittelstand, Internationalisierung, Motive, Hemmnisse, Ressourcenansatz, Ressourcenabhängigkeitsansatz, empirische Analyse, Fragebogen, Regressionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind grenzüberschreitende Kooperationen für den Mittelstand wichtig?
Sie bieten Flexibilitäts- und Größenvorteile und ermöglichen es kleinen Unternehmen, Auslandsmärkte mit geringerem Ressourcenaufwand zu erschließen.
Was behindert mittelständische Unternehmen bei der Internationalisierung?
Häufige Hemmnisse sind geringe Eigenkapitalquoten, fehlendes Management-Know-how sowie kulturelle und sprachliche Barrieren.
Welche theoretischen Ansätze erklären diese Kooperationen?
Die Arbeit nutzt den Ressourcenansatz und den Ressourcenabhängigkeitsansatz, um die Motive für Kooperationen zu begründen.
Welche Motive treiben Unternehmen ins Ausland?
Zentrale Motive sind der Marktzugang, Kostensenkungen und der Erwerb von spezifischem Know-how.
Wie wurde die empirische Analyse durchgeführt?
Die Untersuchung basiert auf einem Fragebogen und einer anschließenden Regressionsanalyse, um die Kooperationsbereitschaft der Unternehmen zu ermitteln.
- Arbeit zitieren
- Sandra Kobs (Autor:in), 2010, Grenzüberschreitende Kooperationen im Mittelstand – Eine empirische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184041