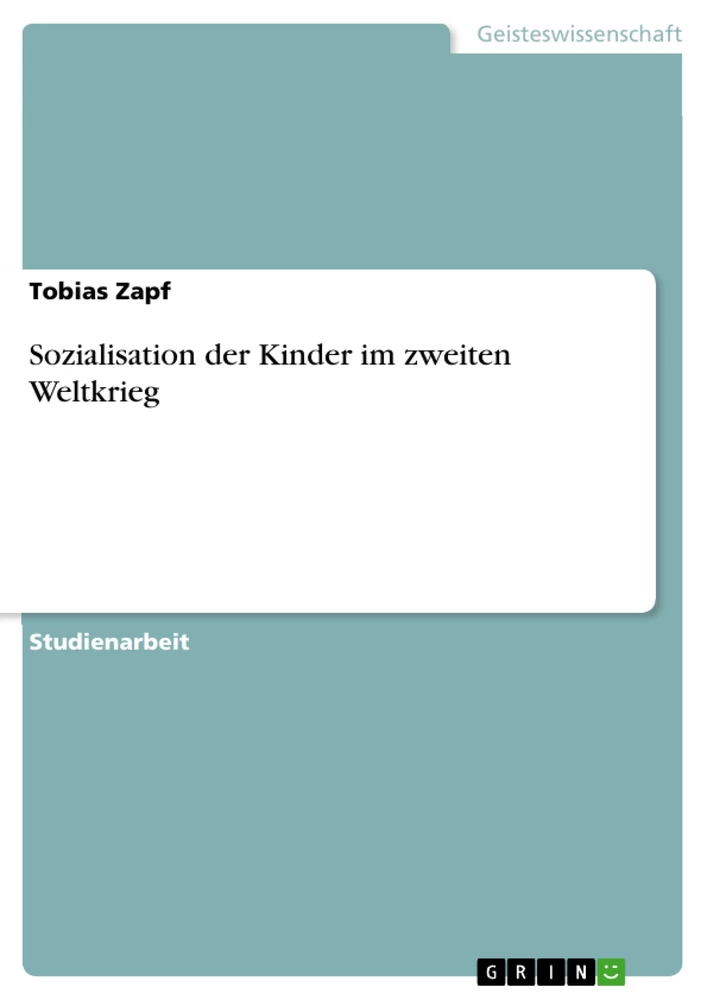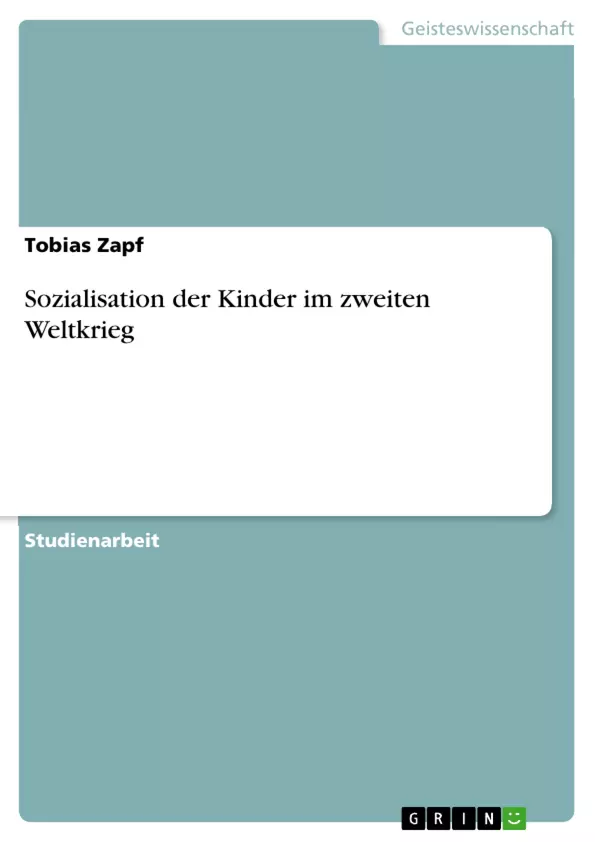Im 20.Jahrhundert fanden fast 200 Kriege nicht nur in bestimmten Regionen oder Kontinenten,
sondern auf der gesamten Welt statt. Angefangen mit dem 1. und 2. Weltkrieg bis hin zu den
zahlreichen, jahrelang und noch heute andauernden Bürgerkriegen in Afrika etc., so dass man den
Krieg als „Alltagsphänomen“ im 20. Jahrhundert bezeichnen kann. Erleben Menschen, egal ob
Groß oder Klein, nicht nur punktuelle, sondern länger andauernde, belastende Situationen in
jeglicher Beziehung, wird das Auswirkungen auf ihren Lebensweg haben.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den betroffenen Personen, die Krieg erfahren haben.
Beispielhaft wird die Entwicklung der Kriegskinder des 2. Weltkrieges durchleuchtet. Dadurch,
dass diese Kinder in einer ganz anderen Umwelt groß wurden und die gesellschaftlichen
Aktivitäten sowie Vorkehrungen zu dieser Zeit dramatisch waren, ist anzunehmen, dass dieses
indirekt oder direkt Einfluss auf die Persönlichkeitsstrukturen der Kinder gehabt hat.1 Folglich
müsste eine vom Krieg geprägte Entwicklung Auswirkungen bis ins hohe Alter haben.
Die Hausarbeit geht der Frage nach, inwieweit der Krieg die Sozialisation und damit die
Entwicklung der Kriegskinder beeinflusst hat. Ausgehend von dem Begriff der Sozialisation werden
die Faktoren, die für die Entwicklung von Kindern wichtig sind, näher erläutert und mit den
Sozialisationszielen in Verbindung gebracht. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, welchen
Belastungen ein Kriegskind im 2. Weltkrieg ausgesetzt war und welchen Folgen das für ihre
Kindheit, ihr Erwachsendasein bis hin zum Alter hatte. Die wichtigsten Ergebnisse werden in einem
Fazit zusammengefasst.
Bewusst werden in der vorliegenden Arbeit nur die Erfahrungen der Jahrgänge ca. 1935- 1947
berücksichtigt, die den Krieg als Kind bzw. als Jugendlicher miterlebt haben, da die Kindheit für
das weitere Leben prägend ist.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Sozialisation
- 1) Faktoren
- 2) Ziele
- III) Beeinflussung der Sozialisation eines Kindes durch den Krieg
- 1) Veränderung der Familienkonstallation mit ihren Folgen
- 2) Existentielle Not (Heimatverlust, Wohnsituation…...)
- 3) Herausbildung von Traumata
- a) Definition
- b) Ursachen
- c) Folgen
- IV) Verarbeitung kriegsbedingter Erlebnisse in ihrer Entwicklung
- 1) als Kind
- 2) als Erwachsener
- 3) im Alter
- V) Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Sozialisation von Kindern im Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es, die Auswirkungen des Krieges auf die Entwicklung von Kriegskindern zu untersuchen und aufzuzeigen, wie diese Erfahrungen ihre Lebensläufe prägten. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die die Sozialisation beeinflussen, und stellt diese den Belastungen gegenüber, denen Kriegskinder im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt waren. Dabei werden die Folgen für die Kindheit, das Erwachsensein und das Alter der Kriegskinder beleuchtet.
- Einfluss des Krieges auf die Sozialisation von Kindern
- Veränderungen der Familienkonstallation und ihre Folgen
- Existentielle Not und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung
- Herausbildung von Traumata und deren Verarbeitung
- Langfristige Folgen des Krieges auf die Lebensläufe von Kriegskindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sozialisation von Kindern im Zweiten Weltkrieg ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie erläutert den Fokus der Arbeit auf die Erfahrungen der Jahrgänge 1935-1947, die den Krieg als Kind oder Jugendlicher miterlebt haben.
Das Kapitel "Sozialisation" definiert den Begriff der Sozialisation und erläutert die Faktoren, die die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Es werden die wichtigsten Sozialisationsinstanzen wie Familie und Bildungseinrichtungen vorgestellt und die Ziele der Sozialisation, wie die Entwicklung von Selbstsicherheit, Gewissen, intellektuellen Fähigkeiten und Empathie, beschrieben.
Das Kapitel "Beeinflussung der Sozialisation eines Kindes durch den Krieg" beleuchtet die Belastungen, denen Kriegskinder im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt waren. Es werden die Veränderungen der Familienkonstallation, die existentielle Not und die Herausbildung von Traumata analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sozialisation von Kindern, den Zweiten Weltkrieg, Kriegskinder, Traumata, Familienkonstallation, existentielle Not, Entwicklung, Lebenslauf, Kindheit, Erwachsensein, Alter.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste der Zweite Weltkrieg die Sozialisation von Kindern?
Der Krieg beeinflusste die Sozialisation massiv durch veränderte Familienkonstellationen, existenzielle Not und den Verlust der Heimat. Diese Faktoren prägten die Persönlichkeitsstrukturen der Kinder nachhaltig.
Welche Geburtsjahrgänge werden als Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs definiert?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Jahrgänge zwischen 1935 und 1947, da diese den Krieg als Kinder oder Jugendliche unmittelbar miterlebt haben.
Welche langfristigen Folgen hat eine Kriegskindheit?
Eine vom Krieg geprägte Entwicklung kann Auswirkungen bis ins hohe Alter haben, insbesondere in Bezug auf die psychische Stabilität und die Verarbeitung von Traumata im Erwachsenenalter.
Was sind die wichtigsten Sozialisationsinstanzen für Kinder?
Zu den zentralen Instanzen gehören die Familie sowie Bildungseinrichtungen, deren Strukturen während der Kriegsjahre oft dramatisch gestört oder verändert wurden.
Welche Rolle spielen Traumata in der Entwicklung von Kriegskindern?
Traumata entstanden durch Erlebnisse wie Flucht, Bombardierungen und soziale Instabilität. Diese prägten die Kindheit und erforderten oft lebenslange Verarbeitungsstrategien.
Was sind die primären Ziele der kindlichen Sozialisation?
Ziele der Sozialisation sind unter anderem die Entwicklung von Selbstsicherheit, Gewissen, intellektuellen Fähigkeiten und Empathie – Ziele, die im Kriegskontext schwerer zu erreichen waren.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts (B.A.) Tobias Zapf (Autor), 2010, Sozialisation der Kinder im zweiten Weltkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184116