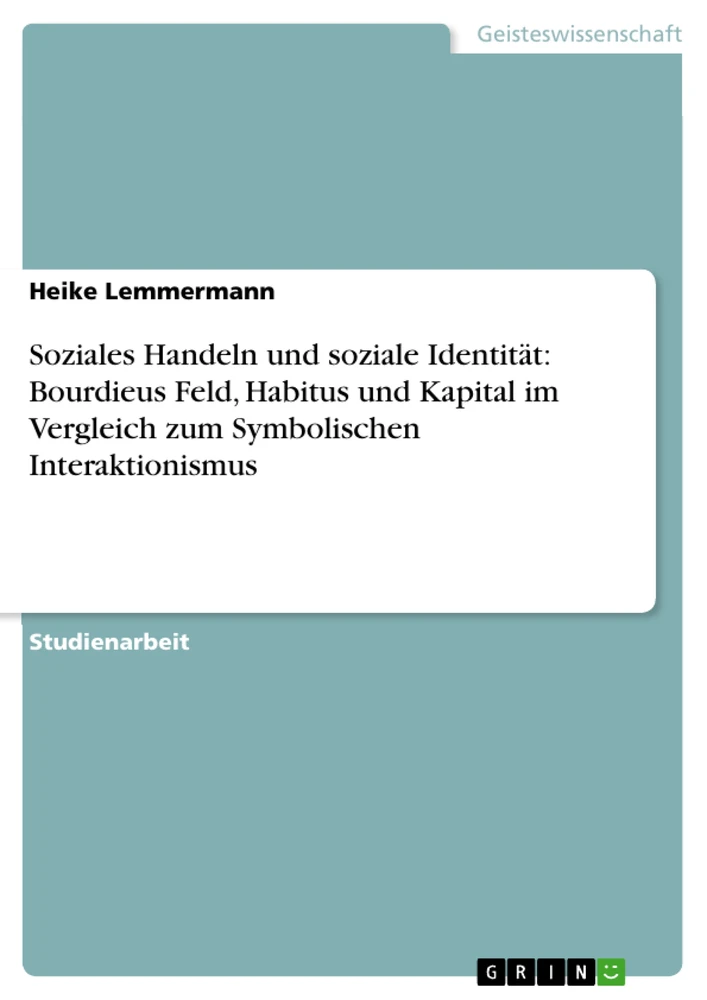In dieser Hausarbeit werden die zentralen Begriffe Pierre Bourdieus (1930-2002) vorgestellt, der in seiner Zeit aufschlussreiche Ansichten bezüglich der Thematik der sozialen Identität in der sozialen Ordnung entwickelt hat.
Bourdieus Begrifflichkeiten und Konzepte wurden zu einem großen Teil durch praktische Erfahrungen, besonders durch seinen Forschungsaufenthalt in Algerien zwischen 1958 und 1961 beeinflusst. (vgl. Schultheis:2000, 166). Durch den Begriff Habitus erläutert Bourdieu seine Sicht der Integration von Akteuren in die soziale Ordnung, eine Art Sozialisationstheorie. Grundannahme ist, dass der Habitus alle Werte, Normen und Einstellungen, also das gesamte Wesen eines Menschen beinhaltet und dass er durch eine Art „Vergesellschaftung von Innen“ in den Menschen integriert wird. Durch dieses Übergehen von gesellschaftlichen und sozialen Handlungs- und Denkmustern bestimmt der Habitus auf der einen Seite die soziale Lage des Akteurs, auf der anderen Seite ist er durch den Habitus auch ein Produkt ebendieser Lage. Weiterhin stattet der Habitus uns mit Ressourcen aus, die in Form verschiedener Kapitale zu unseren sozialen und gesellschaftlichen Chancen gehören. Diese Punkte werden ausführlich im zweiten Kapitel erläutert. Weiterhin wird dargestellt, wie wir den Habitus erwerben und wie der soziale Raum, Bourdieu nennt ihn Feld, aussieht, indem diese Phänomene geschehen. Prägnant bei der Theorie Bourdieus ist die Abkehr von traditionellen soziologischen Denkmustern wie z.B. Rational Choice wonach soziales Handeln durch institutionalisierte Normbefolgung oder Furcht vor Sanktionen stattfindet. Um diesen Unterschied aufzuzeigen, wird im dritten Kapitel der Arbeit eine der klassischen Sozialisationstheorien von George Herbert Mead vorgestellt, der sich dem Thema aus sozialpsychologischer Sicht nähert und die Ansicht vertritt, die Integration eines Kindes in die Gesellschaft erfolgt durch symbolisch vermittelte Interaktion von Menschen in ihrem nahen Umfeld und später durch den Rest der Gesellschaft.
Ein Vergleich der Theorien Meads und Bourdieus erfolgt im vierten Kapitel. Abschließend soll im letzten Kapitel die Verwendung von Bourdieus Ansichten in der aktuellen Forschungswelt der Geisteswissenschaften in Form eines kurzen Ausblicks dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bourdieus Theoriekonzept
- Habitus
- Einverleibung
- Feld
- Kapital
- Habitus
- George Herbert Meads Symbolischer Interaktionismus
- Soziale Praxis nach Bourdieu und Mead im Vergleich
- Einordnung Bourdieus in die aktuelle Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Pierre Bourdieus und deren Bedeutung für die soziale Identität in der sozialen Ordnung. Der Fokus liegt auf Bourdieus Konzepten von Habitus, Feld und Kapital, die durch seine Forschungen in Algerien geprägt wurden. Die Arbeit untersucht, wie diese Konzepte die Integration von Akteuren in die soziale Ordnung erklären und welche Rolle sie im Hinblick auf soziale Chancen und Lebensbedingungen spielen. Zusätzlich wird ein Vergleich mit George Herbert Meads Symbolischem Interaktionismus gezogen, um die spezifischen Ansätze beider Theorien im Bereich der Sozialisation aufzuzeigen.
- Habitus als soziales Prägungsmuster
- Feld als sozialer Raum und seine Auswirkungen
- Kapitalformen und ihre Rolle für soziale Chancen
- Vergleich des Habitus mit Meads Symbolischem Interaktionismus
- Einordnung von Bourdieus Theorie in aktuelle Forschungsdiskussionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der Hausarbeit und stellt den Fokus auf Bourdieus Theorie und deren Relevanz für die soziale Identität dar. Das zweite Kapitel erläutert ausführlich Bourdieus Theoriekonzept. Es werden die zentralen Begriffe Habitus, Feld und Kapital definiert und ihre Bedeutung für die soziale Praxis erörtert. Das Kapitel 2.1.1 beschäftigt sich mit der Frage, wie der Habitus durch den Prozess der Einverleibung erworben wird. Im dritten Kapitel wird Meads Symbolischer Interaktionismus als klassisches Gegenmodell zu Bourdieus Theorie vorgestellt. Das vierte Kapitel bietet einen vergleichenden Überblick über die Theorien von Mead und Bourdieu im Hinblick auf die soziale Praxis. Das fünfte Kapitel beleuchtet kurz die Relevanz von Bourdieus Ansätzen für die aktuelle Forschung. Das letzte Kapitel bietet ein Fazit der gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind Bourdieus Theoriekonzept, Habitus, Feld, Kapital, soziales Handeln, soziale Identität, Symbolischer Interaktionismus, Sozialisation, Klassenstruktur, soziale Chancen, praktische Sinn, Einverleibung. Diese Begriffe werden in der Arbeit umfassend analysiert und diskutiert, um ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen sozialer Ordnung, individueller Handlungsfähigkeit und sozialer Praxis zu erlangen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Pierre Bourdieu unter dem "Habitus"?
Der Habitus umfasst alle verinnerlichten Werte, Normen und Einstellungen eines Menschen, die durch seine soziale Lage geprägt wurden und sein Handeln unbewusst steuern.
Was bedeutet "Feld" in Bourdieus Theorie?
Ein Feld ist ein sozialer Raum (z.B. Politik, Kunst, Wirtschaft), in dem Akteure um Macht und Ressourcen kämpfen und der eigenen Regeln unterliegt.
Welche verschiedenen Kapitalformen unterscheidet Bourdieu?
Er unterscheidet primär ökonomisches Kapital (Geld), kulturelles Kapital (Bildung) und soziales Kapital (Beziehungen/Netzwerke).
Wie unterscheidet sich Bourdieus Ansatz von Meads Symbolischem Interaktionismus?
Während Mead die Identitätsbildung durch bewusste Interaktion betont, fokussiert Bourdieu stärker auf die unbewusste Prägung durch die soziale Klassenstruktur (Einverleibung).
Was ist mit "Einverleibung" gemeint?
Es beschreibt den Prozess, bei dem gesellschaftliche Strukturen in körperliche Dispositionen und Denkweisen übergehen, sodass der Mensch zum Produkt seiner sozialen Lage wird.
- Arbeit zitieren
- Heike Lemmermann (Autor:in), 2010, Soziales Handeln und soziale Identität: Bourdieus Feld, Habitus und Kapital im Vergleich zum Symbolischen Interaktionismus , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184133