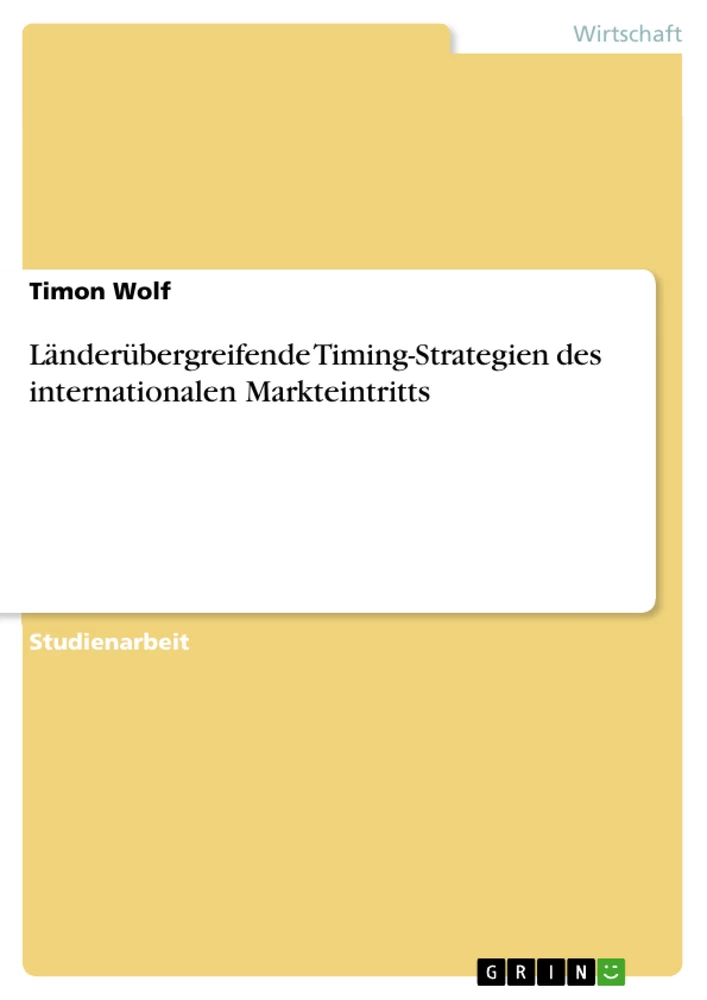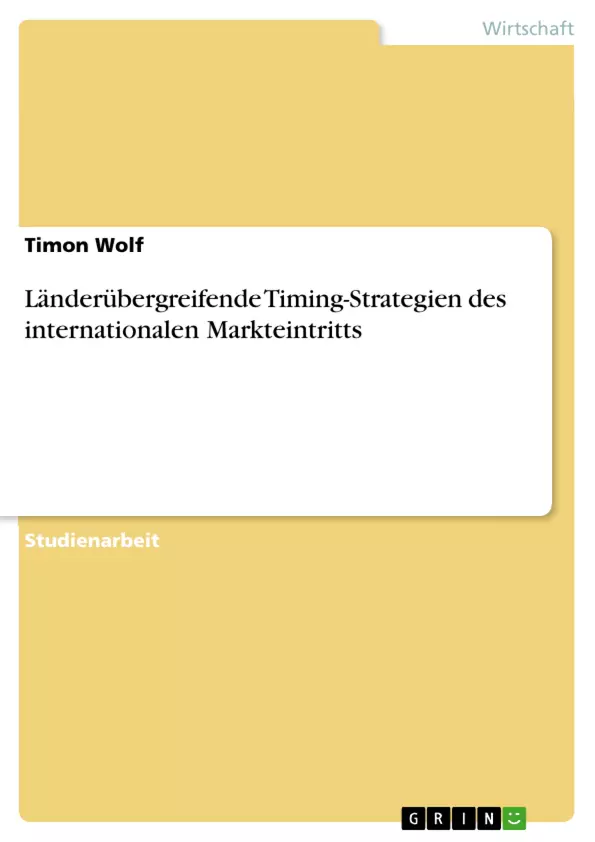Inhaltsverzeichnis I
Abkürzungsverzeichnis II
Abbildungsverzeichnis III
1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung 1
1.3 Gang der Untersuchung 2
2 Länderübergreifende Timing-Strategien 2
2.1 Begriffsbestimmung 2
2.2 Wasserfall-Strategie 2
2.3 Sprinkler-Strategie 3
2.4 Kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie 4
3 Kritische Betrachtung der länderübergreifenden Timing-Strategie 5
3.1 Kritische Betrachtung der Wasserfall-Strategie 5
3.2 Kritische Betrachtung der Sprinkler-Strategie
4 Fazit 8
4.1 Zielerreichung 8
4.2 Perspektiven 8
Literaturverzeichnis 9
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2 Länderübergreifende Timing-Strategien
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Wasserfall-Strategie
- 2.3 Sprinkler-Strategie
- 2.4 Kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie
- 3 Kritische Betrachtung der länderübergreifenden Timing-Strategien
- 3.1 Kritische Betrachtung der Wasserfall-Strategie
- 3.2 Kritische Betrachtung der Sprinkler-Strategie
- 4 Fazit
- 4.1 Zielerreichung
- 4.2 Perspektiven
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit länderübergreifenden Timing-Strategien im internationalen Markteintritt. Ziel ist es, die verschiedenen Strategien wie die Wasserfall- und Sprinkler-Strategie sowie deren Kombination vorzustellen und kritisch zu betrachten. Die Arbeit analysiert die Einflussfaktoren, die bei der Wahl der jeweiligen Strategie eine Rolle spielen.
- Länderübergreifende Timing-Strategien
- Wasserfall-Strategie
- Sprinkler-Strategie
- Kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie
- Einflussfaktoren für die Wahl der Timing-Strategie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Internationalisierung von Unternehmen und die Bedeutung von Timing-Strategien dar. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Gang der Untersuchung.
Das zweite Kapitel erläutert die verschiedenen länderübergreifenden Timing-Strategien, darunter die Wasserfall-Strategie, die Sprinkler-Strategie und die kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der Strategien sowie die relevanten Einflussfaktoren für die Wahl der Strategie beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der kritischen Betrachtung der länderübergreifenden Timing-Strategien. Es werden die Stärken und Schwächen der Wasserfall- und Sprinkler-Strategie im Detail analysiert und die jeweiligen Risiken und Chancen der Strategien aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen länderübergreifende Timing-Strategien, internationaler Markteintritt, Wasserfall-Strategie, Sprinkler-Strategie, kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie, Einflussfaktoren, Internationalisierung, Unternehmen, Märkte, Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Wasserfall-Strategie beim Markteintritt?
Bei der Wasserfall-Strategie erfolgt der Markteintritt nacheinander in verschiedene Länder, um Erfahrungen zu sammeln und Risiken zu minimieren.
Was kennzeichnet die Sprinkler-Strategie?
Die Sprinkler-Strategie sieht einen nahezu gleichzeitigen Markteintritt in viele verschiedene Ländermärkte vor, um schnell Marktanteile zu sichern.
Wann ist eine kombinierte Wasserfall-Sprinkler-Strategie sinnvoll?
Sie wird genutzt, um die Vorteile beider Ansätze zu vereinen, indem man z.B. regional konzentriert (Sprinkler) und dann schrittweise global expandiert (Wasserfall).
Welche Risiken hat die Sprinkler-Strategie?
Hoher Ressourcenbedarf, hohe finanzielle Belastung und das Risiko des Scheiterns auf vielen Märkten gleichzeitig.
Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Timing-Strategie?
Wichtige Faktoren sind die Wettbewerbsintensität, die Homogenität der Märkte, verfügbare Ressourcen und die Lebenszyklen der Produkte.
- Quote paper
- B.A. Timon Wolf (Author), 2011, Länderübergreifende Timing-Strategien des internationalen Markteintritts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184150