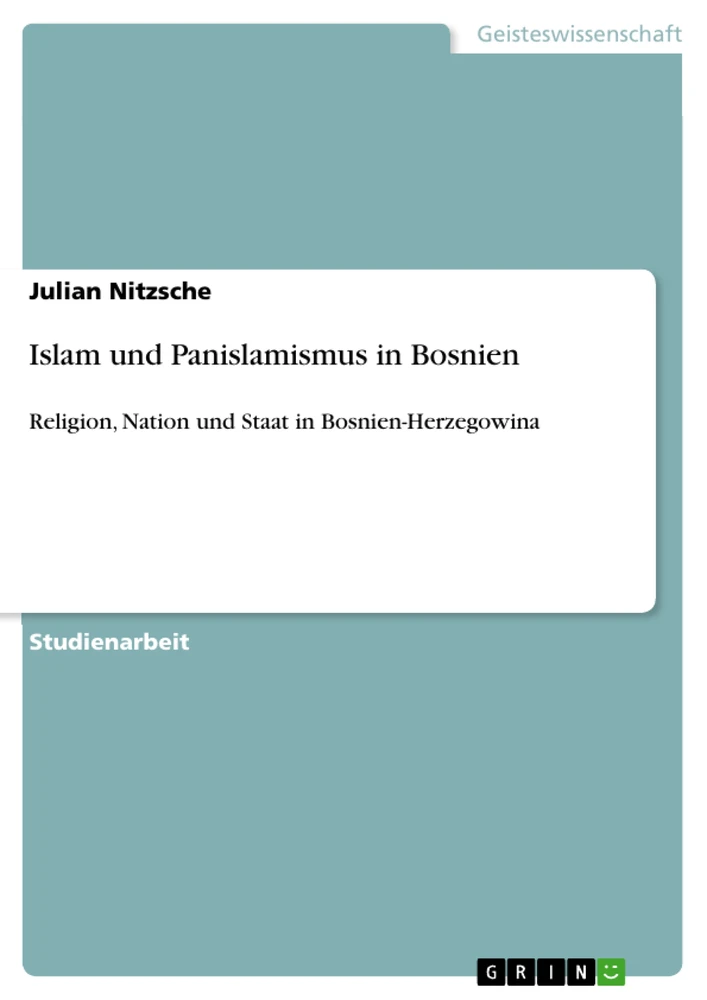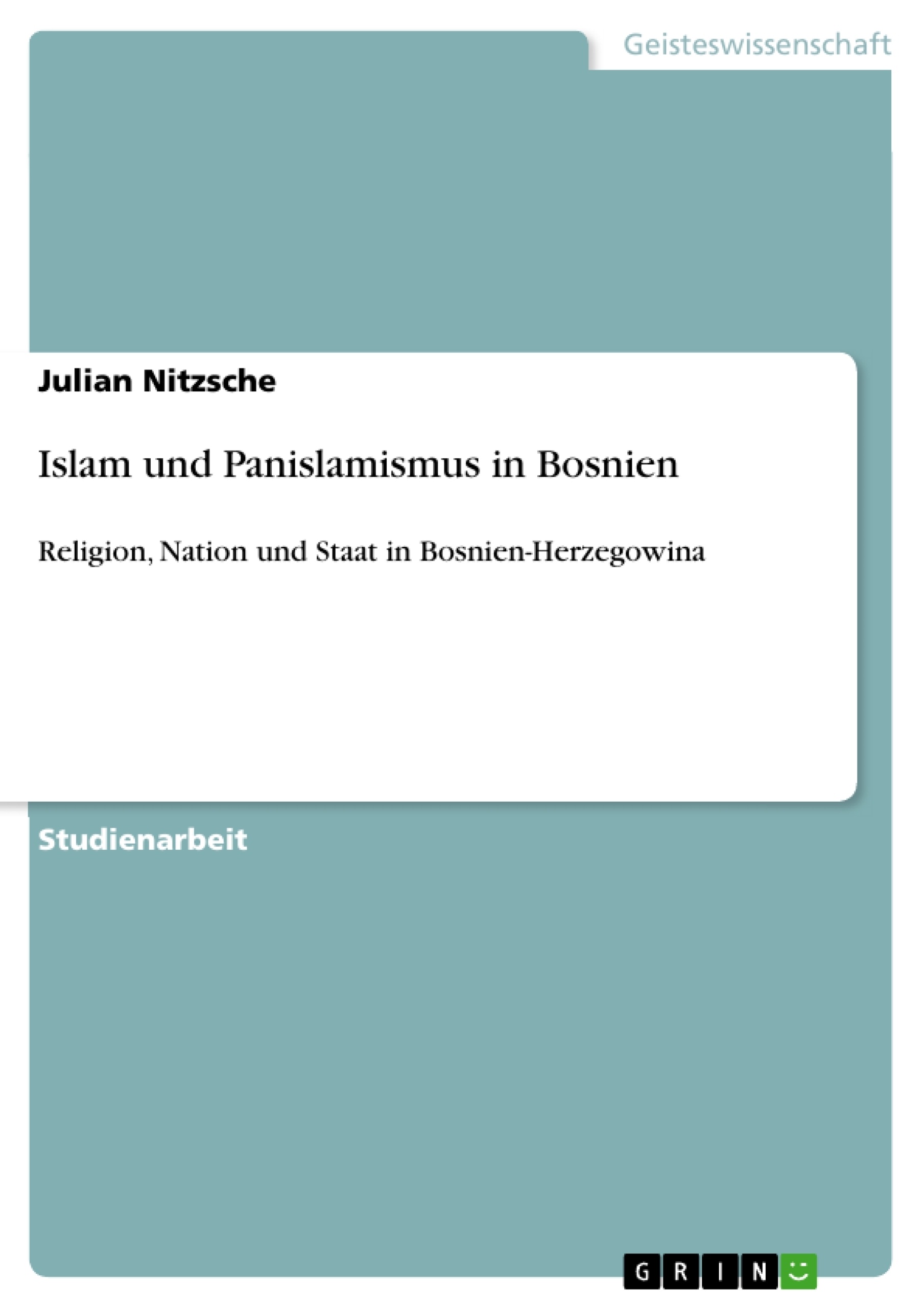Bosnien und Herzegowina ist eines jener Länder, die uns vor allem durch ihre kriegerische Vergangenheit in Erinnerung sind. Gerade einmal 15 Jahre ist es her, dass der Bosnienkrieg, ein Kampf zwischen Ethnien und/oder Glaubensgemeinschaften, wie gerne kolportiert wird, beendet wurde. Noch immer hat das Land unter den Folgen des Krieges zu leiden, der weit über 100.000 Menschen das Leben kostete.
Was vor diesem Hintergrund gerne in Vergessenheit gerät, ist die Tatsache, dass Bosnien und Herzegowina zudem eines der wenigen europäischen Länder mit einer seit Jahrhunderten ansässigen muslimischen Bevölkerung ist; dass das vormals unabhängige Königreich mehr als 400 Jahre lang unter osmanischer Herrschaft stand, und dass seine ethnische und konfessionell gemischte Bevölkerung über lange Zeiträume hinweg friedlich zusammengelebt hat.
Ich möchte in dieser Arbeit einen Überblick über Bosnien und seine Muslime geben, und dabei besonders auf Ereignisse im 20. Jahrhundert eingehen. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Vernetzung der bosnischen Muslime mit dem Rest der islamischen Welt, also auf dem panislamischen Aspekt. Dabei wird sich die Arbeit u.a. mit der muslimischen SS-Division im Zweiten Weltkrieg, der “Islamischen Deklaration” des späteren bosnischen Präsidenten Alija Izetbegović sowie den ausländischen Mudschaheddin im Bosnienkrieg beschäftigen.
Neben der angegebenen Literatur konnte ich auf eigene Erfahrungen von mehreren längeren Reisen durch Bosnien und Herzegowina zurückgreifen. Es ist gerade jene Mischung aus muslimischen, katholischen, orthodoxen, jüdischen und vielen weiteren Einflüssen, die dieses Land auszeichnet und seine Schönheit ausmacht. Andererseits wurde eben jene Vielfalt ihm mehrmals in seiner Geschichte, besonders aber im vergangenen Jahrhundert, zum Verhängnis.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Bosnien und sein Islam
- Vorislamische Geschichte
- Osmanische Eroberung
- Bosnien im Osmanischen Reich
- Der Beginn der Nationalisierung
- Die bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg
- Islam und Panislamismus im sozialistischen Jugoslawien
- Die Anerkennung der "muslimischen Nation"
- Alija Izetbegović und die "Islamische Deklaration"
- Rückständigkeit und Abhängigkeit
- Die Islamische Ordnung
- Krieg und Dschihad in Bosnien
- Bosnien heute: Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Geschichte Bosniens und seiner muslimischen Bevölkerung, mit besonderem Fokus auf das 20. Jahrhundert. Sie untersucht die Vernetzung der bosnischen Muslime mit der weiteren islamischen Welt, den panislamischen Aspekt. Ein Ziel ist es, die komplexe Geschichte Bosniens vor dem Hintergrund seiner ethnischen und religiösen Vielfalt zu beleuchten.
- Die vorislamische Geschichte Bosniens und die Entwicklung der bosnischen Kirche.
- Die osmanische Eroberung Bosniens und die Integration Bosniens in das Osmanische Reich.
- Die Rolle der bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg und während des sozialistischen Jugoslawiens.
- Der Einfluss des Panislamismus auf die bosnischen Muslime.
- Der Bosnienkrieg und seine Folgen.
Zusammenfassung der Kapitel
Bosnien und sein Islam: Dieses Kapitel untersucht die Geschichte Bosniens vor der osmanischen Eroberung, beleuchtet die Entwicklung der bosnischen Kirche und den Einfluss des byzantinischen Reiches. Es beschreibt die osmanische Eroberung und die anschließende Integration Bosniens in das Osmanische Reich, unterstreicht die Rolle der bosnischen Kirche im Verhältnis zu den Osmanen und analysiert die Gründe für den raschen Fall Bosniens unter osmanische Herrschaft. Das Kapitel hebt die wirtschaftliche Entwicklung Bosniens unter osmanischer Herrschaft hervor und beleuchtet die Konversion zahlreicher Bosnier zum Islam sowie deren Integration in das Osmanische Reich. Die Rolle bosnischer Persönlichkeiten am Hof in Istanbul wird ebenfalls thematisiert, zusammen mit der ethnischen und religiösen Vielfalt im Osmanischen Reich.
Die bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg: [Hier fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels im Originaltext.]
Islam und Panislamismus im sozialistischen Jugoslawien: Dieses Kapitel behandelt die Anerkennung der "muslimischen Nation" im sozialistischen Jugoslawien und die Rolle von Alija Izetbegović und seiner "Islamischen Deklaration". Es analysiert die darin enthaltenen Konzepte von Rückständigkeit und Abhängigkeit sowie die Vision einer islamischen Ordnung. Die Zusammenfassung soll die komplexen Beziehungen zwischen dem panislamischen Gedankengut und der politischen Realität im sozialistischen Jugoslawien darlegen und die Bedeutung von Izetbegovićs Ideen im Kontext der Zeit beleuchten.
Krieg und Dschihad in Bosnien: [Hier fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels im Originaltext.]
Schlüsselwörter
Bosnien, Herzegowina, Islam, Osmanisches Reich, Panislamismus, Alija Izetbegović, Bosnische Kirche, Zweiter Weltkrieg, Jugoslawien, Nationalismus, Ethnizität, Religion, Krieg, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bosnien und sein Islam
Was ist der Inhalt des Buches "Bosnien und sein Islam"?
Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte Bosniens und seiner muslimischen Bevölkerung, insbesondere im 20. Jahrhundert. Es untersucht die Vernetzung bosnischer Muslime mit der weiteren islamischen Welt und den panislamischen Aspekt. Die Geschichte Bosniens wird vor dem Hintergrund seiner ethnischen und religiösen Vielfalt beleuchtet. Der Inhalt umfasst die vorislamische Geschichte, die osmanische Eroberung und die Zeit im Osmanischen Reich, die Rolle der bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg und im sozialistischen Jugoslawien, den Einfluss des Panislamismus, den Bosnienkrieg und ein Fazit zur heutigen Situation Bosniens.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Wichtige Themen sind die vorislamische Geschichte Bosniens und die Entwicklung der bosnischen Kirche; die osmanische Eroberung und Integration Bosniens; die Rolle der bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg und im sozialistischen Jugoslawien; der Einfluss des Panislamismus; der Bosnienkrieg und seine Folgen; sowie die Anerkennung der "muslimischen Nation" und die Rolle Alija Izetbegovićs und seiner "Islamischen Deklaration".
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch gliedert sich in die Kapitel: Vorwort, Bosnien und sein Islam (inkl. vorislamische Geschichte, osmanische Eroberung, Bosnien im Osmanischen Reich, Beginn der Nationalisierung), Die bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg, Islam und Panislamismus im sozialistischen Jugoslawien (inkl. Anerkennung der "muslimischen Nation" und Alija Izetbegovićs "Islamische Deklaration"), Krieg und Dschihad in Bosnien und Bosnien heute: Ein Fazit.
Was ist die Zielsetzung des Buches?
Das Buch zielt darauf ab, einen Überblick über die komplexe Geschichte Bosniens und seiner muslimischen Bevölkerung zu geben, mit besonderem Fokus auf das 20. Jahrhundert und die Vernetzung mit der weiteren islamischen Welt. Es beleuchtet die Geschichte vor dem Hintergrund der ethnischen und religiösen Vielfalt Bosniens.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis angeboten?
Das Inhaltsverzeichnis bietet Zusammenfassungen für die Kapitel "Bosnien und sein Islam" und "Islam und Panislamismus im sozialistischen Jugoslawien". Für die Kapitel "Die bosnischen Muslime im Zweiten Weltkrieg" und "Krieg und Dschihad in Bosnien" fehlen im bereitgestellten Text die Zusammenfassungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Bosnien, Herzegowina, Islam, Osmanisches Reich, Panislamismus, Alija Izetbegović, Bosnische Kirche, Zweiter Weltkrieg, Jugoslawien, Nationalismus, Ethnizität, Religion, Krieg, Geschichte.
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Dieses Buch ist für Leser geeignet, die sich akademisch mit der Geschichte Bosniens und des Islam in Bosnien auseinandersetzen möchten. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der behandelten Themen.
- Quote paper
- Julian Nitzsche (Author), 2011, Islam und Panislamismus in Bosnien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184183