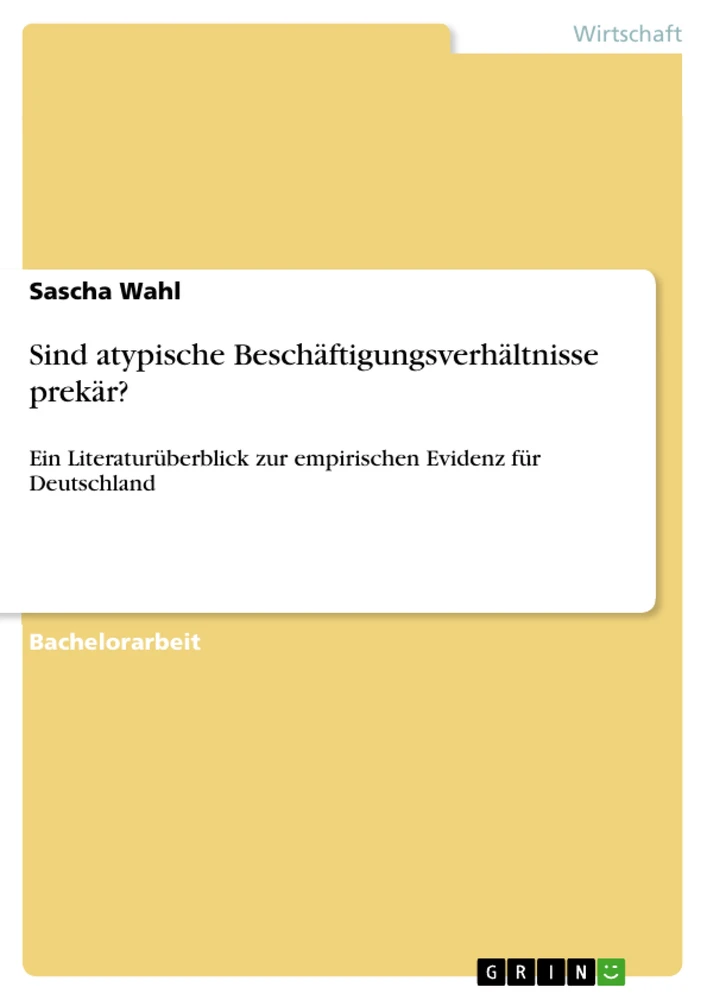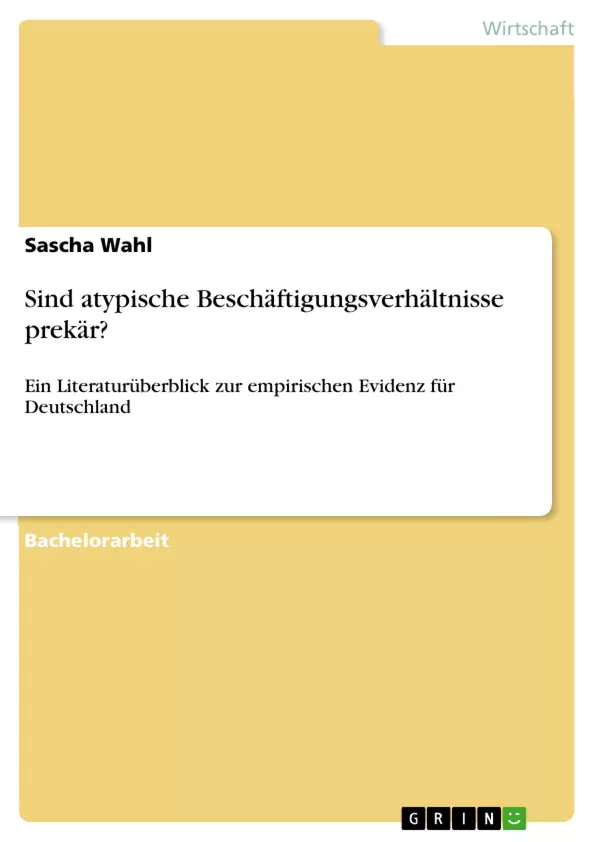1 Einleitung
Atypische Beschäftigungsverhältnisse gewinnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt an Bedeutung.
Im Gegensatz zum typischen unbefristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnis kennzeichnen
sich diese Erwerbsformen im Kern durch eine erhöhte Flexibilität des Arbeitsverhältnisses
aus. Auf der Arbeitgeberseite bieten diese Beschäftigungsformen vielerlei Möglichkeiten.
Einerseits können so beispielsweise die Arbeitskosten, wie die Lohnzusatzkosten, durch die
Einstellung von geringfügig Beschäftigten gesenkt werden.1 Andererseits bietet z.B. die zeitliche
Befristung eines Arbeitsverhältnisses die Möglichkeit, die Produktion in konjunkturellen
Boomphasen kurzfristig zu erhöhen, ohne den Arbeitnehmer nach dieser Phase weiter zu
beschäftigen. Auf der Arbeitnehmerseite bietet diese erhöhte Flexibilität eine bessere Anpassung
an das private und soziale Umfeld. Allerdings können atypische Beschäftigungsverhältnisse
für die Arbeitnehmer auch Risiken beinhalten, wie eine schlechtere Einkommenslage
oder ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko.
Der wissenschaftliche Diskurs über atypische Beschäftigungsformen fußt dabei auf diesen
möglichen Risiken. Im Zentrum der Diskussion steht dabei die Frage, inwiefern atypische
Beschäftigungsverhältnisse als prekär anzusehen sind.
In der folgenden Darstellung soll diese Frage anhand eines Überblicks an empirischen Studien
zur Überprüfung des Prekaritätsrisikos von atypischen Erwerbsformen erläutert und geklärt
werden. Dabei wird unter Gliederungspunkt 2.1 auf die Formen und das Ausmaß atypischer
Beschäftigungsverhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt eingegangen. Unter Gliederungspunkt
2.2 wird der Prekaritätsbegriff vorgestellt. Die empirischen Analysen zur Beziehung
zwischen Prekarität und atypischer Beschäftigung werden unter Gliederungspunkt 3
betrachtet. Ein Vergleich der Studien und deren Ergebnisse erfolgt unter Gliederungspunkt 4.
Das Fazit unter Gliederungspunkt 5 rundet die Darstellung ab.
2 Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und der Prekaritätsbegriff
In der Literatur bildet die negative Abgrenzung vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis
üblicherweise die definitorische Basis atypischer Beschäftigungsverhältnisse.2 Demzufolge
kennzeichnen sich atypische Beschäftigungsverhältnisse dadurch aus, dass sie von einem
oder mehreren zentralen Merkmal(en) des Normalarbeitsverhältnisses abweichen.3
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und der Prekaritätsbegriff
- 2.1 Formen und Ausmaß atypischer Beschäftigungsverhältnisse
- 2.2 Der Prekaritätsbegriff und seine Bedeutung für die Arbeitswelt
- 3 Empirische Analysen
- 3.1 Stand der Forschung und Kategorisierung der ausgewählten Studien
- 3.2 Studie 1: Empirische Analyse der Prekaritätsrisiken von Zeitarbeitskräften
- 3.2.1 Datengrundlage und statistische Verfahren
- 3.2.2 Empirische Ergebnisse
- 3.3 Studie 2: Empirische Analyse über die Prekaritätsrisiken der Kernformen atypischer Beschäftigung
- 3.3.1 Datengrundlage und statistische Verfahren
- 3.3.2 Empirische Ergebnisse
- 3.4 Studie 3: Empirische Analyse über die sozioökonomischen Risiken von befristeter Beschäftigung, Zeitarbeit und Teilzeitarbeit
- 3.4.1 Datengrundlage und statistische Verfahren
- 3.4.2 Empirische Ergebnisse
- 3.5 Studie 4: Empirische Analyse zur Entlohnung befristeter Beschäftigungsverhältnisse
- 3.5.1 Datengrundlage und statistische Verfahren
- 3.5.2 Empirische Ergebnisse
- 4 Kritischer Vergleich der ausgewählten Studien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Frage, inwieweit atypische Beschäftigungsverhältnisse als prekär einzustufen sind. Die Arbeit fokussiert auf die empirische Evidenz in Deutschland und gibt einen Überblick über relevante Forschungsarbeiten. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zusammenzufassen und die Ergebnisse verschiedener Studien kritisch zu vergleichen.
- Formen und Ausmaß atypischer Beschäftigung in Deutschland
- Definition und Bedeutung des Prekaritätsbegriffs im Arbeitskontext
- Empirische Befunde zu den Prekaritätsrisiken atypischer Beschäftigung
- Vergleichende Analyse verschiedener Studienmethoden und -ergebnisse
- Kritische Bewertung des Forschungsstandes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der atypischen Beschäftigung und ihrer potenziellen Prekarität ein. Es skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Arbeitsmarktes hervorgehoben und die Struktur der Arbeit erläutert.
2 Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und der Prekaritätsbegriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Normalarbeitsverhältnisses und stellt verschiedene Formen atypischer Beschäftigung wie Zeitarbeit, Befristung und Teilzeitarbeit vor. Es analysiert das Ausmaß atypischer Beschäftigung in Deutschland und beleuchtet verschiedene Definitionen und Dimensionen des Begriffs „Prekarität“, um den theoretischen Rahmen für die anschließende empirische Analyse zu legen. Es wird die Bedeutung des Prekaritätsbegriffs für die Arbeitswelt diskutiert.
3 Empirische Analysen: In diesem zentralen Kapitel werden vier empirische Studien zu den Prekaritätsrisiken atypischer Beschäftigung vorgestellt und detailliert analysiert. Jede Studie wird hinsichtlich ihrer Methodik, Datenbasis und Ergebnisse einzeln betrachtet. Es wird dabei auf die verwendeten statistischen Verfahren eingegangen und die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfrage interpretiert. Die Studien untersuchen verschiedene Aspekte der Prekarität, wie z.B. Einkommensstabilität, Beschäftigungssicherheit und sozioökonomische Risiken.
4 Kritischer Vergleich der ausgewählten Studien: Dieses Kapitel vergleicht die in Kapitel 3 vorgestellten Studien kritisch miteinander. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Methodiken, Ergebnissen und Schlussfolgerungen herausgearbeitet und mögliche Erklärungen für divergierende Befunde diskutiert. Der Fokus liegt auf der Stärken und Schwächen der jeweiligen Studienansätze und deren Implikationen für die Gesamtinterpretation.
Schlüsselwörter
Atypische Beschäftigung, Prekarität, Zeitarbeit, Befristung, Teilzeitarbeit, Empirische Analyse, Deutschland, Arbeitsmarkt, Sozioökonomische Risiken, Einkommensstabilität, Beschäftigungssicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Atypische Beschäftigung und Prekarität in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen atypischen Beschäftigungsverhältnissen und Prekarität in Deutschland. Sie analysiert empirische Studien, um den aktuellen Forschungsstand zusammenzufassen und die Ergebnisse kritisch zu vergleichen.
Welche Arten atypischer Beschäftigung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Formen atypischer Beschäftigung, darunter Zeitarbeit, befristete Beschäftigung und Teilzeitarbeit.
Wie wird der Begriff „Prekarität“ definiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen und Dimensionen des Begriffs „Prekarität“ im Arbeitskontext und diskutiert dessen Bedeutung für die Arbeitswelt. Die Analyse konzentriert sich auf Aspekte wie Einkommensstabilität und Beschäftigungssicherheit.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und einer kritischen Analyse von vier empirischen Studien zum Thema Prekaritätsrisiken atypischer Beschäftigung in Deutschland. Die Analyse umfasst die Methodik, die Datengrundlage und die Ergebnisse der jeweiligen Studien.
Welche Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vier empirische Studien, die sich mit den Prekaritätsrisiken von Zeitarbeit, befristeter Beschäftigung und Teilzeitarbeit befassen. Die Studien untersuchen verschiedene Aspekte der Prekarität, wie z.B. Einkommensstabilität, Beschäftigungssicherheit und sozioökonomische Risiken. Jede Studie wird hinsichtlich ihrer Methodik, Datenbasis und Ergebnisse einzeln betrachtet.
Wie werden die Studien verglichen?
Die Arbeit vergleicht die vier Studien kritisch miteinander, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Methodik, Ergebnissen und Schlussfolgerungen aufzuzeigen. Mögliche Erklärungen für divergierende Befunde werden diskutiert, und die Stärken und Schwächen der jeweiligen Studienansätze werden bewertet.
Welche zentralen Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit fasst den aktuellen Forschungsstand zur Prekarität atypischer Beschäftigung in Deutschland zusammen und liefert einen kritischen Vergleich verschiedener Studien. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der sozioökonomischen Risiken atypischer Beschäftigungsverhältnisse bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Atypische Beschäftigung, Prekarität, Zeitarbeit, Befristung, Teilzeitarbeit, Empirische Analyse, Deutschland, Arbeitsmarkt, Sozioökonomische Risiken, Einkommensstabilität, Beschäftigungssicherheit.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und der Prekaritätsbegriff, Empirische Analysen und ein kritischer Vergleich der ausgewählten Studien.
Wo finde ich den detaillierten Inhaltsverzeichnis?
Der detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und listet alle Unterkapitel auf.
- Quote paper
- Sascha Wahl (Author), 2011, Sind atypische Beschäftigungsverhältnisse prekär? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184215