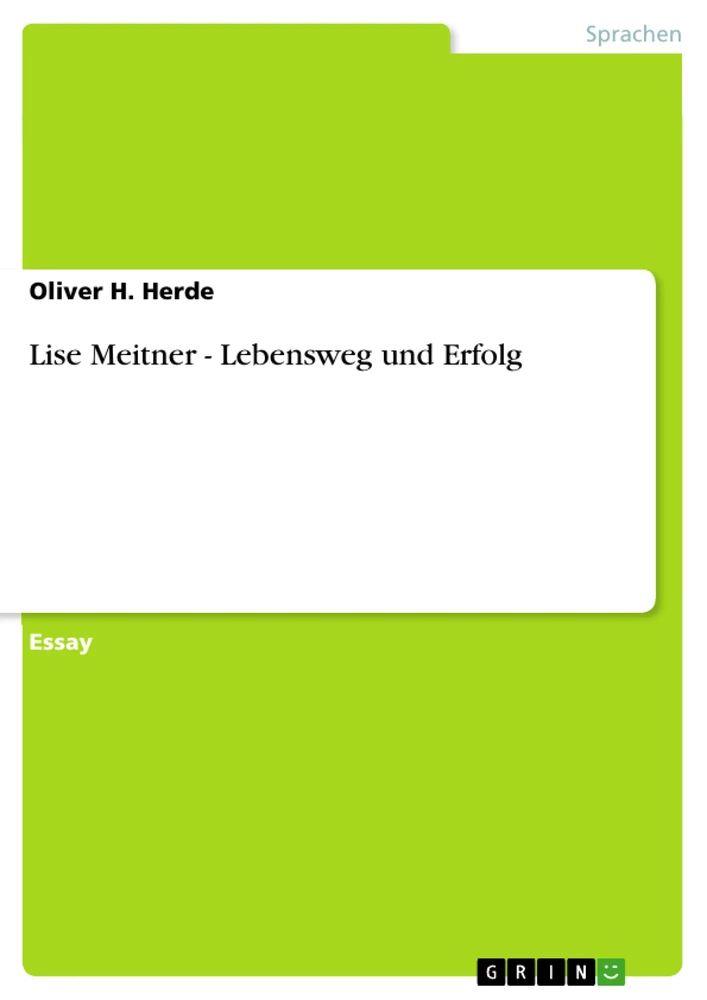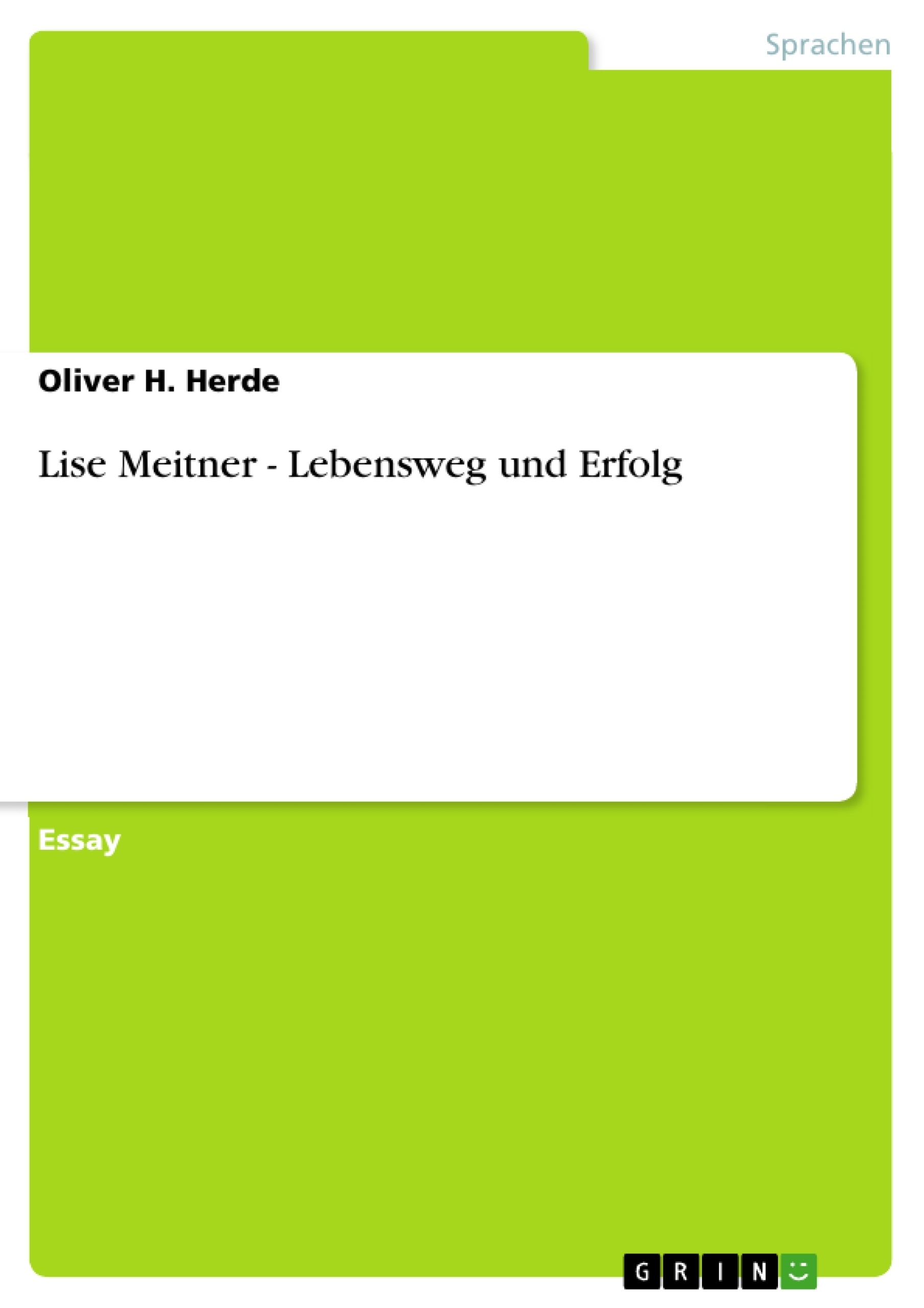Der Lebensweg und die wissenschaftliche Karriere der Lise Meitner unter besonderer Betrachtung persönlicher Eigeninitiativen und sozialer Bindungen.
Inhaltsverzeichnis
- Herkunft, Kindheit und Jugend.
- Ausbildungszeit..
- Berlin..
- Im Ersten Weltkrieg.
- Weimarer Zeiten
- Schleichender Niedergang
- Verlängertes Exil..
- Fazit.....
- Quellensammlungen und Literatur..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Lise Meitner: Lebensweg und Erfolg" von Oliver H. Herde zeichnet einen umfassenden Lebensweg der berühmten Physikerin Lise Meitner nach. Es beleuchtet ihre wissenschaftlichen Leistungen, ihre Herausforderungen als Frau in der Wissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts sowie ihre Rolle im Kontext von politischen Umbrüchen.
- Lise Meitners akademische Laufbahn und die Rolle des Geschlechts in der Wissenschaft
- Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Otto Hahn und ihre Entdeckungen im Bereich der Radioaktivität
- Der Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen auf Meitners Leben und ihre wissenschaftliche Arbeit
- Lise Meitners Flucht vor den Nazis und ihr Exil in Schweden
- Die Bedeutung von Meitners wissenschaftlichem Erbe und ihr Einfluss auf die moderne Physik
Zusammenfassung der Kapitel
Herkunft, Kindheit und Jugend
Dieses Kapitel beschreibt die frühen Jahre von Lise Meitner in Wien, ihre Kindheit in einem liberalen und intellektuellen Elternhaus und ihre Leidenschaft für Naturwissenschaften und Mathematik. Trotz der gesellschaftlichen Einschränkungen für Frauen in der damaligen Zeit ermutigten ihre Eltern Lise Meitner, ihre Neigungen zu verfolgen.
Ausbildungszeit
Das Kapitel beleuchtet Meitners Weg zur Matura und ihr Studium der Mathematik, Physik und Philosophie an der Universität Wien. Es beschreibt ihre Begegnung mit bedeutenden Persönlichkeiten wie Ludwig Boltzmann und die Herausforderungen, denen sie als Frau in der Wissenschaft begegnete.
Berlin
Meitners Umzug nach Berlin und ihre Zusammenarbeit mit Otto Hahn im Bereich der Radioaktivitätsforschung stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels. Es schildert die Schwierigkeiten, denen Meitner als Frau in der wissenschaftlichen Welt Berlins begegnete, und die enge Zusammenarbeit mit Hahn, die zu bedeutenden Entdeckungen führte.
Im Ersten Weltkrieg
Dieses Kapitel beschreibt Meitners Erfahrungen als Röntgenschwester im Ersten Weltkrieg und ihre Herausforderungen im kriegsgeprägten Berlin. Trotz der belastenden Kriegszeit setzt sie ihre wissenschaftliche Arbeit fort.
Weimarer Zeiten
Das Kapitel beleuchtet Meitners wissenschaftliche Arbeit und ihre Rolle im Kontext der politischen Veränderungen der Weimarer Republik.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Lise Meitner, Otto Hahn, Radioaktivität, Kernphysik, Frauen in der Wissenschaft, Erste Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Flucht, Exil, Nobelpreis.
Häufig gestellte Fragen
Was waren Lise Meitners bedeutendste wissenschaftliche Beiträge?
Lise Meitner leistete Pionierarbeit in der Radioaktivitätsforschung und Kernphysik. Sie war maßgeblich an der theoretischen Erklärung der Kernspaltung beteiligt.
Mit wem arbeitete Lise Meitner in Berlin zusammen?
Sie pflegte eine jahrzehntelange, enge Zusammenarbeit mit dem Chemiker Otto Hahn, mit dem sie zahlreiche Entdeckungen im Bereich der Radioaktivität machte.
Warum musste Lise Meitner Deutschland verlassen?
Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft war sie unter dem Nationalsozialismus bedroht und musste 1938 ins Exil nach Schweden fliehen.
Welche Hürden gab es für sie als Frau in der Wissenschaft?
Zu Beginn ihrer Karriere durften Frauen in Preußen kaum studieren; Meitner musste oft inoffiziell arbeiten und hatte lange Zeit keinen gleichberechtigten Zugang zu akademischen Positionen.
Erhielt Lise Meitner den Nobelpreis?
Obwohl sie maßgeblich an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt war, erhielt nur Otto Hahn den Nobelpreis für Chemie, was bis heute als eine der großen Ungerechtigkeiten der Wissenschaftsgeschichte gilt.
- Arbeit zitieren
- M.A. / Dipl.Kfm.(FH) Oliver H. Herde (Autor:in), 2011, Lise Meitner - Lebensweg und Erfolg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184285