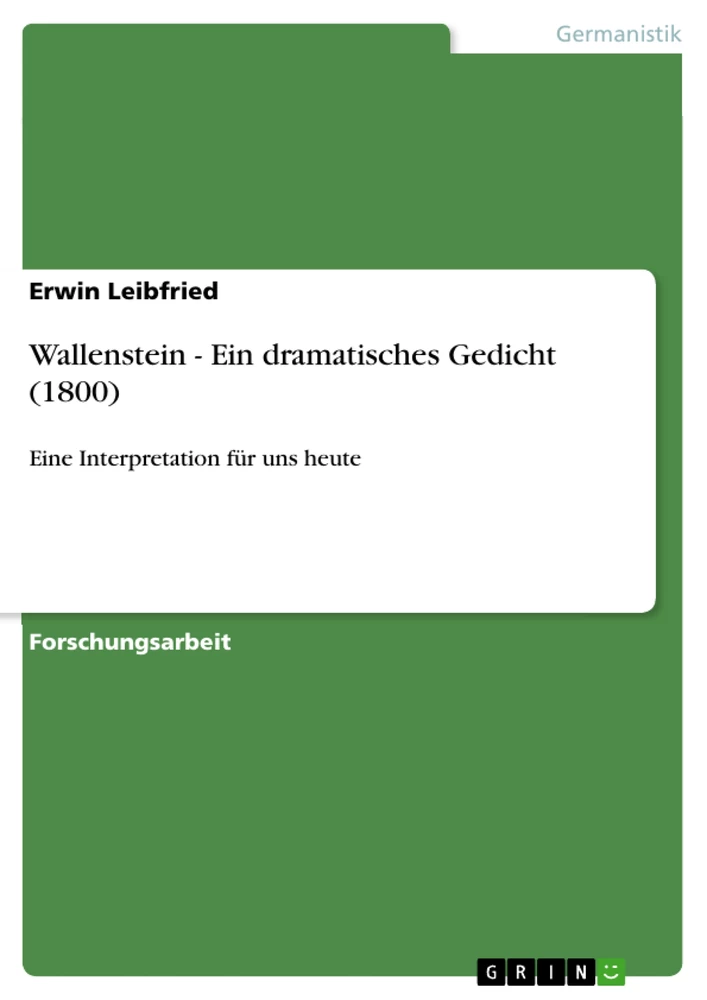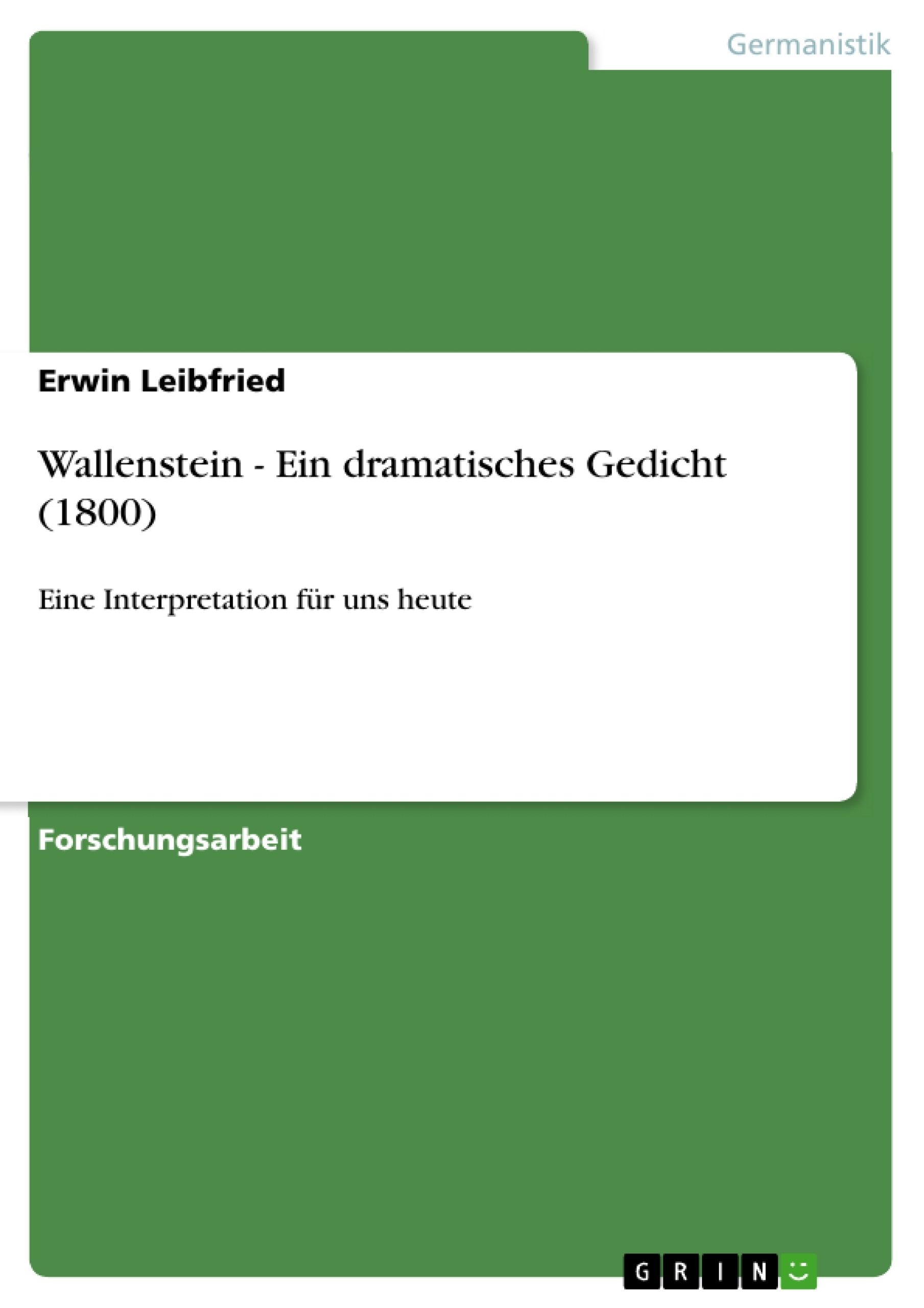Die Arbeit interpretiert Schillers Drama fortlaufend; sie arbeitet die wesentliche Forschungsliteratur kritisch ein und fragt implizite nach dem Wert des klasssichen Textes für uns heute.
Vorwort
Warum wieder Schiller? Es geht darum, ein Denkmal zu restaurieren, das mit Recht noch da steht Es geht darum, die Patina und den Dreck der Zeit abzuschmirgeln; denn was die Texte sagen, ist so gesagt, als sei es eigens uns gesagt. Brechts polemisch-hybrides Wort von den Klassikern, die im Krieg gestorben seien, ist halt schon im Literalsinn falsch : gestor¬ben sind faktisch auf dem Felde jene, die nicht in der Lage waren, die Lehre der Klassiker zu realisieren. Nicht die Klassiker haben versagt, sondern die, welche mit ihnen hätten etwas anfangen müssen.
Lehren ziehen aus dem Klassiker? Etwa diesen Kalibers: Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen . Antidemokratisch; monarchistisches, präfaschistisches Bewußt¬sein. Und nicht zu entschuldigen als Frühwerk, Jugendsünde. Spätestes Pro¬dukt, Unwiderrufbar. Ohne Kommentar ist dazuzusetzen: Gegenwärtiges. E. Wiedemann, 'Spiegel'-Reporter, schreibt am Ende eines Berichts über die Ereignisse im Iran:
"Wahr ist allerdings auch: Die Massen stehen trotz allem hinter Cho¬meini. Die Linken und Liberalen bringen zusammen selten mehr als 50 000 Demonstranten auf die Straße. Wenn aber Chomeini ruft, marschieren immer noch Millionen "
Prämisse der vorgelegten Analysen ist, daß - Autonomie hin, Form her - Dichtung in sich - geschichtliche Erfahrung hat, daß, erkennt man Dich¬tung, man erkennt, was der Mensch sei und was Geschichte. Wobei, schlimm daß man es sagen muß, Geschichte nicht die Zeitgeschichte des Autors ist: so als habe Schiller im 'Wallenstein' nacherzählt, was der französische Gene¬ral Dumouriez trieb, als er die Revolutionstruppen verließ und zum deutschen Feind überlief. Deshalb sind auch kluge Sätze, daß Schillers Dichtungen sich mit der Revolution auseinandersetzen, so klug wiederum nicht. Der Karis¬schüler brauchte die Revolution nicht, um zu merken, was Sache ist: die mundane, gesellschaftliche Verfassung der Menschheit, im Blick auf das, was die zeitgenössische Philosophie Kants als einen der Schlußsteine ihres Systems erarbeitet hatte: Freiheit Der 'Karlos', ebenso wie die anderen frühen Stücke, lange vor der Großen Revolution konzipiert und aufgeführt, verhandeln dies Problem poetisch vor dem Forum der Humanität.
Inhaltsverzeichnis
- Wallenstein
- Lust, Lärm und Leid: Zensur
- Aufsteiger
- Schicksal und Rolle der Frau
- Erfahrung
- Resignation und Enthusiasmus
- Rechnen, Astrologie, Zufall
- Dieser Schluß!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine Analyse von Schillers Wallenstein-Trilogie im Hinblick auf ihre heutige Relevanz. Es werden die dramaturgischen Besonderheiten, die geschichtlichen Hintergründe und die zentralen Themen des Werkes untersucht. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Handlung, der Charaktere und der philosophischen Fragestellungen, die Schiller in seinem Werk aufwirft.
- Die Darstellung des Verhältnisses von Freiheit und Gehorsam
- Die Rolle des Schicksals und die Frage nach der menschlichen Verantwortung
- Die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und politischen Intrigen
- Die Bedeutung von Illusion und Desillusionierung
- Die Verwendung von Symbolen und Metaphern in Schillers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Wallenstein: Dieses Kapitel analysiert die Gesamtkomposition der Wallenstein-Trilogie und beleuchtet die zentralen Konflikte, die zwischen Wallenstein und dem Kaiser, aber auch innerhalb Wallensteins selbst bestehen. Es geht um den Konflikt zwischen Machtstreben und moralischen Bedenken, zwischen persönlichem Ehrgeiz und dem Pflichtgefühl gegenüber dem Kaiser. Die ambivalenten Züge Wallensteins werden herausgearbeitet und im Kontext des Dreißigjährigen Krieges interpretiert. Es wird untersucht, wie Schiller die komplexe historische Situation in ein dramatisches Werk verwandelt.
Lust, Lärm und Leid: Zensur: Dieser Abschnitt befasst sich mit den zeitgenössischen Reaktionen auf Schillers Werk und den Zensurbedingungen im damaligen Berlin. Die Schwierigkeiten bei der Aufführung des Stücks und die Auseinandersetzung mit der politischen Realität werden beleuchtet. Der Abschnitt analysiert die Rezeption der Trilogie durch das Publikum und die Kritik, die es auslöste und zeigt, wie der vermeintliche "Lust- und Lärmspiel"-Charakter des Stücks mit tieferen, gesellschaftlichen und politischen Aspekten verbunden ist.
Aufsteiger: Die Rolle des Wallenstein als Aufsteiger und seine Karriere werden hier im Detail behandelt. Der Fokus liegt auf Buttlers Verhalten und der Frage nach dessen Konsistenz. Das Kapitel analysiert den Aufstieg Buttlers nicht als Folge von Treue, sondern als Ausdruck seines eigenen Machtstrebens, seiner Ambitionen und seines widersprüchlichen Charakters. Die Parallelen zwischen Wallenstein und Buttler werden untersucht und ihre Bedeutung für die Gesamtkomposition der Trilogie herausgearbeitet.
Schicksal und Rolle der Frau: Dieser Abschnitt erforscht die Bedeutung des Schicksals in Schillers Werk. Er analysiert das Verhältnis von Schicksal als vorgegebenem Verhängnis und als selbstgemachter Weg. Die Rolle der Frau, insbesondere Thekla, wird als Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Machtstrukturen untersucht. Theklas Schicksal wird als Produkt ihres Vaters dargestellt, als Ware in politischen Machtspielen. Die historische Einordnung Schillers und seine Positionierung werden hier in Relation zur Darstellung des weiblichen Schicksals gesetzt.
Erfahrung: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Erfahrung von Illusion und Desillusionierung im Stück. Der Bruch mit der beschränkten Idylle und der Transformation der Standesdifferenz werden analysiert. Es wird gezeigt, wie politische und familiäre Themen miteinander verknüpft sind und wie die Unterordnung der Frau in diesem Kontext zu verstehen ist. Wallensteins Pläne und der tragische Konflikt, der daraus resultiert, werden beleuchtet. Die Desillusionierung als zentrales Moment der Erfahrung für die beteiligten Figuren wird detailliert dargestellt.
Resignation und Enthusiasmus: Das Kapitel untersucht die zentralen Parameter des menschlichen Handelns in der Trilogie. Es geht um die Spannung zwischen "tückischen Mächten" und "menschlicher Kunst", zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Die Themen der Entsagung, der Idylle der Arbeit, des faustischen Vertrauens und der Verzweiflung werden erörtert. Die antithetischen Momente und die formale Struktur der Repliken werden in diesem Zusammenhang analysiert. Max' Idyllenentwurf und die realistische Beschreibung durch die Gräfin Terzky werden im Kontext zueinander gesetzt.
Rechnen, Astrologie, Zufall: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Rolle von Vernunft und Zufall im Geschehen. Wallensteins Umgang mit seiner eigenen Tochter Thekla als Kapital und nicht als Person wird beleuchtet. Es wird der Abstand zwischen Poesie und Wirklichkeit untersucht sowie die kritische Distanzierung Schillers zur Welt der Berechnung. Das Motiv der Astrologie und die Frage nach der Berechenbarkeit der Welt werden als zentrale Aspekte des tragischen Handlungsmusters erörtert.
Schlüsselwörter
Wallenstein, Schiller, Dreißigjähriger Krieg, Tragödie, Macht, Schicksal, Freiheit, Gehorsam, Intrige, Illusion, Desillusionierung, Verantwortung, menschliches Handeln, Aufklärung, Realität, Poesie.
Häufig gestellte Fragen zur Schiller-Wallenstein-Trilogie-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Analyse untersucht Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie. Sie betrachtet dramaturgische Besonderheiten, historische Hintergründe und zentrale Themen des Werks und deren heutige Relevanz. Im Fokus stehen Interpretation der Handlung, der Charaktere und der philosophischen Fragestellungen.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse befasst sich mit dem Verhältnis von Freiheit und Gehorsam, der Rolle des Schicksals und der menschlichen Verantwortung, Machtstrukturen und politischen Intrigen, Illusion und Desillusionierung, sowie der Verwendung von Symbolen und Metaphern in Schillers Werk. Konkrete Aspekte umfassen Wallensteins Aufstieg und Fall, die Rolle der Frau (insbesondere Thekla), die Erfahrung von Illusion und Desillusionierung, Resignation und Enthusiasmus, sowie die Rolle von Vernunft, Astrologie und Zufall.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: "Wallenstein" (Gesamtkomposition und zentrale Konflikte), "Lust, Lärm und Leid: Zensur" (zeitgenössische Reaktionen und Zensur), "Aufsteiger" (Wallensteins und Buttlers Aufstieg), "Schicksal und Rolle der Frau", "Erfahrung" (Illusion und Desillusionierung), "Resignation und Enthusiasmus", "Rechnen, Astrologie, Zufall", und eine Zusammenfassung der Schlüsselwörter.
Wie wird Wallenstein in der Analyse dargestellt?
Die Analyse beleuchtet Wallenstein als komplexe Figur, die von Machtstreben und moralischen Bedenken, persönlichem Ehrgeiz und Pflichtgefühl geprägt ist. Seine ambivalenten Züge werden herausgearbeitet und im Kontext des Dreißigjährigen Krieges interpretiert. Sein Verhältnis zu seiner Tochter Thekla und sein Umgang mit ihr als politisches Kapital werden ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt das Schicksal in der Analyse?
Die Analyse untersucht die Bedeutung des Schicksals als vorgegebenes Verhängnis und als selbstgemachter Weg. Das Schicksal der weiblichen Figuren, insbesondere Theklas, wird als Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse und Machtstrukturen analysiert. Die Frage nach der menschlichen Verantwortung im Angesicht des Schicksals wird ebenfalls erörtert.
Welche Bedeutung hat die Zensur für die Analyse?
Die Analyse betrachtet die zeitgenössischen Reaktionen auf Schillers Werk und die Zensurbedingungen in Berlin. Die Schwierigkeiten bei der Aufführung und die Auseinandersetzung mit der politischen Realität werden beleuchtet, ebenso wie die Rezeption der Trilogie durch Publikum und Kritik.
Wie werden Illusion und Desillusionierung behandelt?
Der Bruch mit der beschränkten Idylle und die Transformation der Standesdifferenz werden analysiert. Die Analyse zeigt, wie politische und familiäre Themen verknüpft sind und wie die Unterordnung der Frau in diesem Kontext zu verstehen ist. Die Desillusionierung als zentrales Moment der Erfahrung für die beteiligten Figuren wird detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielen Vernunft und Zufall?
Die Analyse fokussiert sich auf die Rolle von Vernunft und Zufall im Geschehen. Wallensteins Umgang mit seiner Tochter als Kapital und nicht als Person wird beleuchtet. Der Abstand zwischen Poesie und Wirklichkeit und Schillers kritische Distanzierung zur Welt der Berechnung werden untersucht. Das Motiv der Astrologie und die Frage nach der Berechenbarkeit der Welt werden als zentrale Aspekte des tragischen Handlungsmusters erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter der Analyse sind: Wallenstein, Schiller, Dreißigjähriger Krieg, Tragödie, Macht, Schicksal, Freiheit, Gehorsam, Intrige, Illusion, Desillusionierung, Verantwortung, menschliches Handeln, Aufklärung, Realität, Poesie.
- Citar trabajo
- Prof. Dr. Erwin Leibfried (Autor), 1985, Wallenstein - Ein dramatisches Gedicht (1800), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184324