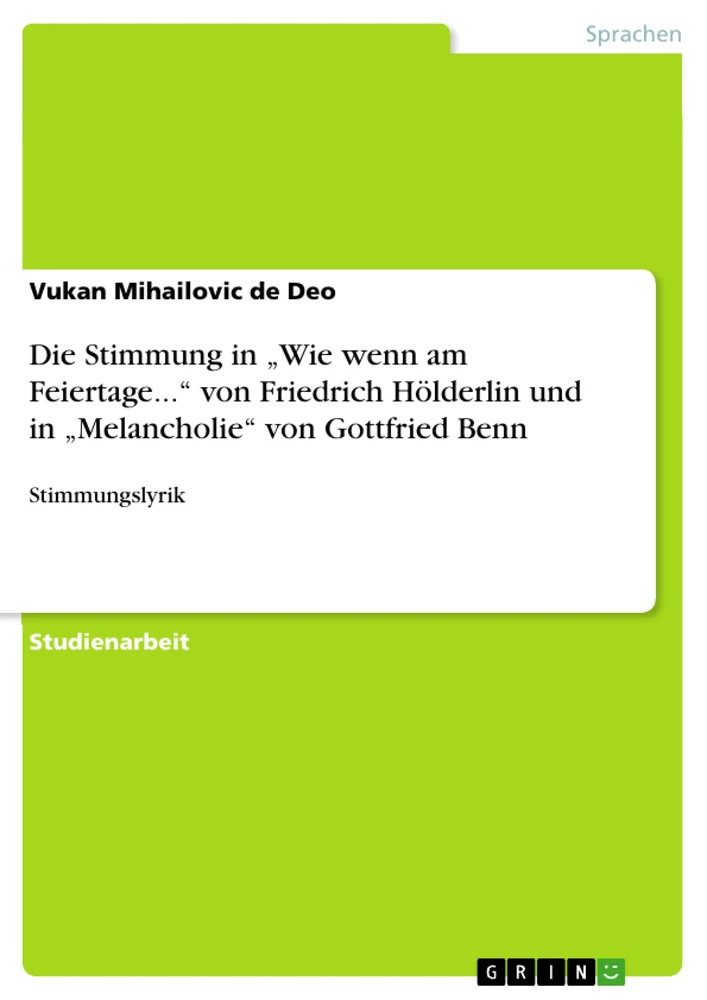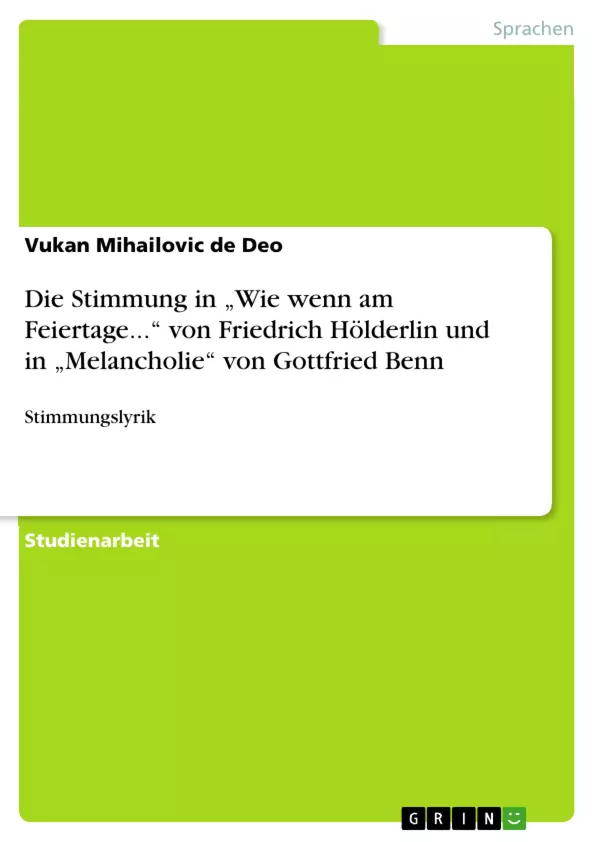Stimmungen gehören zu Empfindungen. Im Gegensatz zu Gefühlen sind sie jedoch nicht konkret auf einen Gegenstand gerichtet. Anders gesagt stehen Stimmungen in Verbindung zu Kognitionen, während Gefühle zu Handlungen führen. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder aufgegriffenes Beispiel für den Unterschied zwischen Gefühl und Stimmung ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst. Obwohl wir sprachlich mit beiden Begriffen das Gleiche ausdrücken können, ist die Angst per definitionem objektunbestimmt. Angst kann man haben, während man sich vor etwas fürchten muss. Diesen Gedankengang weiterführend, kann man sagen, dass Gefühle Stimmungen präzisieren. Eine Stimmung der Feierlichkeit schließt womöglich mehrere Gefühle ein, wie Stolz, Glück, Hoffnung, sogar Müdigkeit.
Gleichzeitig sind Stimmungen mit Atmosphären verbunden. Man kann über die Atmosphäre vor einem Sturm berichten oder die Stimmung auf einer Versammlung als verlogen oder skeptisch verstehen. Auf eine gewisse Weise „gestimmt“ oder gelaunt kann man sowohl alleine sein und dadurch die Umgebung entsprechend wahrnehmen, als auch in Gesellschaft, wobei die Stimmung da eine kommunikative, sozial vereinigende Rolle spielen kann. Abgesehen von pathologischen Ausnahmen wie zum Beispiel Schizophrenie kann man feststellen, dass Stimmungen vereinheitlichend wirken. Sie sind wie emotionale Glocken, die eine Landschaft, eine Gruppe von Subjekten oder eine Einzelperson umschließen.
Wenn man wissen will, auf welche Weise Stimmungen entstehen, muss man vor allem deren Eigenschaften festlegen. Mit dem Erkennen dieser Charakteristika sind wir als Künstler oder als Wissenschaftler in der Lage, eine Stimmung zu produzieren oder genau zu definieren. Was sind also die Regeln, nach denen eine bestimmte Stimmung entsteht?
Um diese Frage zu beantworten, empfiehlt es sich, zunächst die unterschiedlichen theoretischen Ansätze zum Stimmungsbegriff kurz darzustellen.
Das Wort „Stimmen“ stammt ursprünglich aus der Musiktheorie, wo es ein „In-Verhältnis-Setzen von Teilen“ mit dem Ziel der Harmonisierung von Instrumenten bezeichnet. Diese Tatsache versetzte den Begriff der Stimmung in der deutschen Lyrik für immer in den unendlichen Raum der Metapher.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Stimmungsbegriff im Diskurs der ästhetischen Theorie
- Die Stimmung in Hölderlins „Wie wenn am Feiertage...“
- Die Stimmung in Benns „Melancholie“
- Das Spiel mit dem Mythos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Stimmungsbegriffs in der deutschen Literatur, insbesondere anhand von Hölderlins „Wie wenn am Feiertage...“ und Benns „Melancholie“. Die Analyse zielt darauf ab, die Vielschichtigkeit und Wandelbarkeit des Stimmungsbegriffs aufzuzeigen und dessen Einbettung in den Diskurs der ästhetischen Theorie zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Stimmung in der ästhetischen Theorie
- Die Darstellung von Stimmung in Hölderlins „Wie wenn am Feiertage...“
- Die Darstellung von Stimmung in Benns „Melancholie“
- Die Rolle des Mythos in der Gestaltung von Stimmung
- Vergleichende Analyse der beiden Gedichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Der einleitende Abschnitt stellt das Thema der Arbeit vor und kritisiert vereinfachende Ansätze in der Analyse von Gedichten und literarischen Epochen, insbesondere in Bezug auf die Kategorie „Stimmungslyrik“. Die Arbeit argumentiert für eine differenzierte Betrachtung des Stimmungsbegriffs, die seine Vielschichtigkeit und Bedeutung über verschiedene Epochen hinweg anerkennt.
Der Stimmungsbegriff im Diskurs der ästhetischen Theorie
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Stimmungsbegriffs in der ästhetischen Theorie. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze von Kant, Goethe, Schiller und Humboldt vorgestellt, die den Begriff der Stimmung als Mittler zwischen Verstand und Schönheit, als ästhetisches Ereignis und als „Einstellung gegenüber der Welt“ begreifen.
Die Stimmung in Hölderlins „Wie wenn am Feiertage...“
Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung von Stimmung in Hölderlins Gedicht „Wie wenn am Feiertage...“. Es werden die in dem Gedicht präsenten Stimmungen und ihre Verbindung zur poetischen Sprache, sowie zur Gestaltung des Mythos beleuchtet.
Die Stimmung in Benns „Melancholie“
Hier wird die Stimmung in Gottfried Benns „Melancholie“ analysiert. Der Fokus liegt auf der Gestaltung der Melancholie als Stimmung und ihrer Beziehung zum sprachlichen Ausdruck, sowie zum philosophischen Gehalt des Gedichtes.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Stimmungsbegriff und dessen Bedeutung in der deutschen Literatur. Im Zentrum stehen die Analyse der Stimmungen in Hölderlins „Wie wenn am Feiertage...“ und Benns „Melancholie“ sowie die Verortung des Stimmungsbegriffs im Diskurs der ästhetischen Theorie. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind daher: Stimmung, ästhetische Theorie, Gedichtanalyse, Hölderlin, Benn, Mythos, Melancholie, Lyrik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Begriff „Stimmung“ in der ästhetischen Theorie definiert?
Stimmung wird als Mittler zwischen Verstand und Schönheit begriffen, oft als eine „Einstellung gegenüber der Welt“ oder als vereinheitlichende „emotionale Glocke“, die ein Subjekt oder eine Landschaft umschließt.
Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Stimmung?
Gefühle sind meist konkret auf einen Gegenstand gerichtet (z. B. Furcht vor etwas), während Stimmungen objektunbestimmt sind (z. B. Angst oder Feierlichkeit) und den Hintergrund der Wahrnehmung bilden.
Wie gestaltet Hölderlin Stimmung in „Wie wenn am Feiertage...“?
Hölderlin verbindet in seinem Gedicht feierliche Stimmungen mit der poetischen Sprache und der Konstruktion von Mythen, um ein Verhältnis zwischen Natur und Mensch auszudrücken.
Welche Rolle spielt die Melancholie in Gottfried Benns Werk?
In Benns Gedicht „Melancholie“ wird diese als eine spezifische moderne Stimmung analysiert, die eng mit dem sprachlichen Ausdruck und philosophischen Reflexionen verknüpft ist.
Woher stammt das Wort „Stimmung“ ursprünglich?
Der Begriff stammt aus der Musiktheorie und bezeichnete ursprünglich das „In-Verhältnis-Setzen von Teilen“ zur Harmonisierung von Instrumenten.
- Quote paper
- Vukan Mihailovic de Deo (Author), 2010, Die Stimmung in „Wie wenn am Feiertage...“ von Friedrich Hölderlin und in „Melancholie“ von Gottfried Benn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184331