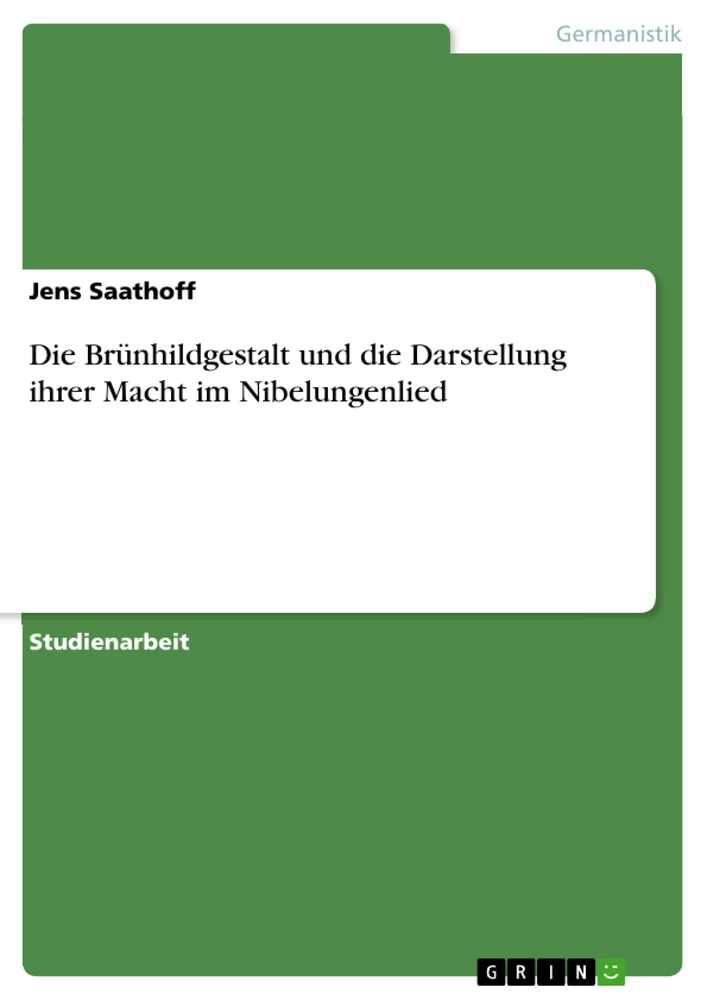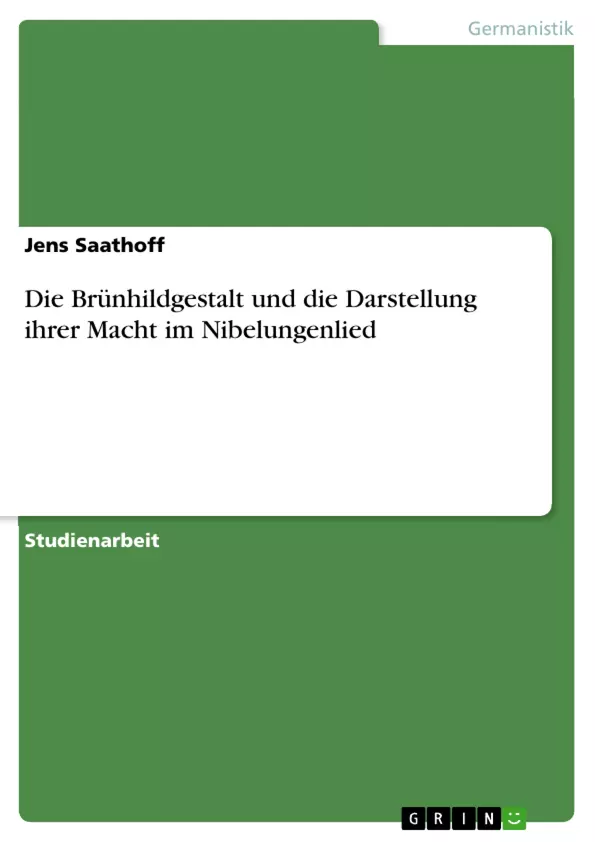Diese Arbeit befaßt sich mit der Darstellung Brünhilds im Nibelungenlied.Gemessen an Textumfang und Funktion kommt der Brünhildgestalt im Nibelungenlied nur bedingt eine wichtige Rolle zu, die knapp skizziert folgendermaßen aussieht: Brünhild tritt als mächtige Herrscherin Isensteins auf, die sich in heroischen Wettkämpfen ihrer Freier erwehrt, durch den Werbungsbetrug Sigfrids und Gunthers aber an den Wormser Hof gelangt und dort durch einen weiteren Betrug ihrer Jungfräulichkeit und ihrer Macht verlustig geht. Schließlich wird durch einen Streit Brünhilds mit Kriemhild, der auf den Betrug zurückgeht, die Ermordung Sigfrids in die Wege geleitet.
Doch diese Schilderung der Rolle Brünhilds ist in ihrer Kürze provokant und läßt vieles übersehen. Zwar enthält die Ausarbeitung dieser Textfigur vielfach nur Andeutungen, zeigt Widersprüche auf und läßt eine Menge von Fragen offen, aber gerade hierdurch wird das Interesse an der Brünhildgestalt geweckt. Man erahnt, daß die Geschichte über Brünhild, vor allem ihre Beziehung zu Sigfrid, ursprünglich eine größere Stofffülle beinhaltet als im Nibelungenlied offensichtlich wird, und beginnt, Motive des Textes zu hinterfragen.
Wie wird Brünhild in den Kampfspielen charakterisiert? Wie stellt sich der Werbungsbetrug dar und welche Auswirkungen hat er? Welcher Art sind die Verbindungen Brünhilds zu Sigfrid und Gunther?
Bei all diesen Fragen scheint der Aspekt der Macht eine bedeutende Rolle zu spielen. Daher wird den Machtverhältnissen ein Schwerpunkt bei der Untersuchung eingeräumt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen der Brünhilderzählung
- Die These über die Existenz von zwei Quellen
- Der Werbungsbetrug
- Der Streit der Königinnen
- Versuch einer Gegenüberstellung der Quellen
- Brünhilds Macht
- Der Wunsch nach Unabhängigkeit vom männlichen Geschlecht
- Brünhilds soziale Stellung
- Die Beziehung Brünhilds zu Sigfrid und Gunther
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Brünhildgestalt im Nibelungenlied und untersucht insbesondere die Frage nach ihrer Macht und ihrer Rolle im Handlungsverlauf. Dabei wird die These vertreten, dass die Brünhildfigur aus zwei verschiedenen Quellen zusammengesetzt ist, die sich in der Motivverwendung und im Handlungsverlauf widersprechen. Die Arbeit analysiert diese Widersprüche und rekonstruiert die beiden Quellen anhand von Vergleichen mit der Thidrekssaga.
- Die Quellenlage des Nibelungenliedes und die These von zwei Quellen für die Brünhildfigur
- Die Darstellung der Macht Brünhilds und ihre Beziehung zu Sigfrid und Gunther
- Die Rolle des Werbungsbetrugs und seine Auswirkungen auf Brünhilds Macht und Schicksal
- Die Bedeutung des Streits zwischen Brünhild und Kriemhild für die Handlung des Nibelungenliedes
- Die Frage nach der ursprünglichen Stofffülle der Brünhildgeschichte und ihre Bedeutung für die Interpretation des Nibelungenliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Brünhildgestalt im Nibelungenlied vor und skizziert ihre Rolle im Handlungsverlauf. Sie hebt die Widersprüche und offenen Fragen hervor, die das Interesse an der Brünhildfigur wecken und die Notwendigkeit einer tieferen Analyse ihrer Macht und ihrer Beziehung zu Sigfrid und Gunther unterstreichen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Quellenlage des Nibelungenliedes und der These von Joachim Bumke, dass die Brünhildfigur aus zwei verschiedenen Quellen zusammengesetzt ist. Bumke rekonstruiert zwei parallele Handlungsstränge, die auf die beiden Quellen hinweisen. Der erste Handlungsstrang, der dem Brünhildlied entspricht, zeichnet sich durch die Abwesenheit von Wettkämpfen aus, während der zweite Handlungsstrang, der auf eine nordische Quelle zurückzuführen ist, den Wettkampf als Freiersprobe beinhaltet.
Das dritte Kapitel analysiert die Darstellung der Macht Brünhilds im Nibelungenlied. Es untersucht ihren Wunsch nach Unabhängigkeit vom männlichen Geschlecht, ihre soziale Stellung als Herrscherin Isensteins und ihre Beziehung zu Sigfrid und Gunther. Die Analyse zeigt, dass Brünhilds Macht durch den Werbungsbetrug und den Streit mit Kriemhild schrittweise untergraben wird, was letztendlich zu ihrer Tragödie führt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Brünhildgestalt, das Nibelungenlied, die Quellenlage, die Macht, die Unabhängigkeit, die soziale Stellung, der Werbungsbetrug, die Beziehung zu Sigfrid und Gunther, der Streit mit Kriemhild, die Tragödie und die Interpretation des Nibelungenliedes.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Brünhild im Nibelungenlied?
Brünhild ist die mächtige Königin von Isenstein, die über übermenschliche Kräfte verfügt und nur denjenigen heiraten will, der sie im Kampf besiegt.
Was war der Werbungsbetrug im Nibelungenlied?
Siegfried half König Gunther mit Hilfe einer Tarnkappe, die Wettkämpfe gegen Brünhild zu gewinnen, wodurch diese getäuscht und zur Ehe gezwungen wurde.
Wie verliert Brünhild ihre Macht?
Durch den Verlust ihrer Jungfräulichkeit (ebenfalls durch Siegfrieds heimliche Hilfe für Gunther) verliert Brünhild ihre übernatürliche Stärke.
Was ist der Kern des Königinnenstreits?
Brünhild und Kriemhild streiten vor dem Wormser Dom darüber, wessen Ehemann den höheren Rang einnimmt, wobei Kriemhild den Betrug an Brünhild offenbart.
Welche Rolle spielt die Thidrekssaga für die Analyse?
Die Thidrekssaga dient als Vergleichsquelle, um die ursprüngliche Stofffülle und mögliche Widersprüche in der Darstellung Brünhilds im Nibelungenlied aufzuzeigen.
- Quote paper
- Dr. Jens Saathoff (Author), 1991, Die Brünhildgestalt und die Darstellung ihrer Macht im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184378