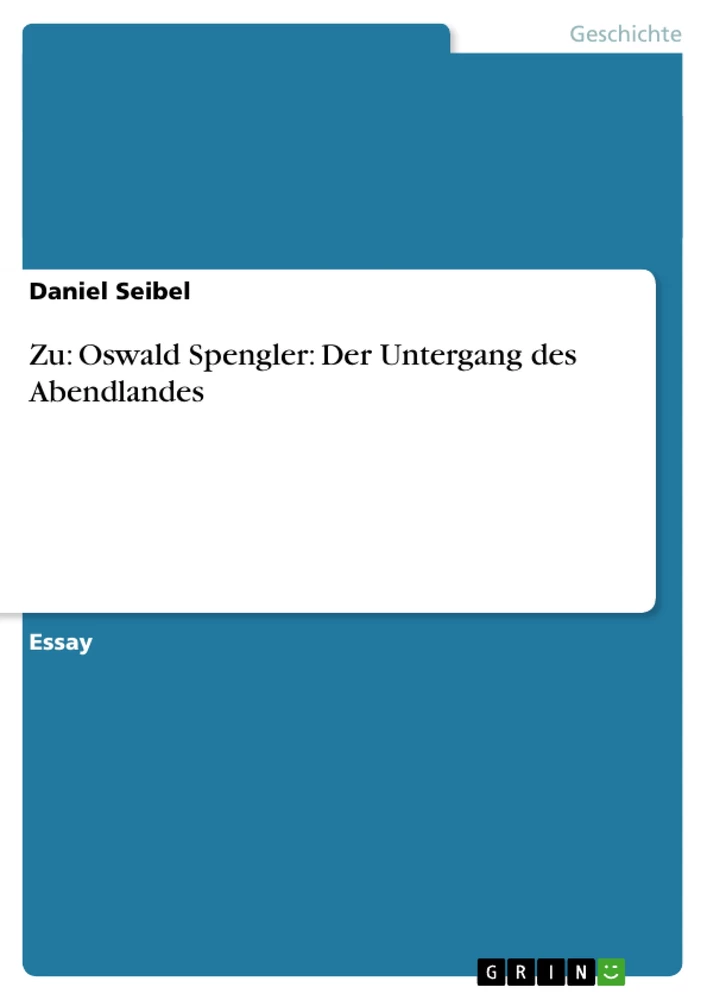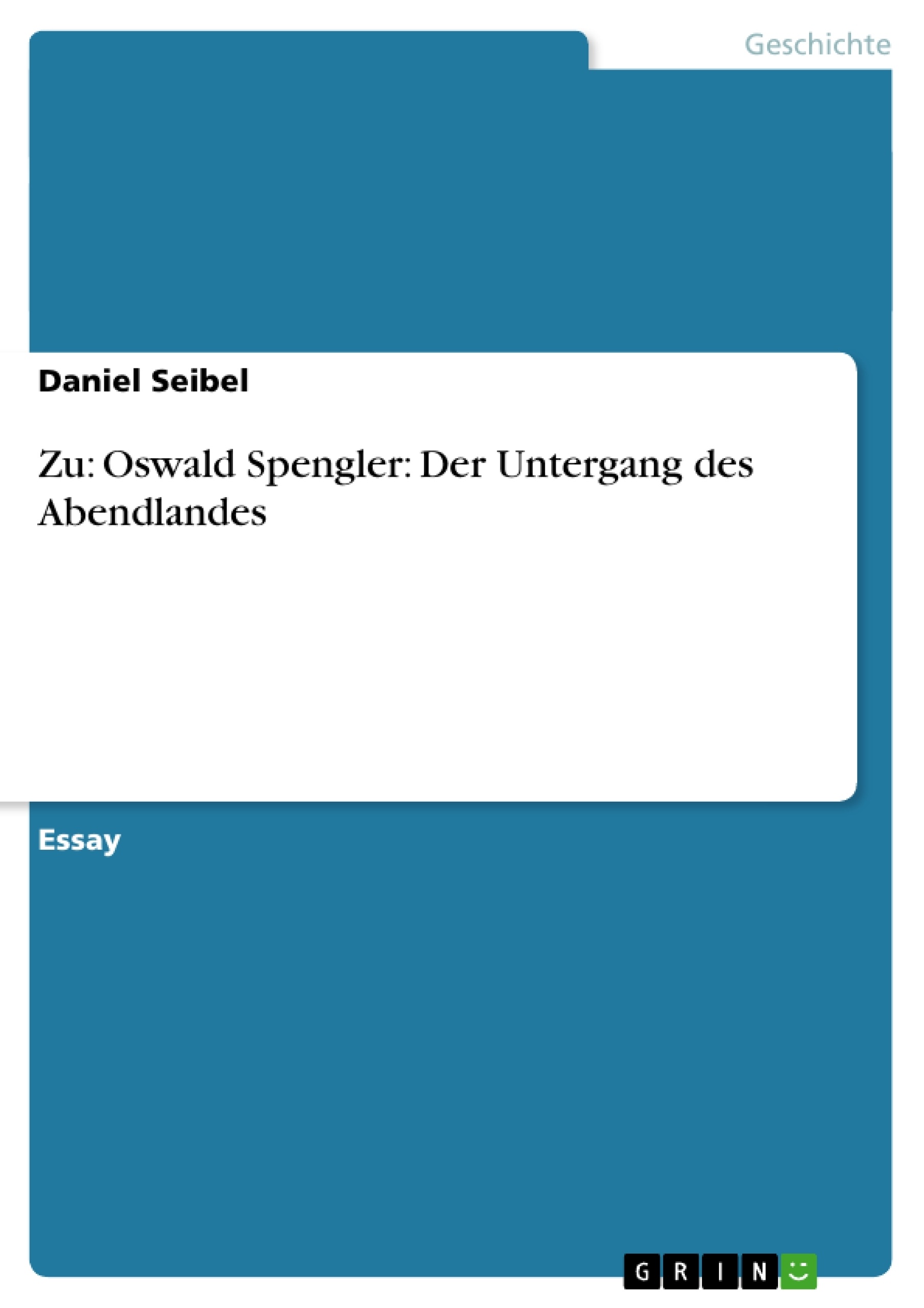Wenn sich je ein Titel von seinem Buch löste - um zum geflügelten Wort zu werden -dann im Fall Spenglers. Sein Werk, so vieldeutig wie universal, stellt keinen geringeren als den im ersten Satz formulierten Anspruch: In diesem Buch wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. 1 Oswald Spengler, 1880 in Blankenburg/Harz geboren, entwickelt schon früh Monumentalphantasien. In Schulheften finden sich Notizen über imaginäre Reiche - Einträge zur Bevölkerungsdichte bis hin zur Verfassung. Er entwickelt Chronologien und Historien, es geht um Entscheidungskämpfe, um die Neuordnung Europas und der übrigen Welt. Seine Begeisterung für Literatur und Philosophie führt zu regelrechten Leseobsessionen. Er verschlingt bereits in jungen Jahren große Teile der Weltliteratur und zeigt sich vor allem von der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches nachhaltig beeindruckt. Sein Studium der Mathematik und Naturwissenschaft schließt er 1904 mit einer Dissertation über Heraklit ab. Hier benutzt Spengler bereits Motive des Werdens und Vergehens und deutet den Untergang der antiken Aristokratie als „vollkommen zu Ende gedachtes System des Relativismus.“ 2 Nachdem das Erbe seiner Mutter ihn finanziell unabhängig macht hat, gibt er den Lehrberuf auf und läßt sich in München als freier Schriftsteller nieder. Doch statt Anschluß an die Münchener Avantgarde sucht er deren Gegnerschaft. In selbstgewählter Einsamkeit, zwischen Sensibilität und Vermessenheit, beginnt Spengler sein Werk. Die Krise von Agadir, die Deutschland weitgehend politisch isolierte, sieht er als geistigen Wendepunkt, als „Typus einer historischen Zeitwende, die innerhalb eines großen historischen Organismus von genau begrenzbarem Umfange einen biographisch seit Jahrhunderten vorbestimmten Platz hatte“ 3 ; sie wird für ihn zum Kairos.
Spenglers Werk will Diagnose und Prognose sein. In einem Brief an einen Verleger spricht er von „einer vollständigen Analyse der menschlichen Kultur“. 4 Er will mehr als Zivilisationskritik aus einem Zeitgefühl heraus. Spenglers neue Methode soll es möglich machen, Geschichte in ihren noch nicht abgelaufenen Stadien vorauszusagen. Der erste Band, der 1918 erscheint, trägt den Untertitel „Gestalt und Wirklichkeit“. Hier geht es Spengler darum, die Formensprache der großen Kulturen darzulegen, ihre Wurzeln und die Grundlagen ihrer Symbolik aufzuzeigen. Im weiteren versucht er einen Vergleich der Kulturen untereinander. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Untergang des Abendlandes
- 1. Von der Gestalt und Wirklichkeit
- a) Der Sinn der Geschichte
- b) Kultur und Zivilisation
- c) Die morphologische Gleichzeitigkeit der Kulturen
- 2. Die Physiognomik der Kulturen
- a) Die Formensprache des Ursymbols
- b) Die acht Hochkulturen
- c) Die ägyptische Kultur
- 3. Die faustische Seele
- a) Die abendländische Kultur und ihre Krise
- b) Die Ursprünge der abendländischen Kultur
- c) Das Ursymbol des Abendlandes
- 1. Von der Gestalt und Wirklichkeit
- II. Welthistorische Perspektiven
- 1. Die Geschichte der Kulturen
- 2. Die Krise der abendländischen Kultur
- 3. Die Zukunft des Abendlandes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Spenglers Hauptziel in „Der Untergang des Abendlandes“ ist es, eine neue, umfassende Geschichtstheorie zu entwickeln, die Geschichte nicht als linearen Fortschritt, sondern als zyklischen Prozess begreift. Er strebt nach einer morphologischen Analyse der Weltgeschichte, die die „Formensprache“ der Kulturen und ihren Aufstieg und Verfall aufzeigt.
- Morphologie der Weltgeschichte und zyklische Geschichtsauffassung
- Kulturen und Zivilisationen: Aufstieg und Verfall
- Das Ursymbol und die Formensprache der Kulturen
- Die acht Hochkulturen und ihre morphologische Gleichzeitigkeit
- Kritik an der traditionellen Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der Untergang des Abendlandes
- 1. Von der Gestalt und Wirklichkeit
- a) In diesem Kapitel stellt Spengler seine These vom Untergang des Abendlandes vor und erklärt seine Methode der morphologischen Analyse.
- b) Er unterscheidet zwischen Kultur und Zivilisation, wobei Zivilisation als das Endstadium einer Kultur betrachtet wird, das durch Verfall und Dekadenz gekennzeichnet ist.
- c) Spengler argumentiert, dass alle Kulturen gleichzeitig existieren und sich in ihren Stadien der Entwicklung entsprechen, obwohl sie in verschiedenen Epochen beginnen und enden.
- 2. Die Physiognomik der Kulturen
- a) Spengler erklärt die Bedeutung des Ursymbols als prägende Kraft, die die Lebensäußerungen einer Kultur bestimmt.
- b) Er beschreibt die acht Hochkulturen (ägyptisch, arabisch, babylonisch, mexikanisch, chinesisch, indisch, antik, abendländisch) und ihre jeweiligen Ursymbole.
- c) Er analysiert die ägyptische Kultur und ihre Formsprache, die durch das Ursymbol des „Weges“ geprägt ist.
- 3. Die faustische Seele
- a) Spengler untersucht die Krise der abendländischen Kultur, die er als „faustische Seele“ bezeichnet.
- b) Er betrachtet die Ursprünge der abendländischen Kultur und deren Entwicklung.
- c) Er identifiziert das Ursymbol des Abendlandes als den „unendlichen Raum“, der die Streben nach Grenzenlosigkeit und die „faustische“ Sehnsucht nach Wissen und Macht repräsentiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe in Spenglers Werk sind Morphologie, Kultur, Zivilisation, Ursymbol, Formensprache, Hochkulturen, zyklische Geschichtsauffassung, physiognomischer Takt, Weltgeschichte, Simultaneität, abendländische Kultur, faustische Seele, und Untergang.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“?
Spengler begreift Geschichte als zyklischen Prozess, in dem Kulturen wie lebende Organismen geboren werden, blühen und schließlich in einer erstarrten „Zivilisation“ untergehen.
Was unterscheidet bei Spengler „Kultur“ von „Zivilisation“?
Kultur ist die schöpferische Phase eines Volkes, geprägt von Religion und Kunst. Zivilisation ist das Endstadium, gekennzeichnet durch Technisierung, Großstädte, Materialismus und geistige Erstarrung.
Was meint Spengler mit dem „Ursymbol“ einer Kultur?
Jede Hochkultur hat ein prägendes Ursymbol (z.B. der „unendliche Raum“ für das Abendland oder der „Weg“ für Ägypten), das alle Lebensäußerungen, von der Kunst bis zur Mathematik, bestimmt.
Warum bezeichnet Spengler die abendländische Seele als „faustisch“?
Die „faustische Seele“ steht für das Streben nach dem Unendlichen, nach Macht, Wissen und der Überwindung von Grenzen, was Spengler als charakteristisch für die westliche Kultur ansieht.
Was ist die Methode der „Morphologie der Weltgeschichte“?
Es ist der Versuch, durch den Vergleich der äußeren Formen und Lebensphasen verschiedener Kulturen Gesetzmäßigkeiten zu finden, um den zukünftigen Verlauf der Geschichte vorauszubestimmen.
- Quote paper
- Daniel Seibel (Author), 2002, Zu: Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18439